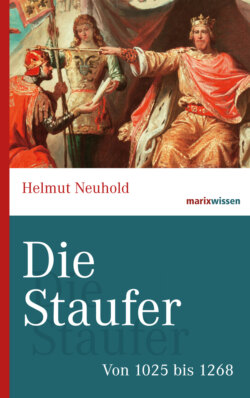Читать книгу Die Staufer - Helmut Neuhold - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KEIN GESCHLECHT WIE JEDES ANDERE
Оглавление»Kein Geschlecht war wohl je zu solcher Höhe berufen durch herrscherliche Art und weltweite Bildung – keines so gezeichnet vom Tode wie die Staufer.« (Eberhard Cyran 1986)
Zwischen den Städten Göppingen und Schwäbisch Gmünd liegt ein weithin sichtbarer und markanter Berg. Der 684 m hohe Hohenstaufen ist von einer Ruine gekrönt, die einst die Stammburg eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter der europäischen Geschichte war. Der seinerzeit mächtige Fürstensitz, von dem nach seiner Zerstörung in den Bauernkriegen nur noch kümmerliche Reste blieben, war der Sitz eines Geschlechts, das man später die Staufer nannte. Aus ihm gingen sechs deutsche Könige hervor, von denen drei die römische Kaiserkrone tragen sollten. Die Staufer, die später auch manchmal Hohenstaufer genannt wurden, haben die deutsche und europäische Geschichte des hohen Mittelalters in großem Maße geprägt. Diese haben wie kaum ein Geschlecht jener Epoche innerhalb kurzer Zeit eine Reihe von bedeutenden und kraftvollen Herrschergestalten hervorgebracht, die im kollektiven Gedächtnis viel präsenter sind, als andere Könige und Kaiser des deutschen Mittelalters. Ausgehend von Konrad III., dem »Pfaffenkönig«, konnten die Staufer mehr als hundert Jahre lang trotz aller Anfeindungen die deutsche Königswürde und ihren Anspruch auf das Kaisertum behaupten. In dieser relativ kurzen Epoche brachte das Geschlecht einige der bedeutendsten Herrschergestalten der europäischen Geschichte hervor.
Die große Zeit des Geschlechts begann 1138, als der Staufer Konrad sich bei der Königswahl gegen den mächtigen Herzog Heinrich den Stolzen aus dem Geschlecht der Welfen durchsetzen konnte. Diese Wahl war der Anfang der staufischen Herrschaft im Reich ebenso wie der Beginn der erbitterten Feindschaft der beiden mächtigsten deutschen Adelsgeschlechter. »Hie Welf, hie Waibling!« Dieser Kampfruf schallte Jahrzehnte lang durch das Reich. Er symbolisierte den Kampf der Staufer und der Welfen um die Macht und die Königswürde. Auch in Italien tobte dieser Kampf, nur hießen die Parteien hier »Guelfen« und »Ghibellinen«. Die Auseinandersetzung war bereits seit dem Beginn der staufischen Herrschaft im Reich im Gange, als die zentralen Figuren dabei blieben aber Kaiser Friedrich Barbarossa und Herzog Heinrich der Löwe in Erinnerung. Diese zwei gewaltigen Persönlichkeiten ragen wie erratische Blöcke aus der Geschichte des Mittelalters empor.
Unter dem früh verstorbenen Kaiser Heinrich VI. erstreckte sich die staufische Herrschaft über das ganze deutsche Reich und Italien. Kaiser Friedrich II., genannt »stupor mundi« (das Staunen der Welt) konnte den Glanz und die Macht der Staufer noch einmal in ihrer vollen Pracht entfalten. Doch hatte er auch einen Jahrzehnte dauernden Konflikt mit mehreren Päpsten zu bestehen, der an den Fundamenten seiner Herrschaft zehrte und ihn mehr als einmal in der Defensive sah. Als Friedrich II. starb, war dies eigentlich schon das Ende der glanzvollen staufischen Epoche. Die Nachfolger des letzten großen Staufers konnten nicht mehr an den alten Glanz ihres Hauses anschließen, das staufische Geschlecht erlebte einen raschen Niedergang. Am Ende stand die Hinrichtung des glücklosen Jünglings Konradin auf dem Marktplatz von Neapel. Dann begann die »kaiserlose, die schreckliche Zeit«.
Das Schicksal der Staufer hat nicht nur die Zeitgenossen beeindruckt, der Faszination, die der Aufstieg, die glanzvolle Herrschaft und der tiefe Fall dieses einzigartigen Geschlechts bis in unsere Zeit ausüben, kann man sich auch heute nur schwer entziehen. Fast romanhaft erscheinen einige der Vertreter dieser Dynastie und auch einige ihrer Gegenspieler. Die bedeutendsten Staufer erreichten eine Popularität, an die ihre mittelalterlichen Vorgänger und Nachfolger, wie die Ottonen, die Salier, die Luxemburger und auch die Habsburger kaum herankamen.
Einer der Hauptkritikpunkte an der Politik der meisten Staufer war deren Ausrichtung auf Italien. Hierin sahen viele Historiker den eigentlichen Grund für das letztliche Scheitern dieser Herrscherdynastie. Italien wurde unter Friedrich Barbarossa zum eigentlich wichtigsten Schauplatz der Reichspolitik und seine Nachfolger hielten daran fest. Auch wenn man den Staufern eine romantische Sehnsucht für das Land, »in dem die Zitronen blühen«, nachsagte, so standen letztlich in erster Linie machtpolitische und wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Allerdings führte das auch zu einem zermürbenden Konflikt mit einer Reihe von Päpsten und vielen nach Unabhängigkeit strebenden Städten, was unter dem Strich wohl mehr Verluste als Erträge mit sich brachte.
Die Staufer hinterließen jedenfalls einen Mythos, der nur mit jenen der Nibelungen und anderer germanischer Sagengestalten vergleichbar ist. Bereits im Mittelalter begann ihre Verklärung. Die Kyffhäuser-Legende um den Kaiser »Rotbart«, der dort angeblich auf seine Wiederkehr wartet, um das Reich wieder zu errichten, erfreut sich auch heute noch einer großen Bekanntheit. Der Staufer-Mythos wurde immer wieder politisch instrumentalisiert und auch missbraucht, wie zuletzt im Dritten Reich.
Es soll in dieser Arbeit neben den ereignisgeschichtlichen und biographischen Aspekten auch auf das hochmittelalterliche Umfeld, die sozialen und ökonomischen Verhältnisse und die Lebensumstände dieser Epoche eingegangen werden. Zudem sollen ebenso militärische Aspekte, wie die Kriegführung jener Zeit und ganz besonders jene der Staufer, beleuchtet werden. An Quellen und Literatur wurden für diese Arbeit sowohl ältere als auch einige kürzlich erschienene Werke herangezogen. Es soll dem Leser ein kompaktes und informatives Werk über die Dynastie, ihre wichtigsten Angehörigen, ihr Schicksal und ihre Zeit geboten werden.