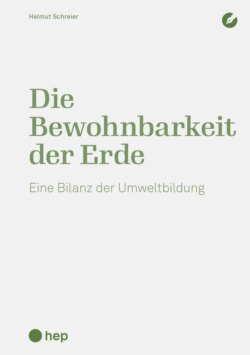Читать книгу Die Bewohnbarkeit der Erde (E-Book) - Helmut Schreier - Страница 5
Digitalisierung, «originale Begegnung» und die Grenzen der Schulbildung
ОглавлениеMeine Erinnerung ist die Aufnahme aus einer vergangenen Zeit. Schulbildung – die Idee des Lehrplans und der Zwecke von Unterricht und Schulleben – ist in einem Prozess andauernder Veränderung.
Das Bildungswesen hat im Lauf der Jahrzehnte Ziele von der Art der Verwandtschaft und Verbundenheit aller Lebewesen hier und da aufgegriffen und mal mehr, mal weniger planvoll verfolgt. Meine fünfzig Jahre alten Vorstellungen über eine Verpflichtung des Unterrichts für den Erhalt der Welt sind sozusagen noch in Kraft, auch wenn andere Forderungen – derzeit etwa «Inklusion», «Digitalisierung» – nach Aufmerksamkeit heischen und obwohl die Zerstörung der Erde unvermindert fortschreitet. Aber die Art und Weise meines Unterrichts von damals über die andauernde Entstehung des fruchtbaren Bodens in unseren gemässigten Zonen dürfte für neue Generationen von Lehrern im heutigen Schulbetrieb nur schwierig nachzuvollziehen sein. Vielleicht ist es gerade deshalb interessant, an die verlorengegangenen Möglichkeiten zu erinnern.
Mit einer Schulklasse einfach in den Wald zu gehen, also einen «Unterrichtsgang» zu unternehmen, wie es im Jargon seinerzeit hiess, und den Kindern damit die Möglichkeit zu einer «originalen Begegnung» zu schaffen, wie das Heinrich Roth, einer der seinerzeit massgeblichen Unterrichtsexperten, genannt hatte – das ist inzwischen durch zahlreiche organisatorische oder auf juristische Bedenken zurückgeführte bürokratische Vorgaben erschwert. Latente Widerstände, die gegen die spontane Umwidmung eines Klassenraumes zum Waldbodenlabor mit Bergen von Zeitungspapier und Extra-Entsorgungsproblemen aufzubrechen drohen, könnten den Frieden manches Schulbetriebs ernsthaft gefährden. Noch schwerer, so scheint mir, fallen subtilere, aber habituell gewordene Orientierungen des Unterrichtsgeschäfts ins Gewicht: Buch und «Arbeitsheft» organisieren den Unterrichtsverlauf so, dass sich keiner anschliessend die Hände zu waschen braucht. Sie werden ausschliesslich zum Aufblättern des Buches oder zum Ausfüllen der Linien mit einem Stift in dem das Buch ergänzenden Heft benötigt.
Es erleichtert es Lehrerinnen und Lehrern, Übersicht und Ordnung zu bewahren, wenn sie die Zahl der zu kontrollierenden Einflüsse möglichst gering halten.
Die Gründe, die diese Tendenz zur vorherrschenden haben werden lassen, sind nur zu vermuten. Vielleicht haben sich einzelne zu kontrollierende Einflussgrössen derart verändert, dass der Preis für jeden Spielraum, den man ihnen lässt, zu hoch geworden ist. Schüler seien schwieriger geworden, heisst es, und Eltern mischten sich allzu sehr ein. Vielleicht handelt es sich um eine aller Arbeit innewohnende Entwicklungstendenz, die – analog der Verwandlung vom Handwerk zur Industriearbeit – auf eine Art Leistungssteigerung durch Standardisierung hinausläuft. Vielleicht steckt auch eine dem Schulwesen eigene Wertschätzung abstrakter Muster dahinter, die nicht nur die Fähigkeit zum abstrakten Denken als Begründung für die Verteilung der Schüler auf verschiedene Schulformen (unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansehens) erachtet, sondern allgemein das Geschick des Mundes im Umgang mit Wörtern über das Geschick der Hände im Umgang mit Dingen setzt. Ich jedenfalls glaube mich zu erinnern, dass die Wort- und Bildfixierung, die ich derzeit beobachte, vor fünfzig Jahren viel weniger ausgeprägt war. Möglicherweise kann die Orientierung an Buch und Heft als Vorstufe einer kommenden Digitalisierung des Unterrichts verstanden werden, bei der Lichtsignale auf Bildschirmen alle anderen greifbaren Gegenstände aus dem Unterricht ersetzen, aber gleichzeitig eine ganze Welt von Daten, Diagrammen und allen denkbaren Informationen herbeiprojizieren werden.
Möglicherweise eröffnet der digitalisierte Unterricht neue Lernwege und neue Chancen für den Gewinn von Einsichten, die ihren Teil dazu beitragen können, das Unheil der Zerstörung abzuwenden. Die Methoden der Schule spiegeln bis zu einem Grade stets die innere Verfassung der Gesellschaft. Es wäre interessant, den alten Weg von der Erfahrung der Dinge im «händischen» Umgang hin zur begrifflichen Vorstellung mit dem neuen Weg der Informationsverarbeitung im Hinblick auf die verschiedenen Lebenswelten miteinander zu vergleichen, die sie jeweils ausdrücken: Welche gesellschaftlichen Erwartungen, welche Bildungsideen erscheinen als jeweils massgebliche?
Ganz unabhängig von den jeweiligen Vorstellungshorizonten schreitet die Zerstörung der Biosphäre und die Degradation (Qualitätsabbau des Bodens und der Wälder) und Toxifikation (Vergiftung von Organismen oder Substraten wie Luft oder Wasser) weiter fort. Anscheinend, jedenfalls bisher, unaufhaltsam. Die notwendige Veränderung der Produktions- und Verbrauchsmuster setzt einen Sinneswandel voraus, den das Bildungswesen nicht allein bewirken kann, solange «Bildung» mit «Schule» gleichgesetzt wird. Das Problem ist viel zu gross für den Schulunterricht, diese Vermittlungsinstanz von Kompetenzen, die immer schon von politischer Seite definiert worden sind. Und in der Tat wurden die wesentlichen gewissermassen bildungsträchtigen Momente, bei denen eine breite Öffentlichkeit im Lauf der vergangenen sechzig Jahre mit dem Problem der Erdzerstörung und der Notwendigkeit einer Änderung konfrontiert wurde, von allgegenwärtigen Medien in den öffentlichen Diskurs getragen, was dann in einigen Fällen tatsächlich zu weitreichenden Änderungen im politischen und rechtlichen Rahmen führte und auch den Schulunterricht – etwa in Gestalt eines Lernangebots namens «Bildung für nachhaltige Entwicklung» – erreicht hat.
Vielleicht ist es im Fall der drohenden Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlagen deshalb eher angebracht, an so etwas wie «Volksbildung» zu denken, sofern diese nicht als eine nationale Angelegenheit gilt, sondern als nationenübergreifende, wahrhaft globale und menschheitsbildende Angelegenheit. Der Schule käme dabei weniger die Rolle des Vorreiters zu als die eines «Backstoppers», das heisst einer Instanz, die sicherstellt, dass einmal gewonnene Einsichten nicht wieder in Vergessenheit geraten.