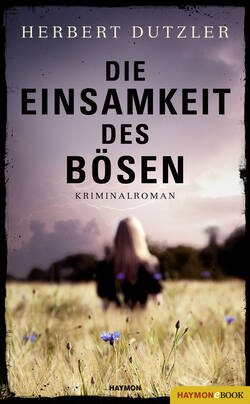Читать книгу Die Einsamkeit des Bösen - Herbert Dutzler - Страница 11
4
ОглавлениеAlexandra verstand sich auf Anhieb mit der Betreuerin für Großgewinner. Als sie die Nummer, die sie von Antons Handy abgelesen hatte, in ihr Handy eingab, meldete sich eine Frauenstimme. „Hallo, Heidegger hier. Mein Mann hat vorhin einen Anruf …“ Die Frau lachte. „Ja, ich weiß schon, wer Sie sind. Wir hatten noch nie einen so großen Gewinn, Ihr Name ist hier bei uns bekannt. Der Anruf vorhin kam von einem Kollegen. Allerdings hat Ihr Mann einen Kontakt mit uns abgelehnt.“ „Ich aber nicht!“, sagte Alexandra. Sie klang ein wenig zu heftig, fast beleidigt. Die Dame am anderen Ende zögerte kurz. Sie hatte sicherlich schnell gemerkt, dass es in ihrer Familie Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf den Gewinn gab. „Ja, wollen Sie sich dann mit mir treffen?“ Alexandra fand die Stimme sympathisch. „Ja, gerne. Am besten so bald wie möglich.“ „Gut. Mein Name ist Barbara, Barbara Ferny.“
Sie hatte mit der Beraterin schließlich einen Termin nach der Arbeit vereinbart. Alexandra musste eine Ausrede erfinden, denn Anton wollte sie keinesfalls von dem Treffen erzählen, zumindest jetzt noch nicht. Schon wieder gelogen, schon wieder Heimlichkeiten. All das nahm in erschreckendem Ausmaß zu, seit sie den Gewinn gemacht hatten.
„Hier sollten wir keinesfalls reden!“, warnte Frau Ferny, als sie an einem Cafétisch Platz nahmen. „Es gehört zu unseren Grundregeln, Gespräche nur an einem Ort zu führen, wo man nicht belauscht werden kann. Sie würden gar nicht glauben, wie viele Wände Ohren haben!“ Sie lächelte. Frau Ferny war etwa im gleichen Alter wie Alexandra, trug ihre dunklen Haare schulterlang und schob alle paar Sekunden ihre ebenfalls dunkle Brille ein Stück die Nase hinauf. Obwohl sie dazwischen nicht herunterrutschte.
Alexandra nickte. „Wie war die Fahrt?“, fragte sie, um ein unverfängliches Gesprächsthema zu wählen. „Ein wenig abenteuerlich. Ich habe vergessen, einen Platz zu reservieren, und der Zug war total voll. Und im selben Waggon eine Gesellschaft etwas angetrunkener, sehr lauter Männer. Anscheinend gibt es hier heute ein äußerst wichtiges Fußballspiel.“ „Das tut mir leid!“
Nachdem der Kaffee getrunken war, setzten sie sich auf eine Bank in einem kleinen Park am Nordufer des Flusses. Ein Brunnen plätscherte sanft, und zwei Bänke weiter lagen zwei Japanerinnen auf ihren Rucksäcken und dösten vor sich hin. Sonst war der Park leer.
„Erste Regel: Sagen Sie niemandem, wie viel Sie gewonnen haben. Geben Sie etwa zehn Prozent der Gewinnsumme zu. In Ihrem Fall ist natürlich auch das noch sehr viel.“ Alexandra nickte. „Mir fällt es allerdings schwer, die Heimlichtuerei. Vor allem mit den Kindern ist es ein Problem.“ Frau Ferny nickte. „Haben Sie Ihren Kindern von dem Gewinn erzählt?“ „Ja“, antwortete Alexandra. „Wie hätten wir es verheimlichen sollen? Ich habe ja schon gesagt, mir fällt es schwer, wichtige Ereignisse einfach so zu verschweigen, zu lügen.“ „Wir empfehlen normalerweise, Kinder, auch Halbwüchsige, nicht zu informieren. Sie können das nicht für sich behalten, in den meisten Fällen.“ „Aber wie sollte man so etwas auf Dauer geheim halten? Es hat ja Auswirkungen auf uns alle!“ Alexandra fuchtelte ratlos mit den Händen in der Luft herum. „Na ja, nun ist es ohnehin schon zu spät. Dennoch würde ich Ihnen raten, nicht sofort Ihren Lebensstil zu ändern. Vor allem im Interesse Ihrer Kinder.“ „Das haben wir auch so besprochen.“ Alexandra verschwieg, dass Anton in diesem Punkt nicht ganz die vereinbarte Linie einzuhalten bereit schien.
„Generell habe ich nicht ausschließlich gute Nachrichten für Sie. Sehr viele Großgewinner sind nach wenigen Jahren schlechter dran als vorher. Vor allem Männer investieren oft hohe Summen in Luxusgüter, viele geben ihren Beruf auf und versuchen, in große Geschäfte einzusteigen. Da sind allerdings auch 24 Millionen schnell weg. Bedenken Sie nur – Sie kaufen vielleicht ein Hotel, renovieren es gründlich und gehen dann pleite. Weg ist das Geld, und zwar das ganze. Vor solchen Experimenten möchte ich Sie warnen.“
Alexandra stützte den Kopf in ihre Hände. Ihre Schuhe waren vom Kies unter der Bank grau gesprenkelt. „Genau das befürchte ich bei meinem Mann. Es sind noch keine zwei Tage vergangen, und wir diskutieren schon über teure Grundstücke und Luxuslimousinen.“ Frau Ferny runzelte die Stirn. „Wenigstens versteht er von Grundstücken und Häusern was, er ist Architekt“, schränkte Alexandra ein.
„Sie müssen sich einfach klar darüber werden, dass sich Ihr Leben ab jetzt ändern wird. Sie haben es allerdings selbst in der Hand, in welche Richtung. Zum Beispiel müssen Sie sich auch eine Strategie zurechtlegen, wie Sie mit Verwandten und Freunden umgehen. Sie werden in Versuchung geraten, manchen mit Geld unter die Arme zu greifen. Tun Sie es nicht!“ Alexandra sah erstaunt auf. Frau Ferny erklärte: „Ganz egal, wem Sie wie viel Geld geben – einige werden sich immer ungerecht behandelt vorkommen, Gerüchte werden die Runde machen, und am Schluss haben Sie keine Freunde mehr! Beziehungsweise die falschen. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen sich an Sie erinnern werden, sobald die Neuigkeit die Runde macht. Und alle werden es bedauern, dass sie den Kontakt zu Ihnen haben abreißen lassen.“ Alexandra schüttelte den Kopf. „Und wenn ich niemandem etwas gebe, habe ich auch keine Freunde mehr!“
Frau Ferny schwieg und schien zu überlegen. „Eigentlich könnten wir uns duzen“, schlug sie dann vor. „Es ist zwar gegen unseren Kodex, aber … Ich heiße Barbara!“ „Alexandra.“ Barbara streckte ihren Kopf mit gespitztem Mund vor, und sie tauschten zwei Wangenküsse aus. „Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mehr Probleme als vorher“, klagte Alexandra. „Eigentlich will ich das Geld gar nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Gewinn abzulehnen? Oder nur einen Teil zu behalten?“ Barbara schüttelte den Kopf. „Zurückgeben geht nicht. Ihr könntet allenfalls eine Stiftung einrichten, für einen bestimmten Zweck. Aber dafür ist es jetzt noch zu früh. Vor allem müsst ihr euch da einig sein!“ Zwei dunkelhäutige Kinder kamen herangelaufen und stellten sich an den Brunnenrand. Der Junge griff nach dem Wasserspeier, der aus einem Fischkopf herausragte, und drückte seinen Zeigefinger hinein. Sofort spritzten scharfe Wasserstrahlen in alle Richtungen, vor allem auf seine Schwester, aber auch auf Alexandra und Barbara. „Verschwinde!“, drohte sie lachend, „Sonst …“ Kichernd verschwand das Duo, gefolgt von einer Frau mit Kopftuch und Kinderwagen.
„Ich habe gleich bei unserem Telefongespräch gespürt, dass zwischen dir und deinem Mann etwas nicht stimmt, dass ihr euch uneinig über den Umgang mit dem Geld seid.“ Alexandra nickte. „Ich glaube, er hat genau das vor, wovor du mich gewarnt hast.“ Gemeinsam starrten sie wortlos in die Wasserstrahlen des Brunnens, die in der Abendsonne zu leuchten begannen. „Ihr müsst euch ohnehin noch einmal offiziell mit mir treffen: Dein Mann muss mir, als Vertreterin der Lotterien, seinen Gewinnbeleg übergeben, bevor ihr Anspruch auf das Geld habt. Vielleicht ist ja bei dieser Gelegenheit auch ein Gespräch mit ihm möglich.“
Auf dem Heimweg ließ sich Alexandra Barbaras Ratschläge noch einmal durch den Kopf gehen. Es klang ja alles sehr vernünftig – aber doch auch ziemlich theoretisch. Wie sollte man praktisch vorgehen, ohne dass man den Tag mit Heimlichkeiten und Lügen zubrachte? Ohne dass man dauernd überlegen musste, mit wem wie zu reden war?
Einmal wollte sie es zumindest ausprobieren. Sich etwas Extravagantes leisten, etwas, wonach sie im Internet gesucht, was sie insgeheim in Auslagen bewundert hatte. Schöne Schuhe waren eine Schwäche von ihr, aber keine, die sie bisher ausgelebt hatte. Am Ende kam sie doch immer wieder mit fahrradtauglichen Tretern nach Hause, in denen man zur Not auch ein paar Kilometer Gehsteig mit Anstand hinter sich bringen konnte. Vorsichtig schlich sie am Schaufenster vorbei, niemand sollte merken, dass sie die ausgestellten Schuhe genauer begutachten, sogar welche kaufen wollte. Konnte sie mit Sportschuhen überhaupt in so ein Geschäft? Sie konnte! Die Verkäuferinnen würden froh sein, Schuhe um ein paar Hundert Euro loszuwerden.
Tatsächlich allerdings maß die Verkäuferin Alexandra mit argwöhnischen Blicken, als sie das Geschäft betrat. Sie kam sich gemustert vor, von oben bis unten. Die Verkäuferin trug ein blaues Kostüm mit einem sehr kurzen Rock, engelsgleiche blonde Locken und, natürlich, ein paar von diesen sündhaft teuren Pumps. Die sind wahrscheinlich ohnehin nur geliehen, dachte Alexandra, schließlich ist sie nur eine kleine Verkäuferin und verdient weniger als ich selbst. Entschlossen zeigte sie auf die strassbesetzten graubraunen Pumps, die sie im Schaufenster gesehen hatte. Salvatore Ferragamo. Die Verkäuferin zog die Augenbrauen hoch. „Denken Sie …“ Alexandra holte tief Luft. Mit solchen arroganten Ziegen musste man Klartext reden. „Was ich denke, überlassen Sie lieber mir. Größe 38.“ Sie atmete tief aus, doch die Verkäuferin hatte die Botschaft verstanden und trippelte davon.
Wenig später zog sie den rechten Schuh aus dem Karton. Alexandra nahm den Schuhlöffel zu Hilfe, um in den Schuh hineinzugleiten. Es war tatsächlich ein ganz anderes Gefühl als in einem billigen Schuh. Trotz der Zierlichkeit des Schuhs schmiegte sich das Leder angenehm kühl an ihre Füße. „Den linken auch, bitte!“ Die Verkäuferin gehorchte wortlos. Ihr Rock war durch das Niederknien so weit hochgerutscht, dass Alexandra ihre Unterwäsche hätte sehen können, hätte sie Interesse daran gezeigt. Sie richtete sich auf. Die Verkäuferin würde sich wundern – vielleicht hatte sie geglaubt, einen Bauerntrampel vor sich zu haben, doch nicht umsonst hatte Alexandra während ihres Studiums zwar viel zu spät, aber dennoch mit Begeisterung jahrelang Ballett trainiert. Sie wusste sehr wohl, wie man auf High Heels eine gute Figur machte.
Und tatsächlich – als sie auf ihr Spiegelbild zuging, fühlte sie sich erhöht, nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinn. Sogar der Verkäuferin entschlüpfte angesichts ihres Gangs ein „Wow!“. Über einen großen Wortschatz schien sie nicht zu verfügen. Um sie ein wenig zu beschäftigen, gab sich Alexandra zickig. „Hinten rutsche ich raus. Eine halbe Nummer kleiner, bitte!“ Schließlich stand sie dann doch mit den ursprünglich probierten Schuhen vor der Tür des Ladens und war um 310 Euro ärmer.
War es ein gutes Gefühl? Ja, das war es. Sie würde Freude daran haben, diese Schuhe zu tragen. Immer wieder. Am Ende war es vielleicht doch keine so schlechte Idee, reich zu sein.