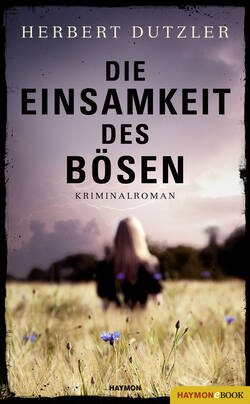Читать книгу Die Einsamkeit des Bösen - Herbert Dutzler - Страница 12
V
ОглавлениеDer Winter ist gekommen. Meine Brüste sind weiter gewachsen, ich werde bald einen BH brauchen. Die Haare zwischen den Schenkeln sind dichter geworden, aber noch immer habe ich meine Periode nicht bekommen. Mama spricht nicht mit mir darüber, alles, was sie für mich übrig hat, wenn sie mich im Bad nackt sieht, sind sorgenvolle Blicke und Seufzer.
Ich sperre jetzt ab, wenn ich bade oder dusche. Nicht nur wegen Papa, auch wegen Walter. Vor beiden habe ich Angst, beide werfen mir seltsame Blicke zu, die ich nicht zu deuten weiß.
Am liebsten bin ich in der Schule. Dort fühle ich mich sicher, obwohl manche mich wegen meiner billigen Kleider und Schuhe verspotten. Aber gegen die kann ich mich wehren, das habe ich durch Walter gelernt. Und ich bin schnell und groß – schneller als die meisten Buben in meiner Klasse und größer sowieso. Meine beste Waffe allerdings ist mein Mund. Ich weiß auf jede Gemeinheit eine Antwort und habe die Lacher auf meiner Seite. Nein, in der Schule bin ich sicher. Und es macht mir Freude, meine Hefte vollzuschreiben und das, was ich geschrieben habe, zu Hause durchzulesen. Lernen und üben muss ich nicht, es bleibt wie selbstverständlich in meinem Gedächtnis haften.
Ich weiß auch nicht, wie das möglich ist, dass die anderen dauernd alles vergessen. Manchen muss die Frau Professor Ellert fünfmal erklären, was man tun muss, um Zentimeter in Meter umzuwandeln. Das habe ich schon vor der Volksschule gekonnt, man braucht sich ja nur ein Maßband anzusehen, dann weiß man das. Aber in der Schule rede ich über solche Sachen nicht, auch nicht darüber, dass ich schon vor der ersten Klasse lesen konnte. Zuerst die großen Aufschriften über den Geschäften, bald danach alle Plakate und dann Bücher. Viele gibt es ja nicht bei uns zu Hause, aber es gibt eine Bücherei im Ort. In der ersten Klasse habe ich das ganze Regal mit den Büchern gelesen, die für Kinder bis zehn sind. Die Bibliothekarin hat geseufzt, als ich sie gefragt habe, was ich jetzt lesen soll.
Frau Professor Marinkovic, mein Klassenvorstand, weiß natürlich, dass bei uns zu Hause etwas nicht stimmt. Sie hat sicher auf Umwegen gehört, dass meine Brüder große Probleme in der Schule haben, beziehungsweise verursachen. Walter zettelt ständig Prügeleien an, Tobi dagegen ist ein Opfer der stärkeren Jungen. Ich lasse mir meist Zeit mit dem Nachhausegehen. Wenn dann zufällig die Frau Professor noch in der Klasse ist, während ich zusammenpacke, setzt sie sich manchmal neben mich und seufzt. Genau wie Mama. Der Unterschied ist nur, dass sie nicht nur seufzt, sondern auch mit mir redet und, vor allem, zuhört. Obwohl ich wenig zu sagen habe. Was sollte sie schon tun, wenn ich ihr erzähle, dass ich vor meinem Vater und meinem Bruder Angst habe?
„Wenn du über irgendwas reden willst, Alexandra, bei mir ist es in guten Händen. Ich behalte es bei mir, das solltest du wissen.“ Ich nicke. „Es gibt aber keine Probleme“, sage ich. Sie seufzt. „Das sagst du so. Aber es spricht sich ja herum, dass … dein Vater …“ Sie spricht den Satz nicht zu Ende. Ich zucke mit den Schultern. „Ich komme schon zurecht“, antworte ich und versuche, freundlich zu lächeln. Frau Professor Marinkovic seufzt. „Wenn du meinst … Aber versprich mir, wenn es jemals Probleme gibt, rede mit mir. Oder mit jemandem, dem du vertraust. Ich hab das Gefühl, du vertraust niemandem. Und weißt du, so hoch begabte Kinder wie du, die haben es in ihrer Umgebung oft nicht leicht. Nicht einmal, wenn …“ Sie lässt den Satz unvollendet.
Ich nicke, murmle einen Gruß und verdrücke mich aus dem Klassenzimmer. Warum soll ich ihr das Herz schwer machen mit meinen Sorgen? Glaubt sie, dass sie meinem Papa nur mit dem Finger drohen muss, und alles ist in Ordnung? Ganz im Gegenteil, wenn er mitkriegt, dass ich mit jemandem über die Familie gesprochen habe, dreht er durch. Und wer weiß, was dann passiert.
Wenn morgen meine Hausübung picobello in Ordnung ist, wird mir die Frau Professor schon verzeihen, dass ich so einsilbig war. Vertrauen. Ich weiß gar nicht recht, was das ist. Wie fühlt man sich, wenn man mit jemandem zusammen ist, dem man vertraut? Vielleicht hängt es mit Anspannung zusammen, und Angst. Zu Hause bin ich immer angespannt. Ist Papa in der Nähe? Was hat Walter vor? Will mir Mama wieder was vorseufzen oder herumjammern? Tobi, ja, dem vertraue ich. Aber er ist schwach, und gerade in seiner Nähe muss man besonders aufpassen, wenn Papa oder Walter dabei sind. Oft genug lassen sie ihren Zorn an ihm aus, und ich kann ihm nicht helfen.
Ich stehe in der Badewanne und lasse mir warmes Wasser über den Körper laufe, um die Seife abzuspülen. Jemand drückt die Türschnalle hinunter, rüttelt an der altersschwachen Holztür. „Was soll denn das, das Zusperren! Das ist mein Haus, da dulde ich so was nicht!“ Papa brüllt. Ich beeile mich, aber das Wasser ist jetzt zu heiß. Es dauert eine Zeit lang, bis ich die richtige Temperatur eingestellt habe. An der Tür höre ich etwas schaben. Was macht Papa da? Versucht er, die Tür irgendwie aufzukriegen? Ich verstehe nicht, warum er mich nackt sehen will, was hat er davon?
Plötzlich fängt Mama draußen zu schreien an. „Du Drecksau!“, schreit sie. „Was fällt dir ein! Du lässt mir das Madl in Ruhe! Sonst …“ Ich höre Mama keuchen, und es klingt so, als würde sie Papa schlagen. Etwas poltert gegen die Tür. Ich drehe das Wasser ab, greife nach einem Handtuch, schlinge es um meinen Körper. „Was glaubst denn!“, schreit Papa zurück. „Einsperren gibt’s nicht! Das wär ja noch schöner!“ Mama heult und schimpft weiter, doch beider Stimmen entfernen sich. Der Streit ist jedoch noch nicht zu Ende, eine Tür schlägt zu, und ich höre ihre Stimmen gedämpft. Plötzlich schreit Mama auf, und dann ist alles still.
Ich trockne mich hastig ab, ziehe meine Unterwäsche über die noch feuchte Haut, darüber Jeans und Pullover, und haste in die Küche. Mama steht an der Abwasch und tut so, als ob nichts wäre. Sie wäscht Kartoffeln. Doch als ich näher komme, höre ich, dass sie leise vor sich hin wimmert. Die Haare hängen ihr ins Gesicht. „Geh!“, herrscht sie mich an. „Geh! Bist eh schuld an allem!“ Ich glaube, Mama ist verrückt geworden. An was soll ich denn schuld sein? Dass Papa durchs Schlüsselloch schaut, weil er mich nackt sehen will? „Soll ich dir helfen, beim Kochen?“, frage ich trotzdem. „Geh!“, schreit sie noch einmal, und ich gehe.
Gefühle darf ich mir in diesem Haus nicht mehr erlauben, sonst gehe ich verloren, denke ich. Ich öffne meine Schultasche und hole mein Geografiebuch heraus. Über Wüsten und Polargebiete lese ich da, Oasen und tropische Regenwälder. Wir lernen gerade von den Klimazonen der Erde. Und ich stelle mir das alles ganz genau vor: wie ich mit einem Hundeschlitten durch die Weite des grönländischen Inlandeises ziehe, immer auf den Nordpol zu. Ich kann mich auf die Hunde verlassen, niemand sonst ist in der Nähe. Niemand, mit dem man Streit anfangen könnte. Die Hunde lecken mir dankbar die Hände, wenn ich ihnen gefrorene Fleischbrocken hinwerfe, und bei Nacht kuschle ich mich zwischen ihre warmen Flanken. Dunkel wird es nicht, denn es ist Sommer, die tief stehende Sonne wirft glutrote Strahlen über uns. Und ich schlafe zwischen meinen Hunden ein.
Oder ich ziehe mit einer Machete durch den Regenwald. Angst muss ich nicht haben, denn auch die gefährlichen Tiere sind berechenbar: Sie greifen mich nur an, wenn sie sich selbst oder ihr Territorium verteidigen wollen. Ich baue mir nahe einer Lichtung ein Baumhaus, wie Robinson Crusoe. Ich habe das Buch vier- oder fünfmal gelesen. Robinson hatte auch nur sich selbst, zumindest bis Freitag zu ihm kam. An dieser Stelle höre ich immer zu lesen auf, mich interessiert nur der Teil, in dem Robinson ganz allein ist. Da ist niemand, vor dem er Angst haben muss. Er braucht auch niemandem zu vertrauen außer sich selbst. So möchte ich auch sein. Am liebsten wäre ich ganz allein. Tobi könnte ich mit mir nehmen, er braucht jemanden, der für ihn da ist. Dann wird er ganz ruhig werden, die bösen Träume werden verschwinden, und er wird nicht mehr ins Bett machen. Und mir vertrauen.
Am allerliebsten aber würde ich nach Amerika fahren und bei den Indianern leben. In einem Tipi oder einem Pueblo. Die Indianer leben mit der Natur, nehmen sich nur, was sie zum Überleben brauchen, und geben ihr alles zurück, was sie braucht. Harmonie nennt man das. Das ist etwas, das ich mir auch wünsche, sehnlich. Ich habe einen Kalender unter dem Bett, mit Bildern von Canyons und Felslandschaften, alles ist in orangerotes Licht getaucht. Auf zwei Bildern sieht man Indianer, die ganz ruhig, gelassen in die Ferne blicken. Sie sehen nicht aus wie die Indianer aus den Westernfilmen, die Frau trägt ein weißes T-Shirt, Jeans und Silberschmuck in den Ohren. Der Mann ist dick, hat ein rundes Gesicht und lächelt sanft. Sie haben keine Angst. Ich bin mir sicher, dort finde auch ich die Stille, die Ruhe, nach der ich mich so sehne. Hier bestimmt nicht, je weiter weg, desto besser.
Aber ich begreife, dass mir meine Fantasien nicht helfen. Ich werde nicht nach Amerika kommen, wenn ich nicht selber etwas dafür tue. Deshalb werde ich jetzt den Spieß umdrehen. Anstatt mich von Papa beobachten zu lassen, werde ich ihn beobachten. Seine Schwachstellen kenne ich ja, immerhin ist er die halbe Zeit betrunken. Und eine Landwirtschaft, das ist ein gefährlicher Arbeitsplatz, da passieren viele Unfälle.