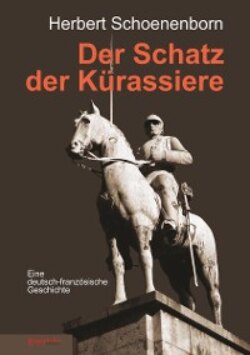Читать книгу Der Schatz der Kürassiere - Herbert Schoenenborn - Страница 10
Kapitel 1
ОглавлениеMetz, Lothringen, 21. August 1870
Die Glocken der nahen Kathedrale hatten gerade ihr Mittagsläuten beendet, als vier Männer vor dem Haus No. 12 in der Rue des Jardins stehen blieben und die Hausglocke läuteten. Zwei von ihnen trugen die Uniform der französischen Garde, die beiden anderen Zivil.
Haus No. 12 war ein herrschaftliches Stadthaus vom Anfang des 19. Jahrhunderts, das eher in einen Villenvorort als in die Rue des Jardins gepasst hätte. Da es gut drei Meter zurückversetzt war, hatte man das Gefühl, dass sich seine gepflegte hellbeige Fassade nicht so recht in die graue Front der übrigen Häuser einfügen wollte. Das Gebäude war nicht nur erheblich breiter, sondern mit seinen drei Stockwerken auch eine Etage höher als die Nachbarhäuser. Eine vierstufige steinerne Treppe führte zu einer massiven breiten eichenen Eingangstür empor. Ein ausladendes Vordach, das von zwei klassizistischen Säulen gestützt wurde, überdachte Eingangstüre und Treppe und reichte fast bis zum Bürgersteig. Stabile schmiedeeiserne Ziergitter sicherten die Parterrefenster. Die rundbogige Hauseinfahrt konnte nicht mehr genutzt werden, denn sie war zur Straße hin mit einem, im Boden und in den Seitewänden fest verankerten, massiven Eisengitter dauerhaft verschlossen und glich entfernt einem mit einem Fallgitter verschlossenen Stadt- oder Burgtor. Am Ende der Einfahrt verwehrte eine graue Eisentüre den Blick in den Innenhof. Tor, Türe und Fenster waren mit dunkelgrauen, kunstvoll behauenen Steinelementen eingefasst und verliehen dem Haus ein vornehmes Aussehen.
Die Männer hatten sich seitlich der Eingangstüre gestellt, so dass sie durch den Türspion nicht gesehen werden konnten. Die List gelang, denn nach kurzer Zeit wurde ein schwerer Riegel auf die Seite geschoben und die Türe einen Spalt weit geöffnet. Darauf hatten die Männer spekuliert. Mit Wucht stießen die Soldaten die Haustüre weit auf und drängten den Livrierten, der nachsehen wollte, wer die Unverfrorenheit besaß die Mittagsruhe zu stören, ins Innere des Hauses. Die beiden Zivilisten folgten den Soldaten auf dem Fuße. Die Gardisten verriegelten nun von innen die Tür und postierten sich rechts und links vom Hauseingang. Das alles ging sehr schnell. Keiner der wenigen Passanten auf der Straße hatte etwas bemerkt. Nur von einem Fenster gegenüber wurde der Vorfall zufällig beobachtet. Als die vier Männer im Haus verschwunden waren, zog sich der Beobachter zurück. Er beschloss, nichts gesehen zu haben, denn in diesen unruhigen Zeiten kümmerte man sich besser nur um sich selbst, insbesondere dann, wenn Militär mit im Spiel war.
Es dauerte einige Zeit, bis sich der Überrumpelte von seinem Schrecken erholt hatte. Wut machte sich in ihm breit. Er näherte sich den beiden Männern in Zivil bis auf eine Armlänge, so dass die Uniformierten auf dem Sprung waren einzugreifen. Zum Glück hatte sich der Hausbewohner schnell wieder im Griff. Er trat einen Schritt zurück, so dass sich die Soldaten wieder entspannen konnten.
„Messieurs, was wollen Sie?“, fragte er kalt, wütend über sich selbst, weil er auf einen uralten Trick hereingefallen war und damit den ungebetenen Besuchern ihr Eindringen ins Haus so leicht gemacht hatte. Unbeeindruckt von der Gemütslage seines Gegenübers erwiderte der größere der beiden Zivilisten beschwichtigend:
„Entschuldigen Sie unser Eindringen, aber wir müssen dringend mit Monsieur Fréchencourt sprechen.“
„Monsieur Fréchencourt hat sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und möchte nicht gestört werden“, entgegnete der Angesprochene abweisend.
„Schon gut Philippe“, sagte der Mann, der vom Treppenabsatz der ersten Etage aus das Geschehen unbemerkt beobachtet hatte und nun gemächlich die Stufen herunterkam. Die unten stehenden konnten zunächst nur seine Silhouette erkennen, die sich gegen das einfallende Licht des oberen Flurfensters abhob.
„Monsieur Gerard Fréchencourt?“, fragte der kleinere der beiden Männer höflich.
„Non Monsieur, ich bin Richard Fréchencourt. Mein Vater Gerard ist vor zwei Wochen verstorben, Sie müssen daher mit mir Vorlieb nehmen. Was kann ich für Sie tun, Messieurs?“, fragte er vorsichtig. Erst als er in das gedämpfte Sonnenlicht der Eingangshalle trat, wurde den Besuchern klar, dass der Mann schon altersmäßig nicht Gerard Fréchencourt sein konnte, denn derjenige, der ihnen gegenüberstand, war erst Anfang dreißig. Er trug den blauen Rock der französischen Freikorps, der Franctireurs. Den Abzeichen nach stand er im Range eines Captaine. Richard Fréchencourt war mittelgroß und athletisch. Sein dunkles Haar war kurz geschnitten und sein schmales Gesicht mit der geraden Nase und dem energischen Mund wurde von Backen- und Kinnbart umschlossen. Unter dichten Brauen musterten dunkle Augen abschätzend die Besucher. Was waren das für Männer, die ungebeten in sein Haus gestürmt waren und unbedingt seinen Vater sprechen wollten?
Bei einer flüchtigen Begegnung, so vermutete Fréchencourt, würde man die beiden später sicherlich nur vage beschreiben können. Vielleicht könnte man sich noch an den Größenunterschied und eventuell noch an ihr gepflegtes Äußeres erinnern. Die Kleidung der beiden ungebetenen Gäste entsprach dem Zeitgeschmack und war eher unauffällig, denn die Sakkos und eng geschnittenen Hosen in gedeckten Farben hinterließen keinen bleibenden Eindruck, und das schien Absicht zu sein.
Wenn man aber, wie Richard Fréchencourt, genauer hinsah, hatten seine Besucher einige Auffälligkeiten zu bieten. Fréchencourt entgingen weder die breiten Schultern noch die kräftigen Hände der beiden. Dem Sitz ihrer Kleidung nach waren sie bewaffnet. Ihr Alter schätzte er auf Anfang bis Mitte vierzig. Das waren auch schon die Gemeinsamkeiten. Da sie inzwischen ihre Kopfbedeckungen abgesetzt hatten, traten die Unterschiede deutlich zu Tage.
Der kleinere Mann hatte bereits eine Glatze, die von einem Haarkranz umrahmt wurde. Als wolle er das Fehlen seiner Kopfhaare ausgleichen, verdeckte unterhalb seiner knubbeligen Nase ein sorgfältig gezwirbelter Schnurrbart die Oberlippe. Aus seinem rundlichen Gesicht blickten ihn ein Paar kluge Augen forschend an.
Dichtes grau meliertes glattes, nach hinten gekämmtes Haar bedeckte hingegen den kantigen Schädel seines Begleiters. Die bereits vollständig ergrauten Augbrauen trafen sich fast über der ein wenig zu lang geratenen Nase. Ein Backenbart überwucherte die leicht hervorstehenden Wangenknochen und reichte ihm fast bis zu den Mundwinkeln. Er wirkte auf den Hausherrn leicht grimmig, aber nicht unsympathisch.
Nach seiner Einschätzung hatte er von ihnen nichts zu befürchten. Sichtbar entspannt ging Fréchencourt auf die beiden Besucher zu und verbeugte sich leicht:
„Bonjour Messieurs, willkommen in meinem Haus.“ Mit einem leicht spöttischen Unterton fügte er hinzu: „Es müssen wichtige Gründe vorliegen, dass Sie mich in diesen unruhigen Zeiten aufsuchen und dazu noch in Militärbegleitung.“ Der kleinere Besucher übernahm nun das Wort:
„Ja, in der Tat“, sagte er ernst. „Aber dürfen wir uns Ihnen zunächst einmal vorstellen, Messieurs? Mein Name ist Grau, Pierre Grau, und das ist mein Kollege Jean Muller. Wir sind Angehörige des Kriegsministeriums.“ Er überreichte dem Hausherrn eine Legitimation des Kriegsministers.
„Bevor wir Sie über den Grund unseres Besuchs in Kenntnis setzen, gibt es einen Raum, in dem wir uns ungestört unterhalten können?“
„Ja selbstverständlich, folgen Sie mir bitte in die Bibliothek, Messieurs“, antwortete der Hausherr.
„Philippe, bringen Sie uns bitte Tee, Baguette und Käse und versorgen Sie auch beiden Messieurs vom Gardecorps.“
Als sich die beiden Soldaten unsicher ansahen, nickte ihnen Grau kurz zu.
„Die Vorsichtsmaßnahmen sind nicht notwendig“, sagte er und bedeutete ihnen, ihre Posten neben der Eingangstür zu verlassen. Fréchencourt zeigte auf eine Sitzgruppe, die aus drei gepolsterten Stühlen und einem kleinen runden Eichentisch bestand.
„Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne dort hinsetzen“, sagte er. Dankbar folgten die Gardisten der Aufforderung des Hausherrn. Sie setzten ihre Tschakos* ab und lehnten ihre bajonettbewehrten Chassepot-Gewehre* vorsichtig an die holzgetäfelte Wand. Dann ließen sie sich auf die Stühle fallen.
Die beiden Soldaten gehörten zur Besatzung von Fort Plappeville im Westen der Stadt. Seit der Mobilmachung am 15. Juli war es mit dem bis dahin doch recht geruhsamen Soldatenleben zu Ende.
Die Besatzung der Festung stand seitdem in andauernder Kampfbereitschaft, mit all ihren unangenehmen Begleiterscheinungen, wie Ausgangssperre, häufigen Alarmen und Appelle zu allen Tages- und Nachtzeiten und den alle vier Stunden stattfindenden Wachwechseln.
Seit dem Rückzug der Rheinarmee nach Metz, durften sie sich noch nicht einmal mehr außerhalb des Forts bewegen. Obwohl sie mit einem festen Dach über dem Kopf in diesen Kriegstagen zu den previligierten Armeeangehörigen gehörten, empfanden sie ihre Situation trotzdem alles andere als angenehm. Um für ein paar Stunden dem kräftezehrenden Dienstrhythmus und der Enge des Forts zu entfliehen, hatten sie sich freiwillig zur Begleitung von Grau und Muller gemeldet.
Richard Fréchencourt öffnete eine schwere Eichentür und bat die beiden Besucher einzutreten. Interessiert sahen Grau und Muller sich um. Die Größe des Raumes war imponierend. Er maß ungefähr zehn mal fünfzehn Meter. Die Stirnseite beherrschte ein Buntglasfenster mit militärischen Motiven aus der Zeit Napoleon Bonapartes, das die Bibliothek in gedämpfte Farben tauchte. In der Mitte der linken Längswand befand sich ein großer marmorner Kamin, der an kalten Tagen spielend in der Lage sein musste, die gesamte Bibliothek mit wohliger Wärme zu versorgen. An der rückwärtigen Wand, direkt neben der Türe, glorifizierte ein, vom Parkettfußboden bis zur eichenholzener Fassettendecke reichendes Bild den siegreichen Napoleon Bonaparte, offenbar nach der Schlacht von Austerlitz.
Die freien Wandflächen bedeckten Regale, die vom Boden bis zur Decke lückenlos mit Büchern gefüllt waren. Auch der obligatorische Globus in der Mitte des Raumes fehlte nicht. Komplettiert wurde die Einrichtung durch eine gemütliche Leseecke vor dem Fenster, bestehend aus vier mit dunkelrotem Samt bespannten Sesseln und einem quadratischen Tisch mit einer gekachelten Oberfläche. Fréchencourt bat die Besucher dort Platz zu nehmen. Nachdem sich auch der Hausherr gesetzt hatte, ergriff Muller sofort das Wort.
„Zunächst einmal unser Beileid zum Tode Ihres Vaters. Wir sind von seinem Tod etwas überrascht, denn wir hatten fest damit gerechnet, ihn hier in Metz anzutreffen.“ Fréchencourt entgegnete seufzend:
„Auch für mich und meine Familie kam sein Tod unvorhergesehen, denn ich wusste bis vor zwei Tagen nichts von seinen Herzbeschwerden, die erst in den letzten beiden Monaten vor seinem Tod aufgetreten sein mussten. Bei der Feier anlässlich seines sechzigsten Geburtstags im Oktober vergangenen Jahres sagte mein Vater in seiner Tischrede noch, er habe eine Menge Ideen, die er unbedingt verwirklichen wolle. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er deshalb einen Ort brauche, an den er sich zurückziehen könne, um ungestört arbeiten zu können.
Um zu unterstreichen, wie ernst er es damit meinte, ersteigerte mein Vater im März aus der Erbmasse eines Kunsthändlers dieses Stadthaus hier, einschließlich des kompletten Inventars.“ Der Hausbesitzer machte eine ausladende Handbewegung. „Dazu gehören auch die gesamten Bücher dieser Bibliothek, bei denen es sich hauptsächlich um wertvolle Kunstbände handelt. Ich habe leider bis heute noch keines davon durchblättern, geschweige denn lesen können.“ Fréchencourt lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und nahm den Faden wieder auf.
„Alors, mein Vater hielt sich seit Anfang April fast ausschließlich hier in Metz auf. Er reiste ein-, zweimal im Monat für jeweils zwei, drei Tage nach Paris, um nach dem Rechten zu sehen, wie er scherzhaft zu sagen pflegte. Zuhause in Paris schien er mir immer sehr abwesend zu sein und konnte es offenbar kaum erwarten, wieder den Zug nach Metz zu besteigen. Meine Mutter und ich vermuteten daher, dass er sich mit etwas außerordentlich Bedeutsamen befasste.“
„Oui, Ihre Vermutung war absolut richtig, Monsieur Fréchencourt. Ihr Vater hat an Entwürfen für ein neues Geschütz gearbeitet, und deshalb sind wir hier“, entgegnete Muller, und Grau fuhr fort:
„Er beabsichtigte seine Entwürfe am 25. August, also heute in vier Tagen, im Kriegesministerium dem Militär vorzustellen. Hier ist ein entsprechender Brief Ihres Vaters vom 5. August.“ Er übergab Fréchencourt den Brief. Nachdem der Hausherr ihn gelesen hatte, sah er seine Besucher nachdenklich an.
„Messieurs, wenn es um militärische Dinge ging, war mein Vater sehr zugeknöpft. Selbst mich hat er nur selten eingeweiht. Er hielt es für besser, dass niemand wusste, woran er gerade arbeitete, offenbar auch um die Familie zu schützen.“
Das Gespräch wurde unterbrochen, als sich die Tür öffnete und Philippe einen Servierwagen mit dampfenden Tee und einem silbernen Tablett mit verschiedenen Käsesorten in die Bibliothek rollte.
„Ich hatte eben vergessen zu erwähnen, dass Weißbrot bereits in der Frühe nicht mehr zu bekommen war. Da Mehl rationiert ist, gehen den Bäckern so langsam die Vorräte zur Neige“, grantelte Philippe.
„Schade, da kann man nichts machen.“ Fréchencourt sah Philippe an. „Mon ami, seien Sie doch nicht so mürrisch wegen der Geschichte von vorhin“, sagte er beschwichtigend, und an seine Besucher gewandt fügte er erklärend hinzu: „Nun ja, ich kann seinen Zorn sehr gut verstehen, vor allen Dingen, weil Sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft haben, Messieurs. Auch ich bin der Meinung, dass es auch anders gegangen wäre.“
„Sie haben vollkommen Recht, Monsieur Fréchencourt“, gab Grau zerknirscht zu. „Verzeihen Sie uns!“
„Schon gut, vergessen wir´s. Alors, Philippe lässt sich gewöhnlich nicht so leicht überrumpeln, denn er ist nicht wie es den Anschein hat, einer meiner Dienstboten, sondern eigentlich mein Sekretär und Leibwächter. Einige Aufgaben des Dienstpersonals hat er nur übernommen, weil ich ihn darum gebeten habe. Denn die Haushälterin und den Hausdiener meines Vaters habe ich vor Tagen bei einer mir bekannten Familie untergebracht. Ich beabsichtige dieses Haus wieder zu verkaufen. Unsere Familie benötigt es nun nicht mehr, aber ich will zunächst einmal den Ausgang des Krieges abwarten.“
Fréchencourt beobachtete amüsiert seinen Sekretär, wie dieser professionell Tee in die Tassen füllte.
„Wie Sie sehen, Messieurs, hätte Philippe sicherlich auch einen guten Butler abgegeben.“ Philippe warf Fréchencourt einen bösen Blick zu, setzte die Teekanne hart auf den Rechaud und verließ erhobenen Hauptes die Bibliothek. Fréchencourt empfand, dass die Tür ein klein wenig lauter ins Schloss fiel als üblich. Muller grinste und setzte das Gespräch fort:
„Monsieur Fréchencourt, Sie können sich sicher vorstellen, dass man sich in unserem Ministerium wegen Ihres Vaters große Sorgen machte.“
„Sie meinen wegen der Pläne“, warf Fréchencourt mit hochgezogenen Augbrauen ein.
„Das auch, aber in erster Linie wegen Ihres Vaters, denn die Pläne alleine hätten uns ohne seine Erläuterungen sicher nicht viel genützt“, gab Muller zu.
„Alors, aufgrund der prekären Lage rund um Metz mussten wir befürchten, dass Ihr Vater mitsamt den Plänen bei seiner Reise nach Paris von der Gegenseite abgefangen werden könnte, eine Katastrophe. Wir beide hatten daher vom Kriegsminister den Auftrag erhalten, Ihren Vater unter Militärschutz zu stellen, ihn hier abzuholen und nach Paris zu geleiten. Allerdings hatten wir uns die Sache etwas einfacher vorgestellt“, seufzte Muller und schob sich ein Stück Käse in den Mund. Nach einiger Zeit berichtete er weiter:
„Obwohl unser Ministerium sowohl über alle Bewegungen der eigenen und gegnerischen Truppen, als auch über den Verlauf der Gefechte immer auf dem neusten Stand war, hatten wir gehofft, mit etwas Glück unseren Auftrag ohne Probleme erfüllen zu können. Pierre und ich konnten nicht damit rechnen, dass sich die Lage unserer Truppen innerhalb so kurzer Zeit dermaßen verschlechtern würde.
So benötigten wir leider, entgegen unserer Erwartungen, von Paris nach hier vier ganze Tage, da wir größere Umwege in Kauf nehmen mussten. Wir waren bereits am 15. frühmorgens aufgebrochen. Weil wir wussten, dass die Eisenbahnstrecke Paris – Metz direkt hinter Nancy durch deutsche Verbände unterbrochen war, blieb uns nichts anderes übrig, als auf eine andere Eisenbahnroute auszuweichen. Wir sind daher mit dem Zug über Reims bis Mézières gefahren. Von Mézières aus gibt es leider keine direkte Bahnverbindung nach Metz. Daher waren wir gezwungen, uns einem Nachschubtransport anzuschließen. Es gab nur noch eine freie Route von Norden her, denn offen war nur noch der Weg über Sedan und weiter nach Thionville und schließlich entlang der Mosel. Denn auch im Westen der Stadt standen bereits starke gegnerische Verbände. Seit gestern ist auch dieser letzte Weg versperrt, und damit sind alle Nachschubwege unterbrochen. Das ist die aktuelle Lage. Sieht verdammt übel aus.“ Dennoch schien Muller nicht sehr beunruhigt.
„Wie sind Sie überhaupt in die Geschäfte Ihres Vaters eingebunden?“, wechselte Grau das Thema.
„Diese Frage kann ich Ihnen gerne beantworten“, erwiderte Fréchencourt.
„Ich bin, wie mein Vater, Ingenieur für Fahrzeug- und Waffentechnik. Wie Sie sicherlich wissen, besitzt unsere Familie im Pariser Quartier Saint-Georges eine Fabrik, die neben Kutschen, auch Fahrzeuge für die Armee herstellt, darunter auch Protzen* und Lafetten* für Kanonen.
Vor gut zwei Jahren hatte mir mein Vater die kaufmännische Leitung der Fabrik übertragen. Er selbst kümmerte sich von nun an ausschließlich um die Fabrikation, wobei er fortwährend an technischen Verbesserungen unserer Fahrzeuge tüftelte. Zudem hatte er nun endlich die Zeit zur Verfügung, die er zur Verwirklichung seiner Ideen benötigte. Hierzu zog er sich hier nach Metz zurück. Er liebte diese Stadt über alles, denn hier war er geboren und aufgewachsen, Paris war ihm zu groß, zu hektisch. Hier glaubte er in Ruhe arbeiten zu können.“ Fréchencourt goss sich Tee nach und schloss an:
„Wenn er sich in Metz aufhielt, übernahm ich auch die Produktionsleitung.“
„Dann werden Sie ja jetzt die Geschäfte ihres Vaters fortführen“, stellte Grau fest.
„Oui, ich glaube schon. Es ist ja sonst kein Familienmitglied da, das dazu in der Lage wäre. Obwohl das Testament noch nicht eröffnet ist, gehe ich davon aus, dass mein Vater mir die Fabrik übertragen hat. Meine Mutter hat sich nie um die Geschäfte gekümmert, und meine beiden Schwestern haben ebenfalls kein Interesse gezeigt. Die ältere ist in Carcassonne mit einem Arzt verheiratet, und meine jüngere Schwester besitzt am Pariser Seineufer ein Atelier und widmet sich hingebungsvoll der Malerei.“
„Wer leitet denn die Fabrik momentan?“, fragte Grau interessiert.
„Ich habe einen hervorragenden Prokuristen, selbst Ingenieur und äußerst loyal. Den hat mein Vater vor ungefähr zwanzig Jahren eingestellt. Ach ja, ich möchte noch erwähnen, dass ich noch einen Halbbruder habe. Ich glaube aber nicht, dass Sie weitere Einzelheiten interessieren“, Fréchencourt nahm einen Schluck Tee und ein Stück Käse.
„Doch, Ihre Familiengeschichte interessiert uns schon“, sagte Muller.
„Na gut, wenn Sie meinen. Meine Mutter war in erster Ehe mit dem Strasbourger Kaufmann Gabriel-Julien Ouvrard verheiratet, der bei einem Schiffszusammenstoß auf dem Rhein irgendwo zwischen Bonn und Köln ums Leben kam. Mit ihrem Sohn aus dieser Ehe, Louis-Antoine, bin ich zusammen groß geworden. Da meine Mutter Elsässerin ist, sind wir zweisprachig aufgewachsen. Antoine und ich sprechen daher fließend Deutsch. Antoine hat vor ungefähr acht Jahren das ‚Handelskontor Ouvrard’ übernommen, als auch sein Onkel Robert, der Bruder und Teilhaber seines leiblichen Vaters, verstarb.
Onkel Rob, wie wir Jungen ihn nannten, war unverheiratet und hatte selbst keine Kinder. Wir mochten ihn sehr, alleine schon deshalb, weil mein Bruder und ich ihn während der Schulferien auf diversen Schiffsreisen auf dem Rhein begleiten durften. Wir kamen daher als Kinder schon weit herum.“ Fréchencourt räusperte sich und nahm erneut einen Schluck Tee.
„Ich habe meinen Bruder auch später noch auf einigen Handelsreisen begleitet, die uns bis nach Holland führten. Während meines Ingenieurstudiums habe ich sogar hin und wieder im Kontor ausgeholfen. Dabei habe so ganz nebenbei das Verhandeln mit Geschäftspartnern gelernt. Diese Erfahrung nutze ich nun für mich selbst. Leider hatte ich in den letzten beiden Jahren keine Gelegenheit mehr mit meinem Bruder etwas gemeinsam zu unternehmen. Sie verstehen sicher, dass mein Verhältnis zu meinem drei Jahre älteren Halbbruder bis heute sehr eng geblieben ist.
Antoine und ich haben uns hin und wieder in Paris oder Strasbourg gesehen. Zuletzt trafen wir uns nach dem Tod unseres Vaters hier in Metz, um die Formalitäten für die Beisetzung zu erledigen. Das Begräbnis fand am 11. August, und wie es mein Vater verfügt hatte, in aller Stille statt. Nur Antoine und ich haben unseren Vater auf seinem letzten Weg begleiten können, denn wegen der Kriegslage wäre es unverantwortlich gewesen, die übrigen Familienmitglieder hierher anreisen zu lassen.“ Die Anspannung war während der Schilderung nach und nach aus Fréchencourts Gesicht gewichen. Nach einer kurzen Pause sagte er:
„Mein Bruder ist sofort nach der Beerdigung nach Strasbourg aufgebrochen. Er wollte über Nancy und Luneville von Süden her seine Heimatstadt erreichen, denn er hatte gehört, dass auch im Elsass die Lage unübersichtlich und gefährlich war. Noch ein paar Tage in Metz zu bleiben, erschien ihm zu riskant, denn er befürchtete, später die Stadt nicht mehr verlassen zu können – und leider sollte er Recht behalten. Das ist die ganze Geschichte, Messieurs.“
„Nicht ganz. Wie wir sehen, tragen Sie den Waffenrock der Franctireurs“, erwiderte Grau.
„Oui, Messieurs, das ist richtig. Ich hatte mich schon vor Jahren in Paris den Schützengesellschaften angeschlossen. Als das Dekret des Kaisers die Franctireurs zu den Waffen rief, konnte ich mich ja schließlich nicht drücken. Aufgrund meines Standes und der langen Zugehörigkeit zu den Freikorps bin ich zum Captaine* ernannt worden. Als ich hier ankam, habe ich das Haus kurzerhand zum Stützpunkt der Franctireurs erklärt. Von hier aus starten wir unsere Aktionen gegen die Deutschen.“
„Monsieur Fréchencourt, ein interessanter Lebenslauf“, erwiderte Muller. Vorsichtig fügte er hinzu:
„Um noch einmal auf Ihren Bruder zurückzukommen, ich befürchte, dass er nicht nach Strasbourg durchgekommen ist, denn nach unserer Kenntnis wird die Stadt schon seit dem 15. dieses Monats von deutschen Truppen belagert und unaufhörlich beschossen.“
„Dann hat mein Bruder dies bestimmt unterwegs erfahren und ist entweder zu seinem zweiten Wohnsitz Basel ausgewichen oder, was wahrscheinlicher ist, nach Paris zu unserer Mutter gereist“, vermutete Fréchencourt. Grau nahm den Faden wieder auf:
„Wir können es Ihnen nicht ersparen, uns nach Paris zu begleiten, Monsieur. Sie werden anstelle Ihres Vaters die Pläne unserem Militär erläutern müssen. Es setzt große Hoffnungen in die neue Kanone, denn die deutschen Stahlgeschütze verfügen mit mehr als vier Kilometern über die doppelte Reichweite als unsere veralteten Bronzekanonen. Das Stahlgeschütz nach den Plänen Ihres Vaters, würde die waffentechnische Wende bringen, denn seine Kanone soll wiederum den derzeitigen Geschützen der Deutschen erheblich in Reichweite und Feuerkraft überlegen sein. Wir werden es zwar aus Zeitgründen nicht mehr schaffen, die neuen Kanonen noch in diesem Krieg einzusetzen, aber erfahrungsgemäß ist ja nach dem Krieg vor dem Krieg“, fügte Muller ernst hinzu.
„Selbstverständlich werde ich Sie begleiten, Messieurs, aber ich glaube, es gibt da ein Problem.“
„Inwiefern, Monsieur Fréchencourt?“
„Wenn ich den Brief meines Vaters an Ihr Ministerium im Zusammenhang mit seiner mir hinterlassenen Botschaft sehe, dürften sich die Konstruktionspläne entweder auf dem Weg nach Paris befinden oder bereits dort angekommen sein.“
„Merde, wie das?“, entfuhr es Grau.
„Wenn Sie den Brief gelesen haben, werden Sie zum gleichen Schluss kommen“, entgegnete Fréchencourt. Er erhob sich, ging zu der Bücherwand, griff unter ein Bücherbrett, zog dann ohne Anstrengung ein ungefähr zwei Meter breites Regalteil nach vorne und schob es anschließend geräuschlos seitlich links vor die Bücherwand. Es kam nun ein in der Wand eingelassener mannshoher Tresor zum Vorschein. Muller war verblüfft.
„Eine solche Konstruktion habe ich bisher noch nicht gesehen, und die Größe des Tresors passt eher in eine Bank als in ein Privathaus.“
„Da haben Sie vollkommen Recht“, entgegnete der Hausherr. „Der Tresor reicht bis weit ins Nachbarzimmer und ist dort als Kachelofen getarnt. Wie bereits gesagt, war der Vorbesitzer Kunsthändler. Er brauchte offenbar einen so großen Tresor, um darin auch wertvolle voluminöse Kunstgegenstände aufzubewahren.“ Nun stellte Fréchencourt an einem Drehknopf eine Zahlenkombination ein, drehte ein Handrad und öffnete die schwere Stahltüre.
„Wie Sie sehen, ist der Tresor sogar begehbar. Ich hebe in ihm nur wenige private Dinge auf“, sagte Fréchencourt. Er entnahm einem Fach ein mehrseitiges Schreiben und reichte die ersten beiden Seiten seinen Besuchern.
„Mein Vater hatte es hier für mich deponiert, aber lesen Sie bitte selbst, Messieurs.“ Die beiden Besucher rückten zusammen und lasen gemeinsam, was Gerard Fréchencourt seinem Sohn mitgeteilt hatte:
Lieber Richard,
wenn Du diesen Brief in Händen hältst, ist etwas eingetroffen, was für Mutter, Antoine und Dich sicher überraschend kam, für mich aber absehbar war, mein Tod.
Wegen wiederkehrender Schmerzen in der Brust hatte ich Ende Juli Dr. Simon aufgesucht. Dieser sagte mir nach einer gründlichen Untersuchung, dass mein Herz sehr schwach sei, und ich nicht mehr viel Zeit habe, meine Dinge zu regeln. Meine Lebenserwartung liege zwischen wenigen Tagen und ein bis zwei Monaten. Ich hatte Dr. Simon an seine Schweigepflicht gebunden und ihn gebeten, seine Diagnose für sich zu behalten.
Nachdem ich den Schock überwunden hatte, musste ich mich beeilen, in Metz einige Sachen abzuholen, um sie noch nach Paris zu bringen. Leider werde ich es nicht mehr schaffen, ich habe weniger Zeit als ich gehofft habe. Es geht mir nicht gut, denn heute habe ich wieder Schmerzen in der Brust. Jetzt musst Du für mich die Sache in die Hand nehmen. Hinten im Tresor steht eine unserer Holzkisten. Darin befinden sich ein wunderschönes und vermutlich sehr kostbares Bild, zwei Ikonen und einige Schmuckstücke, welche ich hier in Metz für Mutter habe anfertigen lassen. Es ist mir überaus wichtig, dass die Kiste umgehend nach Paris gebracht wird.
Hier noch ein paar Bemerkungen zu dem Bild: Das Bild muss schon längere Zeit im Besitz des vorher hier ansässigen Kunsthändlers gewesen sein. Ich fand es erst vor kurzem durch Zufall. Es hing unscheinbar zwischen vielen anderen Bildern im Arbeitszimmer, so dass es mir vorher nicht aufgefallen war. Das Bild muss vor Jahren durch Feuchtigkeit etwas gelitten haben, denn der Rahmen ist leicht verzogen und auf der Rückseite befinden sich Reste von getrocknetem Schimmel. Wenn man genau hinschaut, sind an verschiedenen Stellen leichte Risse in der Farbschicht zu erkennen. Um weitere Beschädigungen zu verhindern habe ich mit viel Mühe auf der Rückseite einen Schutz angebracht, indem ich ein von der Größe her passendes, auf Holz gemaltes Tafelbild aus dem Salon in den Rahmen eingesetzt habe. Es stammt, entsprechend dem Vermerk auf seiner Rückseite, höchst wahrscheinlich aus dem Besitz eines Kölner Klosters. Es ist aber erheblich beschädigt und dürfte daher nicht viel wert sein. Ich bitte Dich, wenn das Bild in Paris ist, sofort den Schutz vorsichtig zu entfernen. Lass es irgendwann von den Kunstsachverständigen des Louvre begutachten und den Wert schätzen. Danach muss es unbedingt zu einem Restaurator. Du brauchst keine moralischen Bedenken zu haben, denn das Gemälde ist Eigentum unserer Familie, da ich es zusammen mit dem Haus rechtmäßig erworben habe.
Den Schmuck gebe bitte Mutter, ich hätte es so gerne …
Hier war die zweite Seite zu Ende. Grau gab Fréchencourt die Briefseiten zurück.
„Die folgende Seite enthält nur noch ein paar sehr persönliche Worte an die Familienmitglieder“, sagte Fréchencourt.
„Was haben Sie unternommen?“, fragte Grau.
„Gefunden hatte ich den Brief erst gestern Morgen. Ich habe die Kiste sofort aus dem Tresor geholt. Es war eine unserer kleineren hölzernen Transportkisten, mit denen wir Ersatzteile, wie zum Beispiel Schrauben, Fahrwerkfedern oder sonstige Beschläge, an unsere Kunden liefern. Unsere Kisten sind außen mit einem Spezialöl behandelt und von innen mit Teer wasserdicht gemacht. Sie sind demnach geeignet, damit auch feuchtigkeitsempfindliche Sachen zu transportieren oder über längere Zeit darin zu lagern“, erklärte Fréchencourt. „Also für den Transport von empfindlichen Bildern genau das Richtige. Wenn man will, kann man unsere Kisten mit Vorhängeschlössern sichern.
Ich habe mit Philippe zusammen die Kiste geöffnet. Obenauf befand sich eine Schmuckschatulle, die ein Collier, ein dazu passendes Armband und zwei Ringe enthielt. Darunter lagen zwei Christusikonen, ich vermute aus Russland. Zuunterst lag ein in mehrere Leinentücher eingeschlagenes goldgerahmtes Bild. Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber von diesem Bild ging eine eigenartige Faszination aus. Es zeigt offenbar eine Mutter mit ihren beiden kleinen Kindern. Ungewöhnlich empfand ich die Signatur. Signiert war das Bild nicht mit einem Namen, sondern mit der Buchstabenkombination ‚R.U.S.M.’ oder so ähnlich. Ich habe absolut keine Ahnung, welche Personen das Gemälde darstellt und welcher Maler seine Bilder so signierte. Mein Vater wusste es scheinbar auch nicht, sonst hätte er es mir ja mitgeteilt. Wir haben alles ordnungsgemäß in die Kiste zurückgeräumt. Ich habe noch einen Lederbeutel mit Louisdoren und zwei Goldbarren aus dem Tresor dazugelegt und die Kiste dann mit einem robusten Vorhängeschloss gesichert.
Jetzt galt es nur noch dafür zu sorgen, die Sachen aus der Stadt heraus und nach Paris zu schaffen. Ich hatte beschlossen nicht zu warten, sondern noch am gleichen Tag zu handeln, um das schlechte Wetter und die noch vorhandenen Lücken im Belagerungsring zu nutzen. Da ich meine Franctireurs wegen der gefährlichen militärischen Lage hier in Metz nicht im Stich lassen wollte, habe ich drei meiner besten und mir treu ergebene Männer beauftragt, die Unternehmung durchzuführen. Zu ihrer eigenen Sicherheit hatte ich ihnen nahe gelegt, sich als harmlose Bauern zu verkleiden und keine Waffen mitzuführen. Sie wissen ja, dass wir Franctireurs beim Gegner – gelinde gesagt – nicht sehr beliebt sind.“ Fréchencourt grinste.
„Die drei sollten die Kiste in Paris meiner Mutter übergeben und dort auf mich warten. Bei Gefahr sollten sie die Operation sofort abbrechen und hierher zurückkehren, denn ich wollte wegen ein paar Kunstgegenständen nicht ihr Leben aufs Spiel setzten.
Um zu vermeiden, dass meine Männer irrtümlich von unseren eigenen Leuten aufgehalten werden, hatte ich ihnen einen Marschbefehl ausgestellt und ihn von Marschall Bazaines Stab, zu dem ich übrigens gute Beziehungen pflege, unterzeichnen lassen. Ich habe dann nach Einbruch der Dunkelheit meine Männer bis zum Fort Queuleu im Südosten der Stadt begleitet. Von dort sind sie dann noch vor Mitternacht aufgebrochen. Die Route über Pouilly* in Richtung Nancy schien uns die ungefährlichste zu sein, weil ich gehört hatte, dass es im Süden und Osten nur einen dünnen, teilweise aus Kavallerie gebildeten Kordon feindlicher Truppen geben sollte. Da meine Leute nicht zurückgekehrt sind, muss ich davon ausgehen, dass sie durchgekommen sind.“ Fréchencourt sah zunächst zu Grau und dann zu Muller.
„Sie sind ein hohes, aber wie ich meine, ein noch vertretbares Risiko eingegangen, Monsieur Fréchencourt“, sagte Grau.
„Ich versichere Ihnen Messieurs, wenn ich auch nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, was sich wirklich in der Kiste befand, hätte ich anders gehandelt. Wie gesagt Messieurs, Philippe und ich haben bei der Durchsicht der Kiste keine Pläne gesehen. Es kann eigentlich nur so sein, dass mein Vater sie in der Rahmung des Bildes versteckt hat und zwar zwischen der Leinwand und dem Tafelbild. Ich denke deshalb auch seine Anweisung, das Tafelbild in Paris sofort zu entfernen, um die Entdeckung der Pläne sicherzustellen. Den Grund, warum mein Vater in seiner Nachricht an mich keine Worte über die Pläne verloren hat, kann ich nur vermuten. Er war immer sehr vorsichtig und hatte offenbar Bedenken, der Brief könnte in falsche Hände gelangen.“ Grau und Muller hatten die Schilderung Fréchencourts aufmerksam verfolgt. Muller kratzte sich hinter dem rechten Ohr:
„Ich meine, wir sollten wie geplant heute Nacht nach Paris aufbrechen, oder Pierre, was meinst du?“
„Ja, das sollten wir. Es sind jetzt fast fünf Uhr, Monsieur Fréchencourt, wie lange benötigen Sie, sich reisefertig zu machen? Wenn Sie es für erforderlich halten, kann Philippe uns begleiten.“
„Ja, er muss mit! Auf Philippe kann ich in Paris nicht verzichten und was die Reisevorbereitungen anbelangt, könnten wir in gut einer Stunde aufbrechen.“ Muller rieb sich gedankenverloren das Kinn:
„Wir sind dann zu viert, was bedeutet, dass wir uns etwas einschränken müssen. Wir dürfen daher nur unsere Papiere und das, was wir am Körper tragen können, mitnehmen. Nähere Einzelheiten über unser Vorhaben, erfahren Sie von uns im Fort Plappeville. Von dort aus werden wir aufbrechen.“ Fréchencourt blickte Grau aus zusammengekniffenen Augen ungläubig an:
„Fort Plappeville? Das ist meines Erachtens zurzeit der ungünstigste Ort, den man sich vorstellen kann. Jenseits des Forts befinden sich hohe Truppenkonzentrationen des Feindes. Deshalb wird es uns niemals gelingen von Plappeville aus durch die gegnerischen Linien zu schlüpfen.“
„Warten Sie´s mal ab“, Grau blinzelte Fréchencourt beschwichtigend zu. „Wir haben einen ungewöhnlichen, aber ausgezeichneten Plan. Sie werden sich noch wundern. Inzwischen dürften die Vorbereitungen im Fort angelaufen sein. Mehr verraten wir jetzt noch nicht.“
„Da ich Sie beide nicht für Selbstmörder halte, werden Sie schon wissen, was Sie tun“, brummelte achselzuckend der Hausherr.
„Etwas unwohl ist es mir allerdings bei dem Gedanken, das Haus hier ohne Bewachung zurücklassen zu müssen. Ich kann wegen der Kürze der Zeit keinen erreichen, den ich damit betrauen kann, sich um das Haus zu kümmern.“
„Ich hab da eine Idee“, beruhigte ihn Muller. „Geben Sie mir bitte zwei Blatt Papier und etwas zu schreiben.“ Fréchencourt öffnete unterhalb der Tischplatte eine Schublade und reichte Muller zwei Briefbögen, Tintenfass und Schreibfeder.
„Hier bitte!“, sagte er.
Muller schrieb auf jeden der Briefbögen einige wenige Zeilen und setzte anschließend seine Unterschrift darunter.
„So das hätten wir, Monsieur Fréchencourt. Ich muss jetzt nur noch den Stempel des Kriegsministeriums drunter setzen, damit die Schreiben amtlich werden.“ Muller entnahm einer Innentasche seines Gehrocks ein kleines flaches Etui.
„Für solche Fälle habe ich immer Stempel und Stempelkissen dabei“, erklärte er. „Unsere Unterschriften alleine sind nichts wert, denn wer in Frankreich kennt schon Muller oder Grau. Aber mit diesem hübschen Stempel hier, wird’s amtlich“, fügte er ironisch hinzu. Dann setzte er betont feierlich den Stempel unter seine Schreiben und betrachtete zufrieden sein Werk.
„Eigentlich können wir jetzt unser Gespräch beenden“, sagte Grau.
„Ich schlage vor, dass Sie und Philippe jetzt mit den Reisevorbereitungen beginnen, Monsieur Fréchencourt.“
„Ich bin einmal sehr gespannt, was Sie vorhaben, Messieurs.“ Der Hausherr steckte den Brief seines Vaters ein, verschloss die Tresortüre und schob das Bücherregal zurück an seinen Platz. Als die Männer die Bibliothek verließen, erhoben sich die beiden Gardisten.
„Claude Robin und Roger Mourai, es ergeben sich für Sie neue Aufgaben. Sie sind ab sofort direkt dem Kriegsministerium unterstellt und unterstehen somit nicht mehr der militärischen Befehlsgewalt, sondern haben ab jetzt nur noch die Anweisungen des Kriegsministeriums zu befolgen. Hier sind Ihre Legitimationen.“ Muller überreichte ihnen die soeben verfassten Schreiben.
„Ich werde noch heute Ihre Vorgesetzten im Fort Plappeville darüber informieren. Monsieur Fréchencourt, Monsieur Perçu Monsieur Grau und ich werden in der kommenden Nacht nach Paris aufbrechen. Sie beide werden Ihre Uniformen mit Zivilkleidung tauschen und das Haus hier bewachen, bis Monsieur Fréchencourt zurückkehrt oder Sie neue Anweisungen erhalten.“
Philippe, der hinzugekommen war und die letzten Worte mitgehört hatte, schaute irritiert in die Runde. Fréchencourt nahm ihn beiseite und informierte ihn kurz über sein Gespräch mit den Besuchern. Dann wandte sich der Hausherr an Robin und Mourai:
„Philippe wird Ihnen jetzt das Haus zeigen. Sie können sich hier überall frei bewegen. Zum Schlafen stehen Ihnen zwei Gästezimmer im oberen Stockwerk zur Verfügung. In den Schränken finden Sie ausreichend zivile Kleidung vor, sicherlich ist auch etwas Passendes für Sie darunter.
Die Lebensmittelvorräte, über die Sie verfügen können, reichen, je nach Ihrem Appetit, für sechs bis acht Monate. Noch etwas! Es ist möglich, dass einige meiner Männer hier auftauchen, die sich mit der Parole ‚La petite guerre’ zu erkennen geben. Nur diejenigen, die den Code kennen, dürfen Sie ins Haus lassen“, dabei blickte er Philippe grinsend an. Als ihn Robin und Mourai fragend ansahen, fügte Fréchencourt hinzu:
„Ach ja, ich hatte vergessen Ihnen zu sagen, dass dieses Gebäude den Franctireurs als geheimer Treffpunkt und Rückzugsort dient. Damit Sie mit meinen Leuten keine Probleme bekommen, werde auch ich ein kurzes Schreiben aufsetzen, welches Sie ihnen zeigen können, wenn es notwendig sein sollte.“ Muller schloss an:
„Folgenden Rat sollten Sie zu Ihrer Sicherheit dringend befolgen. Gesetzt den Fall, dass es sich abzeichnen sollte, dass der Feind die Stadt besetzen wird, dann wären Sie als Mitarbeiter des Kriegsministeriums, insbesondere aber als Unterstützer der Franctireurs, in größter Gefahr. Deshalb beseitigen Sie frühzeitig alles belastende Material. Vernichten Sie sowohl die von mir als auch die von Monsieur Fréchencourt ausgestellten Legitimationen und geben Sie sich als Bedienstete dieses Hauses aus. Dann haben Sie kaum etwas zu befürchten. Egal was geschieht, bleiben Sie auf Ihren Posten, auch wenn es länger dauern sollte als geplant. Wir werden uns melden, sobald es möglich ist.“ Nun ergriff Fréchencourt das Wort:
„Philippe wird Sie gleich in ein geheimes Kellergewölbe führen. Dort befinden sich ein Schießstand, Vorrats- und Waffenkammern. Ich bitte Sie, Ihre Uniformen und Gewehre in dem eigens hergerichteten Waffenraum unterzubringen. Philippe wird Ihnen dort im Gegenzug Handfeuerwaffen mit ausreichend Munition aushändigen. Vergessen Sie auf keinen Fall, bei Gefahr die Türen zu schließen.“
„Wir werden Sie nicht enttäuschen, Messieurs! Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen“, erwiderte Robin. Daran zweifelte niemand, selbst Philippe nicht, der inzwischen seinen Frieden mit den Besuchern geschlossen hatte.
„Beeilen Sie sich Philippe, Sie müssen sich noch reisefertig machen, wir wollen um sechs aufbrechen“, erinnerte ihn Fréchencourt.
Nachdem sich Philippe, Robin und Mourai zur Hausbegehung entfernt hatten, entschuldigte sich Fréchencourt, um sich umzuziehen und ein paar wenige Sachen zusammenzusuchen, die er auf seine vermeintlich letzte Reise mitnehmen wollte.
Grau und Muller zogen sich in die Bibliothek zurück, um sich die Wartezeit ein wenig mit Lesen zu verkürzen.
Wie verabredet, traf man sich kurz vor sechs in der Eingangshalle. Robin und Mourai waren in Zivil kaum wieder zu erkennen, und Philippe sah in Cut und grau-schwarz gestreifter Hose ausgesprochen elegant aus.
Die Gruppe verabschiedete sich von Robin und Mourai und wünschte ihnen viel Glück. Dann traten die Männer auf die Straße und hörten, wie sofort hinter ihnen der Riegel vorgeschoben wurde. Muller blickte prüfend zum Himmel, was er sah, schien ihn zufrieden zu stellen. Die Sonne war wieder hinter dunklen Wolken verschwunden und es wehte ein teils kräftiger Wind aus nordöstlicher Richtung.
„Mon Dieu, was stinkt das hier draußen so erbärmlich, so nach Fäkalien und Verwesung“, angewidert stieß Fréchencourt die eingeatmete Luft aus.
„Das ist Gewöhnungssache, nach einiger Zeit nehmen Sie den Geruch nicht mehr wahr“, beruhigte ihn Grau.
„Wir haben bis Fort Plappeville noch einen Weg von ungefähr vier Kilometern vor uns. Wenn wir stramm gehen, sind wir in gut einer Stunde dort“, sagte Muller und beschleunigte seine Schritte.
Zunächst eilten sie die Rue des Jardins hinunter, an der gotischen Kathedrale vorbei, ein Stück an der Mosel entlang und gelangten über die Pont des Morts auf die linke Flussseite. Überall auf ihrem Weg trafen sie kleinere oder größere Gruppen Soldaten, die den vorbeieilenden Zivilisten spöttisch hinterher schauten. Auch einige lästerliche Worte waren zu hören. Doch davon nahmen die vier Männer keine Notiz. Da es mittlerweile wieder begonnen hatte zu regnen, meinte Grau:
„Wenn wir Plappeville erreicht haben, sind wir nass bis auf die Knochen.“
Als sie hinter sich ein Fuhrwerk hörten, drehte Muller sich um und trat dem Gespann mit empor gestreckten Armen in den Weg. Der Kutscher konnte sein Gefährt gerade noch rechtzeitig vor Muller zum Stehen bringen.
„Sind Sie wahnsinnig, Mann?“, brüllte der aufgebrachte Soldat, der auf dem Kutschbock saß.
„Pardon Soldat, wir müssen so schnell wie möglich zum Fort Plappeville.“ Muller hielt ihm seinen Ausweis unter die Nase.
„Sie müssen meinen Ton entschuldigen, Monsieur, aber das hätte für Sie böse ausgehen können“, stammelte der Soldat, dessen Wut schlagartig verraucht war. Muller beschwichtigte ihn:
„Ich kann Ihren Zorn sehr gut verstehen, aber würden Sie uns bitte zum Fort fahren?“
„Selbstverständlich Monsieur, drei können hinten auf der Pritsche und einer bei mir hier vorne Platz nehmen.“ Muller setzte sich neben den Kutscher, die drei anderen kletterten hinten auf den Wagen unter die Plane. Ein kurzes „Hue“ und das Gespann setzte sich wieder in Bewegung. Pferde und Kutscher gaben nun alles, und nach einer Viertelstunde halsbrecherischer Fahrt hielt das Fuhrwerk an einem Schrankenposten an. Nachdem ein Wachsoldat die Papiere Mullers geprüft hatte, durften sie passieren, und nach hundert Metern rumpelte das Trainfahrzeug in einen der Festungshöfe.
„Wir sind am Ziel“, vermeldete Muller.