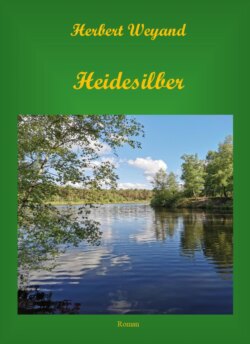Читать книгу Heidesilber - Herbert Weyand - Страница 6
Оглавлениеzwei
Leicht wogte der Morgennebel. Die Sonne drückte blutrot im Osten und malte ein farbenprächtiges Bild durch den Kiefernwald. Paul Grebner schlenderte gemütlich den Heideparkplatz entlang. Diesen Weg benutze er im Sommer fast täglich. Morgens begegnete er niemandem, sodass die Stimmung den Tag friedlich begann. Um diese Zeit röhrten die Maschinen der AWACS noch nicht. Aus der Heide heraus begrüßten ihn Vogelstimmen. Hier sang die Amsel noch kurz vor dem Morgengrauen und nicht zwei Stunden früher, wie in der Stadt. Selten lief ein Reh über den Weg. Seines Wissens gab es noch ein, zwei Rudel. In der kargen Landschaft wurden die Rehe nicht größer als Schäferhunde. Ab und an begegnete er einem Jogger. Heute lief er allein.
Nein. Doch nicht. Hinter der Umzäunung des Militärgeländes sah er schon Bewegung. Auch ein Kuriosum. Die NATO Air Base lag inmitten des Naturschutzgebiets. Manchmal stellte er sich die Frage, ob das Sperrgebiet die Natur, Tier und Pflanzen, schützte oder den Flughafen.
Den Spaziergang schloss Paul an diesem Morgen am Katharynensee. Dort drehte er eine Zigarette und ließ die Gedanken schweifen. Den kleinen See gab es schon ewig. Heute zauberte die Sonne spiegelnde Farbenspiele. Während rundherum Gewässer in den Kiesabbaugruben entstanden, fanden der Katharynenhof und der See schon im Mittelalter Erwähnung. Rechts nahm er eine Bewegung wahr. Unmutig stand er auf und blickte in den lichten Wald. Er wollte nicht gestört werden.
Ein leiser Ruf lenkte die Aufmerksamkeit dorthin. Dort kämpften zwei Menschen.
»Heh«, rief Paul. Das fehlte ihm noch. Aber tatenlos zusehen lag ihm nicht. Die beiden stoben auseinander und sahen zu ihm hinüber. Scheinbar Jogger. Sie trugen die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen. Die größere der Gestalten machte eine heftige Stoßbewegung und lief in den Wald hinein. Die andere Person sackte langsam zusammen und fiel nach hinten.
Paul stürmte zu dem Platz der Auseinandersetzung. Der Jogger lag wie tot am Boden. Er ging auf die Knie, um nach eventuellen Lebenszeichen zu suchen. Ein leises Rascheln ließ ihn herumfahren. Dann setzte der Verstand aus.
Mühsam kämpfte Paul mit der Dunkelheit und dem Dröhnen im Schädel. Allmählich verschwand der Nebel vor den Augen und er sah in das Sandloch, in dem sein Kopf steckte. Was war geschehen? Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Der berühmte Schlag mit einem harten Gegenstand. So sagte man doch in den Krimis, wenn man einen Schlag mit dem Spaten oder einem Stück Holz über die Rübe bekam. Die dazugehörige Beule am Hinterkopf wurde wohl als Hämatom bezeichnet. Trotz der bescheidenen Lage grinste er wegen der blöden Gedanken. Er rollte aus der Bauchlage und sah tatsächlich den Jogger in der gleichen Haltung, wie vor dem Schlag auf seinen Kopf. Wie lange lag er hier weggetreten? Der Typ lebte hoffentlich? Das fehlte noch. Unter großer Kraftaufbietung stand er auf. Bis auf das Hämatom und dem leichten Schleier vor den Augen schien alles in Ordnung. Er sah zu der bewegungslosen Gestalt hinüber. Sie atmete. Gott sei Dank. Über dem Brustkorb lagen zwei Hügel, die sich hoben und senkten. Eine Frau oder ein Mädchen stellte er fest. An ihrer linken Seite, kurz unter dem Rippenbogen, machte ihm der dunkle Fleck, auf der Kleidung, Sorgen. Eifrig riss er an dem Stoff, um die augenscheinliche Wunde freizulegen. Keine Chance. Ein haltbares Kunstgewebe. Verdammt, fluchte er. Früher hatte er doch kein Problem damit, eine Frau auszuziehen. Er löste das Oberteil, das, mittels Klettverschluss, einen Overall bildete. Ein Messerstich. Unterhalb des Rippenbogens quoll stetig dunkles Blut hervor. Also keine Arterienverletzung. Vielleicht hatte die Fremde Glück? Er streifte sein Shirt über den Kopf und drückte es fest auf die Wunde. Umständlich zog er den Kapuzenpullover über ihren Kopf und wickelte, mit dessen Ärmeln, die behelfsmäßige Kompresse fest.
Paul bog den Rücken durch. Da stand er nun mit seinen knappen zwei Metern und wusste nicht, was er tun sollte. Wie immer lag das Handy zu Hause in irgendeiner Ecke. Die Verletzte benötigte Hilfe und alleine lassen ging nicht.
Paul lebte wie der typische Einzelgänger. Seit einer Krebsoperation vor wenigen Monaten durfte er nicht mehr arbeiten. Vierzig Jahre alt und nur noch ein halber Mensch. Manchmal unterlag er der Versuchung, in endlosem Selbstmitleid zu versinken. Aber es brachte nichts. Das Leben ging weiter. Immer wieder kroch er aus seinem Loch heraus. Erst seitdem er seine morgendlichen Spaziergänge unternahm, sackte er weniger häufig in depressive Phasen. Mittlerweile fühlte er sich körperlich fit und bekam den Eindruck, von Tag zu Tag kräftiger zu werden. Auf dem gebräunten Gesicht und um die blauen Augen lagen zahlreiche kleine Fältchen. Früher lachte er viel. Vielleicht kamen sie daher. Die Züge wiesen jungenhafte Verletzlichkeit aus. Die langen dunklen Haare lockten bis auf die Schultern. Die Jeans saß stramm und spannte über dem knackigen Hintern, den manche Frau mit begehrlichem Blick musterte. Die breiten Schultern mündeten in kräftigen Oberarmen. Die Brustmuskulatur trat unter der Last der Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, deutlich hervor. Was sollte er tun? Konnte er die Frau bewegen?
Er musterte die Verletzte. Sie war groß. Mindestens eins achtzig und sah, wie sie dort lag, sehr verletzlich aus. Ihre mittelgroße Brust stützte ein kräftiger Sport-BH mit einem breiten Stützrand. Deshalb die beiden Hügel, die ihm ihr Geschlecht verrieten. Die Beine waren lang und er vermutete, sehnig. Das Alter lag so um die dreißig oder jünger. Das Gesicht, im Moment farblos, wies nicht die klassischen Schönheitsmerkmale auf. Es mutete auf eine seltsame Art und Weise flach an, mit etwas schräg liegenden grauen Augen, in denen leichte Schleier lagen. Graue Augen? Gott sei Dank. Sie erlangte das Bewusstsein.
»Bleiben sie ruhig liegen. Sie sind schwer verletzt.« Er sprach die Verletzte so ruhig, wie möglich an.
»Wat is gebeurd?« Sie versuchte, sich aufzurichten.
Oh Scheiße, eine Holländerin. Paul erwartete wie die meisten im Grenzgebiet, dass Holländer Deutsch sprachen. Er verstand die Sprache, es reichte jedoch nie, sie selbst zu sprechen.
»Sie haben eine Stichverletzung und müssen so schnell wie möglich in ein Krankenhaus.« Sanft aber mit Nachdruck legte er ihr eine Hand auf die Schulter.
»Oh, een Duitser. Ja, der hat mich gestochen. Mit eine Messer.«
»Ein Bekannter von Ihnen?«
»Dat war Huub. Der wollte der Scheibe, die ich heb gevonden. Ich wollte sie nicht geben, da hat er …«, sie kniff die Augen zusammen und verzog das Gesicht. »Het doet pijn.«
»Klar tut das weh. Kann ich sie hier alleine lassen? Dann hole ich Hilfe. Oder haben sie ein Handy dabei?«
»Nein. Keine Handy. Hol keine Hilfe. Ich kann gehen.« Sie versuchte, aufzustehen. Paul wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Möglicherweise lagen innere Verletzungen vor. Dennoch half er ihr. Schmerzhaft verzog sie das Gesicht und in den Augen zuckten Punkte hin und her. Die Schmerzen schienen gewaltig. Mühsam unterdrückte sie eine weitere Ohnmacht und stand tapfer auf ihren Beinen.
Sie lehnte sich gegen ihn und drückte die behelfsmäßige Kompresse in ihre linke Seite. »Komm. Wir gehen.« Mit zusammengebissenen Zähnen setzte die Holländerin Schritt vor Schritt. Er stützte sie auf der unverletzten Seite. Jeder Schritt wurde sicherer.
Wenn jetzt jemand vorbeikommt, schoss ihm durch den Kopf, sind wir ein seltsames Paar. Beide mit freiem Oberkörper. Na ja, sie hatte zumindest ihren BH an.
Sie kamen zum Heideparkplatz. Kein Auto.
»Weg. Mein Auto ist weg.«
»Geklaut?«, fragte Paul.
»Ja. Es ist weg.«
»Warten Sie dort auf der Bank. Ich hole mein Auto. In zehn Minuten bin ich wieder hier. Kann ich Sie allein lassen?«
Sie nickte. »Mach schnell. Es tut weh. Keine andere Hilfe.«
»Klar«, er spurtete in Richtung Dorf. Was mag geschehen sein? Die Frau war sehr wortkarg und hatte nicht viel gesagt. Weshalb wollte Sie keine professionelle Hilfe? Die Polizei musste hinzugezogen werden, schließlich hatte dieser Huub zugestochen.
Nach wenigen hundert Metern ging ihm die Luft aus. Keine Kondition und zu viel Zigaretten. Das Herz schlug bis zum Hals und die Lungen schrien nach Luft. Er zwang sich zur Ruhe und in einen schnellen Wanderschritt. Zum wiederholten Male leistete er den Schwur, das Rauchen aufzugeben. Paul sah noch einmal zurück. Die Straße wies eine leichte Biegung auf. Der Parkplatz verschwand hinter einem Maisfeld. Links stand ein einsames Haus. Durch die Panzerstraße vom Dorf abgeschnitten. Sollte er dort nach Hilfe fragen? Aber nein … keine fremde Hilfe!
In weniger als einer Viertelstunde fuhr er mit dem alten Mazda 6 auf den Parkplatz. Na ja, er war gerade mal sechs Jahre alt. Sie saß nicht mehr auf der Bank. Suchend ließ er den Blick kreisen und entdeckte die zusammengesackte Gestalt an der Rückseite der Grillhütte. Sie stand mühsam auf und kam gebückt auf ihn zu. Das Shirt, das sie gegen die Wunde presste, war durchgeblutet. Schnell half er ihr ins Auto.
»Und jetzt? Wo wollen sie hin?«
»Ich weiß nicht.«
Na dann. Jetzt hatte er den Prassel hängen. Er fuhr vom Parkplatz auf die Kreuzung zu, die links zum alten Heideeingang und rechts in die Waldstraße ins Dorf hineinführte. Während er in die Straße, die zum Ortskern führte, einbog, tauchte der schwarze PKW im Rückspiegel auf. Wo kam der denn her? Auf dem Parkplatz hatte er niemanden bemerkt. Wahrscheinlich ein Pärchen, das unbefugt in der Heide seinem Vergnügen nachging. Das Auto kam rasend schnell näher. Schon wieder so ein Raser, dachte er. Die Straße wurde mehr und mehr zur Rennstrecke. Er fuhr hart rechts, um ihn vorbeizulassen. Der Fahrer machte jedoch keine Anstalten den Lenker einzuschlagen. Er fuhr mit voller Wucht hinten auf. Die Holländerin stieß einen spitzen Schrei aus und hielt ihre verwundete Seite.
»Scheiße. Der rammt uns.« Paul beobachtete das Fahrzeug. Der Jogger von vorhin saß hinter dem Steuer. Sein Fuß drückte zwangsläufig das Gaspedal durch und setzte damit den Kickstart des Automatikgetriebes ein. Der Mazda schoss wie eine Rakete nach vorn. Paul bot alle Fahrkünste auf, um den Dorfplatz zu umrunden, ohne in die Kübel der Verkehrsberuhigung, zu fahren. Er raste in die Scherpenseeler Straße. Das Grenzhaus wischte vorüber und schon bog er in Scherpenseel auf die Heerlener Straße ein. Ohne den Spiegel oder gar die Dreißiger Zone zu beachten, fuhr er in Richtung Grenze. Am Viehweg riss er den Wagen nach rechts und machte das Gleiche am Scheleberg. Auf Höhe des Sportplatzes hielt er an und wartete ab. Ihr Verfolger tauchte nicht auf.
»Er ist weg. Ich habe deinen Kollegen erkannt ... der, der dir das Messer in die Seite gesetzt hat«, sagte er vorwurfsvoll.
Sie antwortete nicht. Die Holländerin kauerte in der Ecke und hielt mit schmerzverzerrtem Gesicht die Seite.
»Das Auto gehört mir«, stellte sie fest.
Paul ging nicht auf die Bemerkung ein und schwieg verstockt die wenigen Minuten bis zu seinem Haus und fuhr durch den hinteren Weg zum Hof. Seine Ruhe war ihm heilig. Schon jetzt machte er sie für die Störung verantwortlich. Vor einem großen schmiedeeisernen Tor stoppte er das Fahrzeug und wartete ungeduldig, dass das Tor aufschwang. Verwinkelt ging es an den leer stehenden Stallungen vorbei bis ans Haus.
»Komm.« Er führte sie in die Küche und wies auf einen Stuhl. »Soll ich zuerst einen Kaffee machen oder nach der Wunde sehen? Blöde Frage«, sagte er mehr zu sich selbst.
»Erst Kaffee«, forderte sie jedoch und löste den behelfsmäßigen, schmierigen Verband. Die Wunde blutete nicht mehr. Aber wie sah es drinnen aus?
Die Kaffeemaschine lief. Paul holte den Verbandskasten und tastete mit spitzen Fingern die Einstichstelle ab. Er mochte nicht mit Blut in Berührung kommen und empfand leichten Ekel. Aber hier musste er ran. Ein glatter Stich. Circa drei Zentimeter breit. Er bot alles an Überwindung auf, was ihm zur Verfügung stand und säuberte vorsichtig den verletzten Bereich.
»Du musst zu einem Arzt. Möglicherweise ist ein inneres Organ verletzt.«
»Nein. Kein Doktor. Noch nicht.«
»Weshalb? Du kannst doch nicht mit einer Stichverletzung umgehen, als wenn du dir in den Finger geschnitten hast.« Paul geriet in Rage.
»Ich kann nicht.«
»Wirst du von der Polizei gesucht?«
»Noch nicht. Aber bald.« Sie sah ihn unergründlich an.
»Was hast du angestellt?«
»Ich habe etwas gefunden.«
»Jetzt lass dir nicht die Würmer aus der Nase ziehen.« Paul brauste auf und hätte fast seine Tasse fallen lassen, die er zum Tisch balancierte. Diese blöde Kuh. Retten durfte er sie, aber … »Erzähl mir, was los ist.«
»Ich bin Anthropologin in Den Haag. Wir haben ein Projekt hier im Limburgischen und suchen Artefakte der Kelten. In dieser Gegend haben Kelten gelebt, die landläufig unter Aduatuker und später als Eburonen bekannt wurden. Sie lebten circa 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung in diesem Gebiet bis nach Tongeren hinunter. Dort suchten wir bisher. Bis ich auf den Gedanken kam, etwas weiter östlich, also hier zu suchen. Meine jetzigen Schwerpunkte sind die Brunssumer Heide und hier, die Teverener Heide. Bei Kiesabgrabungen wurden in diesem Gebiet häufiger Gegenstände aus der Steinzeit und später gefunden. Ich habe die Geländeformationen studiert und einen Hügel gefunden, aus dem ich schloss, dass hier möglicherweise ein Keltengrab lag.
Maar, wat voor verhaal vertel ik u. Ik heb een schijf gevonden. Ongeveer zo groot. (Aber, was erzähle ich einen Roman. Ich habe eine Scheibe gefunden. Ungefähr so groß.)« Sie zeigte mit den Händen einen Durchmesser von ungefähr fünfzehn Zentimetern an. »Mein Mitarbeiter Huub wollte jedoch das große Geld machen. Ich versteckte die Scheibe. Beim Joggen heute Morgen versuchte er, von mir zu erfahren, wo der Fundort liegt. Die heb ik hem ook niet verteld (den habe ich ihm nicht verraten) – und auch nicht, wo die Scheibe ist. Das Artefakt ist aus reinem Silber und es sind, mir unbekannte Zeichen darauf, die ich nicht entschlüsseln kann. Falls ich jetzt dadurch nachweise, dass die Kelten eine Schrift besaßen, wäre es ein großer Sprung für meine Karriere.« Sie arbeitete sich während des Vortrages immer besser in die deutsche Sprache, bis nur ein leichter Akzent zurückblieb.
»Das ist kein Grund, dich mit dem Messer abzustechen. Und, warum keinen Arzt und keine Polizei?« Er funkelte sie misstrauisch mit den blauen Augen an.
»Ich meldete den Fund nicht, weil ich sehen wollte, was dort noch ist. Da bekomme ich Schwierigkeiten.« Sie saß zusammengesackt auf einem Stuhl. Immer noch, nur mit dem BH bekleidet. Er konnte nicht verhindern, dass sein Blick häufiger zu den Brüsten glitt. Sie war eine gut aussehende Frau. Jetzt, das Gesicht arbeitete voller Leben, strahlte es Intelligenz und Humor aus. Asiatischer Einschlag, Eurasierin, ging ihm durch den Kopf.
»Hier.« Paul warf ihr ein Shirt zu. Mit einer eleganten flüssigen Bewegung zog sie es über. »Was machen wir jetzt? Kann ich dich irgendwo hinbringen?«
»Ich bin zurzeit auf einem Campingplatz. Dort steht mein Wohnwagen. Nichts Großes. Nur so ein kleines Ei.« Sie zeigte vage mit den Händen eine imaginäre Größe. »Ich musste ja irgendwo ungestört arbeiten können. Immer noch besser, als ein Hotel.«
»Dann bleibst du besser ein paar Tage hier. Ich habe Platz genug.« Er wies mit der Hand die Treppe hoch.
»Danke. Das nehme ich gerne an. Ich bin Griet.« Sie reichte ihm die Hand.
»Paul.« Er schlug ein.
*
»Paul.« Die Hand auf der Schulter holte ihn aus tiefstem Schlaf. »Ich habe Schmerzen.«
Er schlug die Augen auf und sah im Dämmerlicht die nackten Beine der Frau, die er gestern in der Heide aufgelesen hatte. Tatsächlich so sehnig wie in seiner Vorstellung. Der Blick glitt nach oben. Sein Shirt. »Zieh dir was über. Wir fahren zum Krankenhaus.«
»Nein. Kein Krankenhaus. Eine Tablette.«
»Verdammt. Zieh dich an. In fünf Minuten fahren wir.« Er wurde wütend bei so viel Unvernunft.
Eine Viertelstunde später wurde sie im Krankenhaus behandelt. Wie sollte es anders sein, hatte sie keine Papiere. Paul hinterlegte seine Daten und nach endlosen Fragen wurde die Behandlung nach etwa zwei Stunden abgeschlossen.
*
»Hast du dein Mailkonto abgefragt?« Oberkommissarin Maria Roemer blickte auf den Monitor. »In der Nähe deines Dorfes hat es vorgestern eine Messerstecherei gegeben.«
»Hab ich noch nicht gesehen.« Heinz Bauer schaute desinteressiert hoch.
»In den Regionalnachrichten. Eine Holländerin wurde bei einem Streit durch einen Messerstich verletzt und von einem Samariter in deinem Nachbardorf gerettet. Die Verletzung wurde durch das Krankenhaus gemeldet.«
»Das ist das, was ich gerade hier habe.« Er hielt ein Blatt Papier hoch. »Dienstanweisung. Wir sollen uns die Sache ansehen.«
»Wir?«, fragte Maria empört. »Wir sind die Mordkommission. Haben die noch alle Tassen im Schrank?«
»Bleib ruhig. Ich fahre zwei Stunden früher nach Hause und hör mich um.« Oberkommissar Bauer blickte betrübt. Seine Kollegin hockte lieber vor dem PC, als dass sie nach draußen ging. »Ich mach dann dort Feierabend. Vielleicht hole ich eine halbe Stunde raus und nutze die Zeit mit den Enkeln etwas zu unternehmen.«
»Wenn du willst. Hauptsache ich muss nicht aufs Land.«
*
»Hier ist es.« Griet wies mit der Hand auf eine kleine Erhebung im Boden. Sie lag etwa in der Mitte zwischen Katharynensee und Kiefernsee.
»Wie kann ein Mensch hier ein Grab vermuten? Für mich ist das ein Haufen Steine und Dreck.«
»Ja meistens haben wir auch Pech. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird auch nur alle Zehntausendmal etwas gefunden. Ich hatte Glück – oder es ist Können.« Sie grinste spitzbübisch.
In den vergangenen beiden Tagen lernten sie sich ein wenig kennen. Griet stellte sich als angenehme lustige Unterhalterin heraus und hatte zu jeder Zeit, viel zu erzählen. Paul gelangte auch ab und zu in eine solche Phase, meist jedoch hielt er sich ruhig und in Gedanken gefangen. Sie drang nicht in ihn, sondern nahm ihn, wie er sich gab. Das fand er angenehm. Mittlerweile wusste er, dass sie kein asiatisches Elternteil besaß, wie er zunächst vermutete. Der Gesichtsschnitt, mit den etwas schrägen Augen kam aus dem Zweig ihrer Mutter. Sie schloss nicht aus, unter ihren Vorfahren, einen zur See fahrenden, Verwandten zu haben.
Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Griet in Heerlen, also eine echte Limburgerin. Nach dem Abitur studierte sie in Amsterdam. Mehrere Jahre buddelte sie sich durch Europa, auf der Suche nach keltischen Überbleibseln, bis ihr die Dozentenstelle in Den Haag angeboten wurde.
»Wie willst du jetzt weitermachen? Hast du einen Plan?«
»Den Dreckhaufen, wie du ihn nennst, muss ich jetzt vorsichtig abtragen. Vermessen und fotografiert ist er schon. Das Erdreich siebe ich, damit nichts verloren geht.«
»Machst du das selber? Oder hast du Leute dafür? Mit deiner Verletzung kannst du einen solchen Job bestimmt nicht erledigen.«
»Normalerweise setzen wir Studenten meiner Uni ein oder Helfer, die wir anstellen. Aber hier muss ich alleine arbeiten. Sonst ist alles vergebens.«
»Hast du eine Genehmigung? Das hier ist ein Naturschutzgebiet und der Förster ein ganz schön scharfer Hund, wie man so sagt.«
»Leider nicht. Ich grabe heimlich.«
»Das geht nicht. Wir sind hier zwar abseits der Wege«, er ließ den Blick schweifen, »aber hier sieht man von überall ein.«
»Das habe ich bedacht und etwas vorbereitet. Geh bitte bis zum Weg dort hinten und schaue hier herüber.«
Gottergeben kroch er durch das Unterholz und erreichte nach einigen Minuten den Waldpfad. Als er sich umschaute, sah er nichts. Die Vegetation verbarg von dieser Seite den Einblick. So sehr er es versuchte, auf dem Rückweg machte er die Bodenerhebung nicht mehr aus. Ungefähr zehn Meter davor stolperte er fast in das Tarnnetz. Er kroch darunter hindurch und stand vor der grinsenden Anthropologin.
»Na. Was sagst du jetzt?«
»Perfekte Tarnung. Warum machst du es so geheimnisvoll? Deine Arbeit wird nur anerkannt, wenn du sie dokumentierst, und Zeugen hast.«
»Ja, das ist mir klar. Ich will es auch nicht allein machen. Die Sache mit Huub muss geregelt werden. Dann versuche ich, kompetente Hilfe zu bekommen. Ich weiß nicht weshalb, aber ich habe ihm die Fundstelle verheimlicht. Irgendein Gefühl verhinderte, sie ihm zu zeigen. Ich verstehe ihn nicht mehr. Er ist ein verträglicher und sehr hilfsbereiter Kollege. Es muss ihm jemand sehr viel Geld geboten haben. Im Moment kann ich sowieso nichts tun«, sie fasste an ihre verletzte Seite, die komplikationsfrei verheilte. Die Ärzte des Krankenhauses hatten gute Arbeit geleistet und die Wunde mit einigen Stichen verschlossen. Der Wundrand färbte sich nicht einmal rot. »Ich muss nach Den Haag, mit einem befreundeten Professor sprechen. Willst du mitzukommen? Du hast doch Zeit.«
Erschrocken schaute er sie an. Er lebte nun ungefähr ein dreiviertel Jahr, mit sich beschäftigt, zurückgezogen. Sollte er das aufgeben? Die letzten Tage gefielen ihm. Die Reste des Selbstmitleids bröckelten. Die, ansonsten um die Krankheit kreisenden Gedanken, fielen in sich zusammen. Im Grunde ging es ihm gut und er fühlte sich gesund. Er konnte alles tun. Zwar langsam und mit Überlegung, weil er sonst meinte, sein Unterbauch zerplatze, aber er konnte, wenn er wollte. Warum eigentlich nicht?
Sie beobachtete, wie er sein Gehirn zermarterte und las von seinem Gesicht, dass er eine positive Entscheidung traf.
»Klasse. Ich freue mich, dass du mit mir kommst.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich lese Gedanken. Nein, dein Gesicht ist wie ein Buch.«
»Na ja. Daran muss ich arbeiten. Wann geht es los?« Er grinste, wie ein übermütiger Junge.
Pauls Haus lag am Rande eines kleinen Dorfs. Idyllisch versteckte sich der Ort in einer langgestreckten Mulde. Im Winter ragten die Dächer heraus, die, die anderen Jahreszeiten mit Vegetation verbargen. Er liebte diesen Flecken und die Menschen. Vom Typ kamen sie Rheinländern am nächsten, also herzlich und doch eigenwillig. Zugezogene blieben ihr Leben lang Fremde, wenn sie nicht die ungeschriebenen Gesetze beachteten.
Paul arbeitete bis zum Beginn seiner Krankheit als Elektronikingenieur in Düsseldorf. Die Ehe ging nach acht Jahren zu Ende. Gott sei Dank hatte er keine Kinder aus der Verbindung. Vor fünf Jahren erbte er sein Elternhaus und hatte seitdem keine finanziellen Sorgen mehr. Den alten Bauernhof, in dem er die Kindheit und Jugend verbrachte, betrieb er als Hobby. Mit Liebe zum Detail ließ er ihn modernisieren und restaurieren. Seit drei Jahren lebte er, nach zehnjähriger Abwesenheit, wieder im Dorf.
Es fiel ihm schwer, Fuß zu fassen. Die alten Kontakte waren abgerissen und er hatte keine Lust, sie zu erneuern. So lebte er zurückgezogen und genoss die morgendlichen Spaziergänge. Natürlich traf er hier und da, den ein oder anderen. Doch mehr als Belanglosigkeiten tauschte er nicht aus.
Mit der agilen Holländerin kam Leben ins Haus. Am ersten Tag ihrer Bekanntschaft, also an dem Tag, wo sie verletzt wurde, bettete er sie am frühen Abend fürsorglich in einen Liegestuhl auf der Terrasse. Sie stießen mit Stubbis an und prosteten einander zu.
»Ich möchte dir eine Geschichte erzählen«, begann sie mit dem bezaubernden Akzent und wandte ihm das interessante Gesicht zu.
Paul nickte lediglich bestätigend.
»Du wirst mich für verrückt halten, aber aufgrund dieses jungen Kelten, von dem du jetzt hören wirst, wurde ich Anthropologin.« Sie schloss die Augen für einen Moment und musterte ihn geheimnisvoll. »Also dann … aber zuvor noch ein Satz von Caesar.«
*