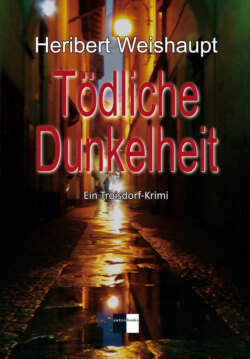Читать книгу Tödliche Dunkelheit - Heribert Weishaupt - Страница 13
7
ОглавлениеDer Klinikleiter der Tagesklinik ist in Rage.
„Herr Grosse, was wollen Sie mir eigentlich sagen? Zuerst behaupten Sie, David Winter befinde sich nicht in seinem Zimmer, dann sagen Sie, dass er nun doch dort ist. Was soll das?“, regt er sich auf.
Dr. Hermann Renger ist Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie und seit zehn Jahren Leiter der Tagesklinik. Er ist schlecht gelaunt, wie so oft montags. Das freie Wochenende mit seinen beiden pubertären Töchtern hat ihn wieder einmal genervt.
Alexander Grosse, der bereits seit vielen Jahren in der Klinik als Sozialarbeiter tätig ist, steht vor seinem Schreibtisch und knetet nervös seine Hände. Das Unverständnis des Klinikleiters lässt seine Wangen erröten, was ihm äußerst unangenehm ist.
„Aber Herr Doktor, ich möchte doch nur bemerken, dass David heute Morgen mehrere Stunden nicht in seinem Zimmer war und niemand über seinen Aufenthalt Bescheid wusste. Gestern hat er sein Zimmer bezogen und heute Morgen war er mehrere Stunden spurlos verschwunden. Das geht doch nicht.“
Der Sozialarbeiter ist empört und versucht gar nicht erst, dies vor dem Klinikleiter zu verbergen.
„Aber jetzt ist er doch da, oder?“, fragt Dr. Renger genervt. „Heute beginnt doch die Milieutherapie, an der er teilnehmen soll. Die erste gemeinsame Besprechung mit allen Teilnehmern ist nach dem Mittagessen angesetzt. Da Sie ihn seinerzeit überzeugt haben an der Therapie teilzunehmen, dachte ich mir, es wäre vielleicht ratsam, dass Sie einmal vorher mit ihm sprechen“, verteidigt sich der Sozialarbeiter.
Alexander Grosse leistet immer gewissenhaft seine Arbeit und solch ein eigenmächtiges Handeln eines Patienten will er nicht ohne Weiteres hinnehmen. Er hat den Eindruck, dass er wieder einmal das Gespräch mit dem Patienten und damit die unangenehme Arbeit übernehmen soll. Von seinem Vorgesetzten scheint er kein Verständnis und keine Hilfe erwarten zu können.
„Soll ich mit David über den Vorfall sprechen?“, bietet er sich dennoch verärgert an.
„Lassen Sie es gut sein, er ist jetzt da und damit hat es sich. Aber wenn Sie wollen, sprechen Sie mit ihm und sagen Sie ihm, dass so etwas künftig nicht mehr vorkommen darf.“
Mit einer für ihn typischen Handbewegung, die seinen Unmut darstellen soll, beendet der Klinikleiter das Gespräch.
Resigniert verlässt Sozialarbeiter Grosse das Büro seines Vorgesetzten.
Die personelle Situation in der Tagesklinik ist wie in fast allen Kliniken. Zu wenig Personal – und das Personal, das Dienst hat, ist überfordert. Unregelmäßigkeiten zu hinterfragen, bedeutet zusätzliche Arbeit – und die will niemand. Auch der Klinikleiter nicht.
David Winter hat Anna beim Treffen am See angelogen. Er ist weder selbstständig in der Computerbranche, noch unterstützt er Firmen bei Computerproblemen. Auch hat er keine schöne, eigene Wohnung direkt in der Stadt. Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus am Ortsausgang von Troisdorf in Richtung Siegburg. Dort teilt er sich mit einem anderen jungen Mann im Rahmen einer Wohngemeinschaft eine Wohnung. Zwei Zimmer und Küche – 45 Quadratmeter, mehr nicht.
Als er noch nicht Patient der Tagesklinik war, hatte er einen Ganztagsjob in einem kleinen Computerladen, wo er hauptsächlich Hardware reparierte und Softwareprobleme behob. Sein Chef hatte Davids exzellente Softwarekenntnisse frühzeitig erkannt und schätzte seine Arbeit. Seitdem er die ambulante Behandlung in der Tagesklinik vor mehreren Wochen begonnen hat, kann er diesen Job nur noch nach Ende der täglichen Behandlung und samstags ausüben. Neben fachärztlicher Behandlung und psychologischer Psychotherapie nahm er an einer Reihe anderer Therapien teil. So zum Beispiel Ergo-, Kunst- und Musiktherapie. Diese Therapien wurden im Rahmen der Tagesklinik montags bis freitags in der Regel von neun bis sechzehn Uhr angeboten. In keiner der Therapien fühlte er sich wohl. Die behandelnden Ärzte erachteten daher eine Verlängerung für sinnlos.
Ab diesem Montag soll er nun an einer Milieutherapie, der sogenannten künstlichen Familie teilnehmen. Einer vorübergehenden Lebensgemeinschaft in der Klinik, die auf drei Wochen befristet ist. In seinem Job kann er während dieser Zeit nicht mehr arbeiten.
Leiter dieser Therapieform ist der Sozialarbeiter Alexander Grosse. Ihm zur Seite stehen zwei weitere Sozialarbeiter, ein Psychologe, ein Arzt, ein Koch und ein Verwaltungsmitarbeiter der Klinik.
Die beteiligten Patienten wohnen in dieser Zeit zusammen in der Klinik. Der Tagesablauf ist mit handwerklicher Arbeit, alltäglichen Tätigkeiten wie Kochen und Putzen sowie gemeinsamen Freizeitaktivitäten geregelt.
Abends sollen wichtige Punkte aus dem täglichen Zusammenleben mit den Betreuern besprochen werden.
Trotz der strengen Auflagen der Therapie, der alle Teilnehmer ausdrücklich und einheitlich zugestimmt haben, kann David es nicht lassen zum See zu fahren. Mit seinem Fahrrad dauert es nur wenige Minuten, bis er den See erreicht. Er weiß, dass die blinde Frau immer sehr frühzeitig morgens zum See kommt. Er konnte deswegen heute nicht am gemeinsamen Frühstück teilnehmen. Das ist ihm egal. Ihm würde sicherlich eine Ausrede einfallen und falls er eine Ermahnung bekäme, würde ihm das auch nichts ausmachen.
Heute Morgen am See hatte er gerade seinen Beobachtungsposten eingenommen, als Anna den See erreichte. Er fühlte, wie das Adrenalin in seinen Körper schoss und sich ein unglaubliches Lustgefühl ausbreitete.
Nur das heimliche Beobachten reichte ihm nicht mehr. Er wünschte sich Kontakt zu dieser Frau. Er musste mehr von ihr sehen. Er wollte sie in ihrer Privatsphäre beobachten. Einer plötzlichen Eingebung folgend, beschloss er, sie heute anzusprechen. Hätte er sich das lange vorher überlegt, wäre er mit Sicherheit viel zu aufgeregt gewesen. So hatte er sich spontan zu diesem Schritt entschlossen – und er hatte es geschafft. Es war einfach herrlich. So nah, direkt neben der Frau zu sitzen, ihren Körper zu betrachten, ihren Atem zu spüren. Und dieses überwältigende Gefühl will man ihm in der Klinik abgewöhnen.
Der Arzt hat ihm erklärt, dass es sich bei ihm um einen krankhaften Voyeurismus handelt, der behandelt werden muss. Er hat den Arzt verstanden und einer Behandlung zugestimmt. Ihm ist klar, es ist wie eine Sucht. Zeit seines Lebens hat er dieses starke Gefühl immer wieder gesucht, immer öfter, immer bei anderen und unterschiedlichen Frauen. Es gab Zeiten, da war er völlig desorientiert, nur vom Gefühl gesteuert. Er konnte sich auf nichts anderes mehr konzentrieren.
Seitdem er die Tagesklinik besucht, hat sich sein Zustand gebessert. Er ist stabiler geworden. Er ist in der Lage, seine Gefühle zu kontrollieren. Auch auf seine Arbeit im Computerladen kann er sich wieder freuen und konzentrieren.
Doch jetzt, seitdem er dieser blinden Frau begegnet ist, ist alles fast wie früher. Er dreht sich wieder wie ein Hamster im Rad, aus dem er nicht mehr herauskommt. Er will, nein, er muss diese Frau beobachten. Muss ihr heimlich näher kommen, muss in ihre Intimität eindringen. Er kann sich nicht dagegen wehren.
Der erste Tag der Therapie ist zu Ende. David liegt im Bett und starrt zur Zimmerdecke hoch. Sein Zimmer in der Klink befindet sich zur Straßenseite. Er hat die Vorhänge am Fenster nicht zugezogen und einen Fensterflügel geöffnet. Von außen dringen das Licht der Straßenlaternen und der Motorenlärm der vorbeifahrenden Autos ins Zimmer.
In der Vorbesprechung der Therapie hatte er sich das Zimmer ausgesucht. Die wenigen Zimmer auf der Parkseite sind zwar wesentlich ruhiger, David wollte aber nicht diese Ruhe und vor allem nicht die dort herrschende Dunkelheit. Er hätte sich abgeschoben und verlassen gefühlt.
In seiner Wohnung in der Stadt teilt er sich das Schlafzimmer mit einem Freund. Alleinsein ist dort fast unmöglich. Ebenso ist es dort fast unmöglich, allein und in Ruhe über sich und über das Leben nachzudenken. Es sei denn, man schafft es, solange wach zu bleiben, bis der Freund eingeschlafen ist. Aber auch in diesen seltenen Fällen unterbindet das Atmen oder Schnarchen des Freundes jeden klaren Gedankengang.
Nach dem Abendessen hatten alle Patienten mit den Betreuern zum ersten Mal wie geplant zusammengesessen und den vergangenen Tag besprochen. Er musste sich für sein Fernbleiben vom Frühstück vor der Gruppe rechtfertigen. Schnell erfand er eine „Notlüge“ vom angeblich erkrankten Freund, der auf seine Hilfe angewiesen sei und am Ende zollte man ihm für sein soziales Verhalten sogar Respekt und Mitleid gleichzeitig.
Dieses Verständnis würde ihm künftig sogar die Möglichkeit eröffnen, so oft wie er es wollte, vom Frühstück fernzubleiben. Und er würde oft nicht am Frühstück teilnehmen – so wie es jetzt aussieht, nie. Da ist er sich sicher.
Welch eine positive Wendung des Schicksals. Erstmals nach längerer Zeit fühlt er sich gut und zufrieden. Er hat ein Zimmer für sich allein. Er hat es geschafft, der Frau am See näherzukommen und er kann, so oft er möchte, die Klinik am frühen Morgen verlassen – dem kranken Freund sei gedankt.
Alles wendet sich zum Guten, denkt er.
Das war nicht immer so. Wahrhaftig nicht.
David war bei seiner Geburt ein hübsches Baby mit dichten, pechschwarzen Haaren und einem hübschen Gesicht. Er war nicht unbedingt ein Wunschkind seiner Eltern. Sie hatten bereits einen zehn Jahre alten Sohn. Aber der ungeplante Nachkömmling wurde umhegt und gepflegt. Man kann sagen, seine ersten Jahre waren schöne Jahre – lediglich mit der Einschränkung, dass David sich an diese Zeit natürlich nicht mehr erinnern kann.
Seine Erinnerungen reichen zurück bis zum Beginn seiner Schulzeit. Damals stritten sich seine Eltern häufig. Oft lag er im Bett, hielt sich die Ohren zu, um den lautstarken Streitigkeiten nicht zuhören zu müssen.
In späteren Jahren bemerkte er bei seiner Mutter öfter blaue Flecken im Gesicht und an den Armen. Auf seine Frage antwortete sie immer lapidar, dass sie sich gestoßen habe. Sein Vater ging irgendwann nicht mehr zur Arbeit. Er saß immer zu Hause, trank Bier und war durchweg schlecht gelaunt. Das war die Zeit, in der David seine Mutter oft nachts weinen und seinen Vater stöhnen und schimpfen hörte. Er war noch zu jung, um alles zu verstehen, was mit seinen Eltern los war. Er begriff lediglich, dass es oft ums Geld ging. Es schien ein chronischer Geldmangel zu Hause zu herrschen von dem das tägliche Bier für seinen Vater nicht betroffen war. Spielsachen erhielt er nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten und dann immer nur ein kleines Geschenk, das er sich nie gewünscht hatte – aber er hatte doch so viele Wünsche. Süßigkeiten gab es nie.
Trotzdem liebte er seine Eltern – auch seinen Vater.
Als er zwölf war, wurde sein Vater in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Seine Mutter besuchte ihren Mann nie und er durfte seinen Vater daher ebenfalls nicht besuchen. Eine Erklärung, weshalb man seinen Vater von der Familie getrennt hatte und wieso er ihn nicht mehr sehen durfte, erhielt er nicht. Seine Mutter bemühte sich zwar, den Vater zu ersetzen, trotzdem war sie in Davids Augen die Schuldige für den Zerfall der Familie.
Erst viele Jahre später erfuhr er durch einen Zufall, dass sein Vater bereits vor Jahren in der Klinik Suizid begangen hatte.
Das Zusammenleben mit seiner Mutter gestaltete sich zunehmend schwieriger. Immer häufiger wechselte seine Mutter ihre Männerbekanntschaften. Er begann, sie dafür zu verabscheuen.
„Wie kann sie nur Vater so betrügen und so einfach vergessen?“, fragte er sich immer wieder.
Mit seinem zehn Jahre älteren Bruder konnte er nicht über seine Probleme sprechen. In dieser Zeit, in der David ihn gebraucht hätte, hatten die Brüder nur wenig Kontakt zueinander. Zu groß war der Altersunterschied. Sein Bruder war erwachsen und hatte andere Interessen. Davids Probleme interessierten ihn nicht.
Eines Abends, David lag bereits im Bett, klopfte es an seiner Zimmertür, was an sich schon ungewöhnlich war und sein Bruder kam herein.
David war so überrascht, dass er sofort hochsprang und sich im Bett aufsetzte. Er schaute seinen Bruder erwartungsvoll mit großen Augen an, ohne ein Wort zu sagen oder eine Frage zu stellen. Sein Bruder setzte sich zu ihm aufs Bett. Er schaute zu Boden und David schaute auf seine Bettdecke. Keiner der beiden sprach ein Wort, als müssten beide einen Kampf austragen, wer als Erster das Schweigen bricht.
„Ich haue hier ab.“
„Wieso?“, fragte David.
„Ich halte es einfach nicht mehr aus.“
„Aber du kannst mich doch nicht allein lassen.“
„Du kommst schon zurecht. Mutter sorgt schon für dich. Außerdem wirst auch du älter und eines Tages …“
„Nein, das darfst du nicht“, unterbrach ihn David, drehte sein Gesicht ins Kopfkissen und begann lautlos zu schluchzen.
„Okay, machen wir ein Spiel.“
David hob seinen Kopf aus dem Kissen und schaute zu, wie sein Bruder ein Kartenspiel aus der Tasche zog. David hatte das Kartenspiel schon oft bei ihm gesehen. Er schien es immer bei sich zu haben.
Die Karten ordnete er wie einen Fächer und hielt sie David mit der Rückseite nach oben hin.
„Du ziehst eine Karte und ich ziehe eine Karte. Wenn du die höhere Karte ziehst, bleibe ich. Wenn ich die höhere Karte ziehe, haue ich ab. Einverstanden?“
„Einverstanden!“
David fuhr unschlüssig, welche Karte er ziehen sollte, mit der Hand über die Karten. Dann fassten seine Finger zu und er zog eine Karte aus dem Fächer. Er drehte sie langsam um. Eine Dame. Er strahlte, denn er wusste, es gab nur zwei Karten mit einem höheren Wert. Der König und das As. Seine Chancen standen gut.
Mit Spannung verfolgte er, wie sein Bruder ohne lange zu überlegen zugriff. Ohne zu zögern drehte er die Karte um – ein As.
„Pech gehabt kleiner Bruder.“
„Ja.“
David ließ die Arme resigniert auf das Bettlaken sinken.
„Wann gehst du?“
„Morgen.“
Mehr Worte wurden nicht gesprochen. Wozu auch. Das Schicksal hatte entschieden. David schaute seinem Bruder hinterher, als dieser das Zimmer verließ. Als er die Tür zuzog, meinte David, ein leises „mach‘s gut“ gehört zu haben.
„Du auch“, flüsterte er.
Am nächsten Tag, als David aus der Schule nach Hause kam, war sein Bruder nicht mehr da.
Seine Mutter sagte ihm nur kurz, dass sein Bruder sie verlassen hatte. David fragte nicht weiter. Er hatte das Spiel verloren, Schicksal eben. Und gegen das Schicksal hatte er schlechte Karten gehabt.
Jahrelang hörte David von ihm nichts mehr. Seine Mutter sagte einmal zu ihm, dass er seinen Bruder vergessen solle. Er wäre total introvertiert und würde sich sowieso nicht für ihn interessieren und nur in seiner eigenen Welt leben. Damals verstand David nicht, was introvertiert bedeutet, glaubte aber verstanden zu haben, was seine Mutter meinte. Für ihn trug seine Mutter nicht nur die Schuld an der Trennung von seinem Vater, sondern auch am Weggang seines Bruders.
David war seitdem allein mit seinen Problemen und die Abscheu seiner Mutter gegenüber entwickelte sich langsam aber stetig zu einem Hassgefühl.
„Ich bekomme heute Abend Besuch. Bernd kommt vorbei. Du gehst rechtzeitig ins Bett“, eröffnete seine Mutter ihm eines Tages, als er gerade dreizehn Jahre alt war. Bernd kam sehr früh. Zur Begrüßung tätschelte er mit aufgesetzter Freundlichkeit Davids Kopf. Seine Mutter verlor keine Zeit, ihn in sein Zimmer zu drängen. Der Ärger über die für ihn unverständliche Abschiebe ins Bett und der vehement aufkommende Hass gegen seine Mutter ließen ihn nicht einschlafen.
Nach einiger Zeit vernahm er bekannte Geräusche, die aus dem Schlafzimmer seiner Mutter zu kommen schienen. Es waren die gleichen Geräusche, die er früher vernommen hatte, wenn sein Vater Bier getrunken hatte und er im Bett lag und sich die Ohren zuhielt. Er hörte wieder dieses Stöhnen. Doch seine Mutter weinte im Gegensatz zu früher nicht. Er hörte ihre helle Stimme lachen. Auch schimpfte dieser Mann, den sie Bernd nannte, nicht mit ihr.
Vorsichtig stieg er aus seinem Bett und schlich auf nackten Füßen zum Schlafzimmer seiner Mutter. Die Geräusche wurden lauter. Bernd stöhnte laut, wogegen seine Mutter spitze Schreie ausstieß und Worte zu Bernd sagte, die er nicht kannte, die sich aber obszön und schmutzig anhörten.
Vorsichtig näherte er sich der nur angelehnten Schlafzimmertür. Nein, ein Zurück gab es jetzt für ihn nicht mehr. Er musste wissen, was da drinnen vor sich ging.
Mit spitzen Fingern drückte er gegen die Türe, bis sich ein kleiner Spalt ergab, durch den er ins Zimmer blicken konnte. Was er dort sah, ließ ihm den Atem stocken.
Seine Mutter und Bernd waren nackt. Bernd lag auf dem Rücken. Seine Arme und Beine waren gespreizt und mit Riemen am Bettgestell angebunden. Seine Mutter saß auf Bernd wie auf einem Pferd, den Oberkörper nach vorne gebeugt. Ihre Brüste pendelten schlaff vor dem Gesicht von Bernd hin und her. Beide bewegten sich im Takt auf und ab, wobei seine Mutter mit den Fäusten auf den Brustkorb von Bernd hämmerte, der immer lauter stöhnte. Manchmal hörte es sich an, als wenn er „nein“ stöhnte, dann wieder meinte David ein stöhnendes „ja“ zu vernehmen.
David schlug eine Hand vor den Mund, fuhr herum und lief so schnell er konnte zur Toilette, wo er sich übergab. Dann eilte er wieder zu seinem Zimmer und verkroch sich unter die Decke, bis nichts mehr von ihm zu sehen war. Er hielt sich mit den Händen wie früher beide Ohren zu. Er schluchzte.
„Was macht meine Mutter da drinnen bloß mit Bernd?“, fragte er sich.
„War es das, was Frauen und Männer unter Sex verstehen?“
Er war schockiert. So etwas Ähnliches hatte er schon mal aus Gesprächen der Schüler der höheren Klassen entnommen.
Nun wusste er, dass diese nicht gelogen hatten. Er kannte jetzt die eklige Tatsache. Wie konnte seine Mutter Bernd nur so behandeln. Bernd tat ihm fast leid. Und seine Mutter – die hasste er jetzt noch mehr.
„Verhalten sich alle Frauen so?“, fragte er sich.
„Wenn das der Fall ist, will ich nichts mit Frauen zu tun haben“, entschied er spontan.
In den folgenden Monaten und Jahren brachte seine Mutter immer häufiger verschiedene männliche Besucher mit nach Hause. David stellte fest, dass das Geschehen im Schlafzimmer immer gleich ablief. Er empfand, dass seine Mutter alle ihre Männer quälte und erniedrigte. Eine dauerhafte Beziehung entstand mit keinem der Männer.
Seine Mutter war für ihn das Abbild aller Frauen und durch ihr Verhalten wuchs in ihm eine Abscheu gegen die Frauen im Allgemeinen.
Trotzdem konnte er nicht leugnen, dass ihn im Laufe der nächsten Jahre das Äußere mancher Mädchen magisch anzog und erregte. Er konnte sich dennoch nie überwinden, ein Mädchen anzusprechen oder sogar den Versuch zu unternehmen, eine Freundschaft zu beginnen.
Nun war er auch nicht gerade der Typ, auf den die jungen Frauen flogen. Er wirkte depressiv und hatte daher auf seine Mitmenschen eine negative Ausstrahlung. Es kam ihm vor, als hätten seine depressiven Stimmungen irreversible Schäden in seinem Gesicht hinterlassen, die für alle Mitmenschen sichtbar waren. Es kam sehr selten vor, dass er lachte und seine Zahnlücke zwischen den oberen beiden Schneidezähnen machte ihm das Leben auch nicht leichter. Um es mit einem Wort zu sagen, er war nichtssagend.
In der Schule nahmen ihn seine Mitschüler nicht ernst und trauten ihm nichts zu. Er beteiligte sich fast nie am Unterricht und von den Lehrern wurde er übersehen oder kritisiert, falls er einmal eine Antwort gab.
Er lebte sein junges Leben für sich und entwickelte einen unbändigen Eifer, was die Computertechnik betraf. Er konnte sich abschotten und eine Zeitschrift über IT-Technik mit der gleichen Leidenschaft verschlingen, wie er mit den Fingern über die Tasten seines Notebooks flog.
Mit fast neunzehn Jahren geschah es dann doch. Er ging zum allerersten Mal eine nähere Beziehung zu einer Frau ein. Eva war eine zierliche, kleine Person, allerdings mit einem ausgeprägten Willen. Der Kontakt wäre aus seiner Sicht nie entstanden, wenn nicht Eva die Initiative ergriffen hätte. Auch zu Liebkosungen und der gegenseitigen Erforschung des Körpers ermunterte ihn Eva. Bis zu diesem Punkt genoss er das Zusammensein. Als Eva eines Tages, seine Mutter hatte für einige Stunden die Wohnung verlassen, mehr von ihm wollte als nur oberflächliche Zärtlichkeit und Streicheln, war er schockiert. Vor seinem inneren Auge spielten sich die Szenen seiner Mutter mit ihren Männern ab. Nein, er wollte von einer Frau nicht so erniedrigt werden, wie seine Mutter die Männer erniedrigte.
Direkt und ohne Umschweife forderte er Eva auf, die Wohnung zu verlassen. Eva war bestürzt und beleidigt, zumal David ihr keinerlei Erklärung für sein Verhalten gab.
In den nächsten Jahren hatte David hin und wieder kurze Beziehungen zu Frauen, die jedoch an dem entscheidenden Punkt immer wieder endeten. Zu sehr waren die Erinnerungen an seine Mutter und deren Männer und den damit verbundenen Ekel präsent.
Irgendwann zog er bei seiner Mutter aus und brach den Kontakt zu ihr ganz ab.
Inzwischen kam es auch nicht mehr zu kurzen Beziehungen zu Frauen. David begnügte sich mit dem Beobachten von willkürlich ausgewählten Frauen, das ihm zu einer gewissen Befriedigung verhalf.
In der Folgezeit legte er sich ein hochwertiges Fernglas sowie eine Kamera mit starkem Zoomobjektiv zu, die sein Vorhaben enorm unterstützten. Er entwickelte sich immer mehr zu einem krankhaften Voyeur.
Da er keine direkte Beziehung mehr zu Frauen hatte, verblassten im Laufe der Zeit auch die Erinnerungen an die schreckliche Zeit seiner Kindheit zu Hause.
In der Folgezeit griff ihn die Polizei mehrfach auf, als er die Persönlichkeitsrechte von Frauen verletzte, indem er sie mit einem Fernglas beobachtete oder mit der Kamera fotografierte.
Im vergangenen Jahr wurde er am Badesee verhaftet, als er aus einem Versteck Frauen mit seiner Kamera nahe heran zoomte und fotografierte.
Die letzte Verhaftung erfolgte Anfang des Jahres am Rande des Stadtparks. Er saß spätabends versteckt in einem Gebüsch. Mit seinem Fernglas beobachtete er in der gegenüberliegenden Wohnung eine junge Frau beim Entkleiden. Ein älterer Mann, der seinen Hund Gassi führte, überraschte ihn und rief die Polizei.
Der Ermittlungsrichter war einfühlsam und sah in David einen jungen Mann, der durch äußere Einflüsse vom Weg abgekommen war. Der Richter vermutete, dass die Grundlagen für seine Erkrankung bereits durch familiäre Erlebnisse in der Pubertät entstanden waren. Da er bisher nie gewalttätig in Erscheinung getreten war und sich seine Erkrankung lediglich auf das Beobachten von Frauen beschränkte, fand der Richter, dass man ihm eine Chance geben sollte. Er erließ keinen Haftbefehl. Durch intensive fachärztliche Hilfe sollte er wieder in die Gemeinschaft integriert werden.
Er fragte David, ob er einer solchen Behandlung zustimmen wolle. David, der um seine krankhafte Veranlagung selbstverständlich wusste, schämte sich grundsätzlich wegen seiner Neigung. Ohne Zögern stimmte er einer Behandlung zu. Natürlich war die Möglichkeit einer Strafe zu entgehen ebenfalls sehr verlockend. Er wolle ein anderer Mensch werden, versprach er dem Richter. Durch Kontakte des Richters konnte er bereits wenige Tage später eine ambulante Behandlung in der Tagesklinik beginnen.
An diesem Abend im Bett in der Klinik spult sich sein bisheriges Leben nochmals in seinen Gedanken ab. Er hat die blinde Frau kennengelernt und es ist alles nicht mehr so, wie es war oder wie es werden sollte. Das Versprechen, das er dem Richter gegeben hat, schiebt er in die entlegenste Windung seines Gehirns.
Er denkt an Konrad, seinen Freund und Mitbewohner. Konrad kennt Davids Veranlagung und versteht ihn. Manchmal, wenn sie abends im Bett lagen und rumalberten, zog Konrad ihn mit seinen Frauen auf und machte sich lustig über ihn. Natürlich nur im Spaß. Beide lachten und David erzählte ihm dann Geschichten seiner Beobachtungen, die er reichlich ausschmückte. Er war dann richtig stolz auf sich.
Konrad hatte nie etwas zu erzählen. Er hatte weder etwas mit Frauen, noch mit Männern. Für ihn gab es nur seine Arbeit und in der Freizeit seinen Computer.
David fragt sich: Will er so werden wie sein Freund? – Nein, das möchte er nicht.
Es mehren sich die ernsthaften Bedenken, ob er weiterhin die Kraft und Ausdauer aufbringen kann, eine Änderung seines Verhaltens herbeizuführen.
Vor allem hat er Zweifel, ob er diese Behandlung hier noch will.
Irgendwann fallen ihm die Augen zu und er versinkt in einen unruhigen Schlaf.