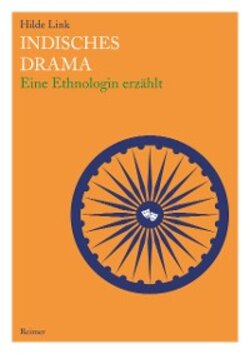Читать книгу Indisches Drama - Hilde Link - Страница 12
ОглавлениеDer Dämon der Unwissenheit lässt mich hoffentlich nicht los
Gegen Abend, es war noch nicht dunkel, ging ich ins „Seagull“, allgemein bekannt als „Sigl“. Das Sigl ist ein Lokal direkt am Meer neben dem Ashram- Gästehaus, von wo aus man schön auf die Möwen und den Sonnenuntergang schauen kann. Im Sigl verkehrt der hochkastige und gepflegte Alkoholiker, wie ich später erfuhr: Ärzte aus den umliegenden Krankenhäusern, Universitätsprofessoren, unter Garantie auch mein Peiniger, Herr Patil. Ich setzte mich draußen an einen der Sperrholztische und versuchte, mich beim Auflehnen nicht zu verletzen. Die Meeresluft hatte das einst schön aufgeklebte braune Plastik-Holzimitat der Tischoberfläche in kleine Splitterpfeile verwandelt, die hartnäckig versuchen, Hände und Unterarme des Hungrigen aufzuspießen.
Kaum hatte ich mich hingesetzt, kamen fünf junge Männer in roter Uniform an meinen Tisch gestürmt. Die Kellner. Als ginge es um eine Hinrichtung, zeigten alle gleichzeitig, die rechten Hände zur Pistole geformt, auf meinen Oberkörper und riefen im Chor: „Comefrom!!!“ Auf meine Antwort „Germany“ hin wurde mir die Speisekarte ausgehändigt. Der Einband mag einmal, so vermutete ich, aus rotem Samt gewesen sein. Ich nahm das speckig- dunkelbraune Büchlein mit den roten Rändern, schlug die drei ersten Seiten auf und tippte auf einen dunklen Fleck, wie viele, viele andere schon vor mir. Den Namen des Gerichtes konnte man nicht mehr lesen, aber ich dachte mir, bestimmt ist das was Gutes, sonst hätten das ja nicht so viele Leute bestellt. Es kam ein Teller mit „chicken 65“, gebratene rote Geflügelstückchen. Ich dachte, die Hühnchen sind aber klein hier in Indien, was für winzige Knöchelchen. Konrad klärte mich später auf, dass das keine Hühner, sondern Krähen sind, die sich von Aas und den Stoffwechsel-Endprodukten ernähren, die Fischer am Strand in ihrer Open-Air-Toilette hinterlassen. Indischen Gästen ist das egal, ob Krähe oder Huhn, Hauptsache gut gewürzt. Gerade als ich das erste Stück des köstlichen Gerichtes gegessen hatte, trat ein athletischer junger Mann an meinen Tisch und fragte, ob er sich zu mir gesellen dürfte.
„Bitte, gern.“
„Ich bin Ray“, sagte der blond gelockte Schöne.
„Ray, wie X-ray?“, fragte ich und fühlte mich originell.
„Ray wie – sunray.“
Der Sonnenstrahl bestellte auch kurz entschlossen das abgetippte Gericht, also „chicken 65“, nachdem ich ihm versichert hatte, wie lecker das schmeckt. Ray war Banker aus dem United Kingdom und hatte gerade einen überaus erfolgreichen Geschäftsabschluss in Bombay mit einer indischen Bank hinter sich. Die Geschäfte habe er unerwartet zügig abgewickelt, jetzt wolle er in Pondicherry Urlaub machen. Mir gegenüber saß der personifizierte Erfolg, ein Held der Londoner Lombard Street. Und was hatte ich Versagerin vorzuweisen? Meine Pleite mit der Aufenthaltsgenehmigung und ein Forschungsprojekt, das ich noch gar nicht kannte. Ich mochte gar nicht dran denken, machte einen auf coole Ethnologin und gab wenigstens mit meiner Doktorarbeit an: eine Studie über Mikronesien. Wo Mikronesien ist, wusste Ray nicht und überspielte seine Unkenntnis mit:
„Ich kenne nur Millionesien. Von Dagobert Duck.“
Gott, wie einfallsreich und witzig dieser Mann doch war. Ich lachte amüsiert und erklärte ihm, wo die Inselgruppe ist, nämlich im Pazifik.
„Dann bist du also Pazifistin“, bemerkte Ray, wieder so einfallsreich und witzig wie vorhin.
Ich bejahte, ja, ich bin Pazifistin, genau.
Während des Essens sahen wir ein Kind am Strand, wie es von den Wellen hin und her geschubst wurde und wie der Sand anfing, es zu bedecken. Ray sprang auf und sprintete quer durchs Lokal ans Meer. Schade, dass er nicht noch ein paar Tische umgerissen hat, das hätte mir gefallen. Ich hechtete hinterher, so schnell ich konnte, und kam an, da war das Kind schon gerettet. Allerdings nicht von Ray. Der Junge hatte nur „Ich bin ertrunken“ gespielt. Seine Freunde lachten, als Ray es hochriss, mit dem Kopf nach unten über sein linkes Knie legte und ihm auf den Rücken klopfte. Dieser Mann war ein Held, nicht nur in London, sondern auch in Pondicherry: entschlossen und selbstlos, jederzeit bereit, Menschenleben zu retten. Zurück bei unseren inzwischen kalt gewordenen vermeintlichen Hühnchen, erwähnte der Verehrenswerte, wo wir schon mal beim Thema waren, dass er eine Woche zuvor in Bombay eine ganze Schulklasse samt Lehrerin aus den Fluten gerettet habe. Er sei nämlich Rettungsschwimmer. Donnerwetter! Held auch noch in Bombay.
Auch Ray wohnte im Ashram-Gästehaus. Nebeneinander gingen wir die Treppen zum ersten Stock hoch. Sein Zimmer war links von der Treppe, meines rechts. Obwohl ich ihm erzählt hatte, dass ich verheiratet bin, nahm er bei der vorletzten Stufe meine Hand und zog mich nach links. Oben angelangt ging ich ohne jeden Kommentar nach rechts. So ein einsames Herz war ich nun auch wieder nicht.
Gegen neun Uhr – in Deutschland war es jetzt halb fünf Uhr morgens – betrat ich den Frühstücksraum des Gästehauses. Auf jedem Tisch stand ein Plastikschildchen mit weisen Zitaten der Mutter oder Sri Aurobindos. Sowas wie: „Die Ewigkeit ist unendlich“ oder „Gnade.“ Ray hatte sich für „Alles Leben ist Yoga“ entschieden und wartete seit sieben Uhr morgens auf mich. Er habe nicht schlafen können, denn Abgewiesen-Werden sei für ihn ganz was Schlimmes, das sei er ja so gar nicht gewöhnt. Das Porridge in seiner Schale war angetrocknet, und auf dem Tisch standen fünf leere Tassen, auf deren Grund sich Reste von Kaffee, Zucker und Milch zu bizarren Landschaften formiert hatten. Ideal zum Kaffeesatzlesen. Konnten wir aber zum Glück nicht, sonst hätte ich da schon gewusst, dass die nächsten eineinhalb Jahre kein Ethno-Ringelrein auf dem Abenteuerspielplatz Indien werden würden, sondern das blanke Martyrium. Ich holte mir einen Knoblauchtoast und drei Tassen Tee. Knoblauch ist nämlich gesund und macht fit. Bei der Wahl meines Sitzplatzes achtete ich darauf, nicht den Park im Blickfeld haben zu müssen. Schon nach den ersten Bissen lehnte Ray sich in seinem Stuhl zurück. Ich erzählte ihm, dass ich gleich von einem Kollegen abgeholt werde, um eine Wohnung zu besichtigen, in der ich mit meiner Familie zwei Jahre lang zu leben gedachte. Ray wünschte mir von ganzem Herzen viel Glück und beteuerte mir, dass er für mich da sei, und fragte, ob wir uns zum Mittagessen wieder hier bei „Alles Leben ist Yoga“ treffen wollten. Ich sagte: „Warum nicht“. Da hatte Ray schon beschlossen, seinen Urlaub mit mir zu verbringen.
Punkt, wirklich punkt elf stand Konrad am Eingang des Frühstücksraums und winkte. Ich verabschiedete mich von Ray und freute mich aufrichtig, dass Konrad gekommen war.
Wir gingen die Uferpromenade entlang, ohne viel zu reden. Konrad ist nicht gesprächig. Wenn er was sagt, dann Essentielles. Und Essentielles gab es gerade nicht zu besprechen. Wir bogen von der Avenue Goubert in die Rue du Bazar Saint Laurent ab und gelangten schließlich zur Rue La Bourdonnais. La Bourdonnais war im 18. Jahrhundert der Gouverneur von Mauritius. Auf dieser Insel sollte ich später einmal arbeiten. Es ging um indische Tempel als politische und wirtschaftliche Machtzentren. Diese Forschung hatte ich beantragt, weil meine Kinder, inzwischen in der Pubertät, gesagt hatten: „Mama, in diese Zumutung von Indien kannst du künftig alleine fahren. Andere Mütter sind auch Ethnologinnen, und die arbeiten in der Karibik oder irgendwo sonst auf der Welt, wo es schön ist. Wir bleiben zu Hause, schließen uns kriminellen Banden an und werden drogenabhängig, während du in Indien bist.“ Also hatte ich mir überlegt, wo es schön ist auf der Welt und wo sonst noch Inder sind, und kam auf Mauritius. Die Kinder waren einverstanden. Ich stellte einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und als dieser bewilligt worden war, flogen wir alle miteinander nach Mauritius. Meine Töchter belegten Tauchkurse und flirteten mit den örtlichen Beach Boys, während ich im Landesinneren, da wo sonst niemand hinkommt, eifrig nach indischen Tempeln Ausschau hielt und die Priester befragte, was sie außer religiösen Zeremonien noch so alles treiben. Wirtschaftlich und politisch gesehen. Abends ließen wir uns dann gemeinsam mit den anderen Urlaubern den weißen Rum schmecken, feierten Grillpartys und schauten aufs Meer. Dieses Projekt bescherte uns sogar noch eine Kongressreise nach Japan. In Kyoto und Osaka hat es uns auch gut gefallen. Wären wir sonst ja nie hingekommen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist eine wunderbare Einrichtung. Kleiner Tipp: Drohungen von pubertierenden Kindern unbedingt ernst nehmen.
Die Rue La Bourdonnais Nummer zwei war keine Wohnung, sondern ein französischer Kolonialbau mit verschnörkelten Gittern an den hohen Fenstern. Das Haus war von zwei Parteien bewohnt: von Rebecca Gottlieb und von Mr. Shubash, beide Ashramiten. Nach mehrmaligem Klopfen mit dem Vorhängeschloss an das hohe, weiß gestrichene Gittertor vernahm ich ein langgezogenes „Muuuuhh“. Die violetten Bougainvilleen wucherten über die Mauer und bildeten über Konrad und mir eine Laube.
Eine Kuh im Garten dieser Villa?
„Rebecca, mach auf!“ Konrad war ungeduldig.
Eine ältere Frau im abgewetzten Sari kam mit einem Schlüssel in der Hand herbeigeeilt und öffnete das Tor.
„Vanakkamaaya“, (Tamil: Willkommen, Großmutter) sagte Konrad höflich.
„Vanakkamaya“, (Tamil: Willkommen, gnädiger Herr) antwortete die Großmutter. Mir schenkte sie ein freundliches Lächeln.
Auch ich sagte „vanakkamaaya“, schließlich hatte ich nicht umsonst Tamil gelernt.
Die Aaya ging langsam mit wiegendem Schritt voraus und führte uns einen kleinen Weg entlang durch den Garten zu einer von Fächerpalmen gesäumten Terrasse, deren Decke von zwei dorisch nachempfundenen Säulen getragen wurde.
Wir sollten doch auf den Rattansesseln einstweilen Platz nehmen, ob wir einen Tee wollten. Nein, danke.
Wieder ein tiefes „Muuuuh“, das aus dem Haus zu kommen schien.
Die ratlos dreinblickende Aaya führte uns durch ein hohes Holztor, hinein in einen fast doppelt so hohen Raum. In einer Ecke dieser Halle lag eine füllige Gestalt, die kurz muhte, als sie uns erblickte. Das musste Rebecca sein. Die langen braunen, etwas verstrubbelten Haare und die Kaffeeflecken auf dem weißen Gewand ließen mir den Gedanken an eine Kuh nicht abwegig erscheinen. Konrad und ich knieten uns vor das Heilige Tier.
„Rebeccaaaa!“
Ein Blick aus sanften braunen Augen war die Antwort auf Konrads Versuch, die Kuh-Frau zu erreichen.
„Das ist Hilde. Sie will das Haus mieten. Du hast doch gesagt, du ziehst aus.“
„Haaaallooooo!“ Konrad winkte vor Rebeccas Augen mit der flachen Hand hin und her, als würde er am Bahnhof stehen und seine Familie im ausfahrenden Zug verabschieden und als wäre es völlig normal, deutsche Frauen, mich mal noch nicht mitgerechnet, zurück in die Realität zu holen.
Rebecca kam zurück ins Hier und Jetzt, rappelte sich umständlich vom Fußboden hoch und ließ sich in einen weiß lackierten Rattanstuhl fallen, der unter der Last alle vier Beine von sich spreizte. Konrad und ich standen ebenfalls auf und setzten uns auf ein weißes Holzsofa mit weißen Kissen. Rebecca erblickte mich und schaute verwundert. Sie fragte sich wohl, wie wir hereingekommen waren.
„Das ist Hilde“, versuchte Konrad noch einmal sein Glück. „Sie will hier einziehen. Du hast doch gesagt, du willst weg von hier.“
„Weißt du, Hilde“, begann Rebecca, „hier in Indien kannst du einen Yoga machen, wie sonst nirgendwo auf der Welt. Ich mache hier spirituelle Erfahrungen“ – sie hielt einen Moment inne, um ihren Worten die rechte Bedeutung zu verleihen, und fixierte Konrads obersten Hemdknopf – „die ich mir in Deutschland nicht einmal vorstellen konnte.“
Ich nickte wenigstens andächtig, wenn ich schon nicht wusste, wovon Rebecca sprach.
„Manchmal bin ich Kuh. Du musst das richtig verstehen: Ich versetze mich nicht hinein in das Wesen einer Kuh oder tue so, als wäre ich eine. – Ich bin Kuh. Ich – bin – ganz – Kuh.“
Pause.
Rebecca wartete auf mein Nicken. Ich tat ihr den Gefallen.
„Der Dämon der Unwissenheit, weißt Du, Hilde, der Dämon der Unwissenheit, der hält uns alle gefangen. Mich hat er losgelassen.“
Mit einem Male war mir das alles hier unheimlich. Was, wenn auch mich der Dämon der Unwissenheit loslässt? Als hätte sie meine Gedanken erraten – wahrscheinlich hatte ihre innere Stimme ihr mein sorgenvolles Abwägen offenbart – fuhr sie fort:
„Aber“, und jetzt lächelte Rebecca milde, während ihr Blick lange auf ihren Händen ruhte, „da muss man wirklich sehr lange und sehr tiefgründig Yoga gemacht haben, um solch einen Zustand zu erreichen. Ich praktiziere diesen Yoga schon, seit ich zwanzig bin. Jetzt bin ich sechsundfünfzig.“
Ich atmete hörbar auf und war erleichtert, dass der Dämon der Unwissenheit mich noch eine Weile fest im Griff haben würde.
„Sechsunddreißig Jahre Yoga. – So alt, wie ich jetzt bin“, sagte ich mit aufrichtiger Hochachtung.
„Und?“ Konrad kam zurück auf das Wesentliche. „Wann ziehst du hier aus?“
„Sobald ich einen Nachmieter habe, der bereit ist, die restlichen sieben Monate meines Elf-Monats-Vertrages zu übernehmen“, sagte Rebecca sachlich, als wäre sie nie Kuh gewesen.
„Mach ich, das mache ich!“, rief ich begeistert. Und als hätte mich niemand gehört, sagte ich viel zu laut: „Ja, Rebecca, ich übernehme das Haus.“
Jetzt schaute mich Rebecca besorgt an, beugte sich zu mir vor, bis sie ganz nah an meinem Gesicht war, und flüsterte: „Hier sind Geister.“
„Ach.“ Auch das noch. „Was für welche denn?“, fragte ich mehr neugierig als besorgt.
Dazu wollte Rebecca sich nicht äußern, deutete aber auf die Wand hinter sich. Da waren mit weißer Farbe übermalte Kratzspuren. Gerade als ich mich fragte, wie die Spuren wohl dahin gekommen waren, streckte Rebecca beide Hände aus und zeigte mir ihre abgerissenen Fingernägel.
„Und“ – ich zögerte – „ich meine, sind die Geister weg? Konntest du sie vertreiben?“ Das interessierte mich jetzt schon.
Rebecca strahlte und antwortete mit einem klaren „Ja“ ohne weitere Erklärungen. Ich wollte das Thema nicht vertiefen und kam auf den Mietvertrag zu sprechen.
Rebecca kramte in einer Schublade herum und gab Konrad ein Dokument, als sei er der Makler.
„Unterschreib hier“, sagte Konrad zu mir, nachdem er das dicht bedruckte Blatt aufmerksam gelesen, den Inhalt offensichtlich verstanden und etwas Unleserliches unten hin gekritzelt hatte. Den Text hatte ich zwar nicht gelesen, das Haus hatte ich auch noch nicht ganz gesehen, aber ich unterschrieb, denn auf Konrad war Verlass.
„Und du hier“, sagte Konrad zur von Kuh zu Mensch rückverwandelten Rebecca.
Kurz erklärte uns Konrad, welchen Vertrag wir soeben abgeschlossen hatten, nämlich dass Rebecca morgen aus- und ich einziehe und dass ich die Aaya übernehme (das war Konrads handschriftlicher Teil), damit diese nicht in ihrem Slum verhungern musste.
Nach Vertragsabschluss war Rebecca ebenso erleichtert wie ich. Sie würde gleich morgen in ein Zimmer im Ashram ziehen.
„Geht am Vormittag zu Marcel, eurem Vermieter, und regelt das Finanzielle“, riet Konrad.
Die beiden Mädchen sagten artig ja.
Konrad und ich verabschiedeten uns von Rebecca, ich bedankte mich bei ihr, Rebecca bedankte sich bei mir, wir beide bedankten uns bei Konrad. Dieser begleitete mich noch ein Stück des Weges und nannte mir Läden, in denen ich Bettwäsche, Matratzen, Decken und Moskitonetze kaufen konnte, und beschrieb mir die Stelle, wo am Sonntag Schreiner billige Betten auf der Straße verkauften. Die paar Möbel von Rebecca, die im Haus waren, konnte ich übernehmen.
Nichts gegen erfolgreiche englische Banker, die in ihrer Freizeit indische Kinder und deren Lehrerinnen aus dem Meer ziehen, aber Ray hatte angefangen, mir auf die Nerven zu gehen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in einem einfachen, aber sauberen vietnamesischen Lokal – der Speisesaal des Ashram-Gästehauses ist mittags nämlich zu – gesellte ich mich erst mal zu Sri Aurobindo und der „Mutter“ in meinem Zimmer. Die „Mutter“ lag immer noch mit dem Gesicht auf dem Schreibtisch, über Sri Aurobindo hing das Leintuch. So konnte ich mich ungeniert ausziehen und duschen. Der Jetlag setzte mir gewaltig zu. Bevor ich einschlief, machte ich mir Sorgen um die Kinder und sehnte mich nach Manuel.
Sonderlich erquickend war der Schlaf unter dem scheppernden Ventilator zwar nicht, aber er reichte aus, um mich nach dem Aufwachen mit Unruhe zu erfüllen. Draußen war es fast schon dunkel. Ein Gefühl der Leere überkam mich, und ich fragte mich, was ich hier eigentlich wollte. War es denn nicht schön in Deutschland? Ich hatte einen Lehrauftrag am Institut für Völkerkunde und Afrikanistik, Manuel würde als Künstler bestimmt bald Fuß fassen, die Kinder könnten ganz normal in die Schule gehen und dort weiterhin singend, tanzend und malend die Geheimnisse des Lesens, des Schreibens und der Zahlen entdecken. Bevor ich mich in Vorwürfe hineindrillen konnte, stand ich schnell auf, duschte und verließ das Zimmer, um in der Stadt herumzugehen und irgendwo etwas zu essen. Essen ist immer gut, wenn man dabei ist, trübsinnig zu werden. Wem begegne ich auf dem Gang? Genau. Eigentlich wollte ich nur so herumbummeln, aber bei Rays Anblick dachte ich mir, ich könnte doch gleich Bettwäsche und Moskitonetze kaufen. Leintücher sind auch in Indien schwer, und die würde Ray sicherlich gerne schleppen wollen. Also schlug ich vor, wir könnten doch nach einem Imbiss einen kleinen Einkauf tätigen. Ray wollte nichts lieber als das.
Im Gegensatz zum „weißen Viertel“ mit seinen menschenleeren Straßen und für indische Verhältnisse gepflegten Häusern, in dem auch die weiße Villa in der Rue La Bourdonnais und das Ashram-Gästehaus liegen, war in der Jawaharlal Nehrustreet das richtige echte Indien, das, welches man aus dem Fernsehen kennt: ein Laden neben dem anderen, dazwischen das Indian Coffee House, Teil einer Kultkette, die sich über ganz Indien zieht, bunte Lichtreklamen, ein wegen zahlreicher Löcher und weil Händler dort ihre Waren auf Tüchern ausgebreitet hatten kaum begehbares Trottoir, auf der Fahrbahn Dreirad-Scooter mit ihren Quäk-Hupen, klingelnde Fahrradrikshas, hin und wieder ein Ambassador-Auto, hunderte, nein tausende von Fahrrädern und Menschen, Menschen, Menschen, die alle irgendetwas kaufen wollten. Ich war einer von denen, die mit suchendem Blick nach geeigneten Waren Ausschau hielten. Schon nach anderthalb Stunden hatte ich alles beisammen, was ich fürs Erste brauchte. Ray ging hinter mir her und versuchte in der Schneise zu bleiben, die ich durch die Menschenmassen bahnte. Sein jahrelanges Schwimmtraining hatte seine Muskeln so weit gestählt, dass sie mühelos meinem Großeinkauf gewachsen waren. Allerdings nahm sein Gesicht mehr und mehr gequälte Züge an, die er schnell mit einem tapferen Lächeln zu vertuschen suchte, wenn ich mich nach ihm umdrehte, um zu sehen, ob er noch da war. Am Ende der Nehrustreet, da wo es keine Läden mehr gibt, nahmen wir eine Riksha zurück zum Gästehaus. Ray ließ sich auf die Bank plumpsen und stapelte alle Tüten auf seinen und meinen Schoß. Der Rikshafahrer war ein alter Mann, und ich kam mir unendlich dämlich vor, mich von ihm fahren zu lassen. Beim Aussteigen bezahlte ich ihm freiwillig einen Preis, der prozentual zu meinem schlechten Gewissen stand und der mich in der wohligen Gewissheit zurückließ, eine mindestens zehnköpfige Familie für viele Tage vor dem Verhungern gerettet zu haben.
Im Gästehaus wollte Ray mich durch ein fröhliches „Da sind wir ja“ glauben machen, dass er die Treppen mit frischer, nicht etwa mit letzter Kraft bewerkstelligt hatte. Wir stellten alles im Zimmer ab, und Ray verschwand nach meinem herzlichen Dank mit einem nun doch leicht erschöpft klingenden: „Bis morgen.“
Nach einer Nacht mit unruhigem Schlaf und zahlreichen Alpträumen wollte ich am frühen Morgen irgendwo in der Stadt frühstücken. Ray sollte nicht Opfer meiner schlechten Laune werden, auch wenn alles Leben Yoga ist. In dem Moment, als ich mich an der Rezeption vorbeidrücken wollte, um der redseligen Ashramitin am Empfang zu entkommen, hörte ich eine sanfte Stimme:
„Dr. Link?“
„Ja?“, antwortete ich mit scheinheiliger Freundlichkeit.
„Haben Sie gut geschlafen?“
Ich hielt diese Frage für eine rhetorische und antwortete ebenso rhetorisch: „Danke der Nachfrage. Ja.“ Ich wollte weitergehen.
Der Blick von Mrs. Maheshvari verriet Argwohn.
„Wirklich? Sie haben in diesem Zimmer gut geschlafen? Welches Bett haben sie denn benutzt?“
„Das am Fenster.“
„Merkwürdig, in der Tat“, sagte sie leise vor sich hin.
„Warum?“ Mrs. Maheshvari hatte es geschafft, meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
„Wo doch letzte Woche in dem Bett am Fenster eine junge Frau ermordet worden ist.“ Ich glaubte einen hämischen Blick in den Augen der grauhaarigen Dame zu erkennen.
„Soso“, sagte ich lässig, als wäre ich jeden Tag mit Morden in meinem Bett konfrontiert. „Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch“, wünschte ich Mrs. Maheshvari. Den Gefallen tat ich ihr jetzt nicht, an Ort und Stelle auszuflippen.
Puh. Diese Nachricht wollte erst mal verarbeitet werden.
Ich ging zurück zum Frühstücksraum und war froh, Ray dort anzutreffen. Jetzt brauchte ich einen Gesprächspartner. Zusammen gingen wir schnellen Schrittes in mein Zimmer. Ein unsägliches Grauen stieg in mir auf, als ich auf mein Bett schaute. Meine paar Habseligkeiten stopfte ich eilig in meinen Rucksack und deponierte ihn zusammen mit dem Einkauf von gestern in Rays Zimmer.
Ich musste umgehend diesen Ort verlassen, verabschiedete mich von Ray und eilte in die Rue La Bourdonnais. Hoffentlich war Rebecca nicht wieder im Verwandlungs-Yoga versunken. Ich klopfte, wie gestern Konrad, mit dem Vorhängeschloss an das Gittertor. Diesmal kam nicht Aaya, sondern eine jugendlich wirkende, schön geschminkte Frau mit zurückgebundenen Haaren, weißer Hose und weißem ärmellosen T-Shirt ans Tor.
„Forever young! I want to be forever young! Do you really want to live forever, forever, forever young...“, trällerte die tänzelnd daherkommende Rebecca und schwang den Schlüssel über dem Kopf.
Ohne irgendwelche Höflichkeitsfloskeln bat ich nach einer Begrüßung, bei der mich Rebecca wie ihre liebste Freundin in die Arme schloss, dass wir doch bitte gleich zu Herrn Marcel gehen sollten wegen des Vertrages, und fragte, ob ich schon diese Nacht hier schlafen könne. Rebecca bestand auf einer Tasse Tee und der gemeinsamen Besichtigung des Hauses. Mir war alles recht, Hauptsache ich musste nicht noch eine Nacht in diesem Gästehaus zubringen. Das mit dem Tee war eine gute Idee. So hatte ich Gelegenheit, Rebecca von dem Mord in meinem Zimmer zu erzählen. Ach Gott ja, Morde kämen hier in Pondicherry ständig vor. Erst vor ein paar Tagen sei der Sohn vom Copyshop-Besitzer ein paar Häuser weiter umgebracht worden, tja, Gewalt an allen Ecken und Enden hier in Indien, aber die Seele sei ja zum Glück unsterblich. Rebecca wusste aufgebrachte Gemüter zu besänftigen.
Eingedenk der unsterblichen Seele zeigte mir Rebecca das Haus. Alle Räume weiß, die Halle weiß, der Schlafraum weiß, das Bad weiß, die Veranda weiß, die Küche weiß, das Arbeitszimmer weiß. Sogar die Fußböden waren weiß lackiert, alle Möbel weiß gestrichen. Weiß, weiß, weiß, wohin man schaute. Allein der kleine mit Ziegelsteinen bepflasterte Hof war nicht weiß, die Bananenstaude dort auch nicht.
Ich konnte gar nicht fassen, dass ich das alles für umgerechnet zweihundert Mark im Monat mieten konnte. Plötzlich beschlich mich die Angst, Rebecca könnte sich mit den Geistern im Haus versöhnt haben und nun doch nicht ausziehen, Vertrag hin oder her. Ich drängelte, dass wir gleich zum Vermieter gehen sollten. Monsieur Marcel, ein Indo-Franzose, hatte ein Reisebüro am Ende unserer Straße gegenüber einer Dependance der Pondicherry University. Er war nicht schlecht erstaunt über unseren eigenmächtig abgeschlossenen Vertrag, war aber froh, dass wieder eine deutsche Frau das Haus übernehmen würde. Deutsche sind sauber und fleißig, das wisse er, weil er zwanzig Jahre lang in Paris gelebt hatte und auch schon mal in Deutschland gewesen ist. Ich bezahlte die Kaution und drei Monatsmieten. Wie gut, dass mir die Universitäts-Amtskasse in München einen ordentlichen Vorschuss in bar ausbezahlt hatte. Monsieur Marcel steckte das Geld in seine Brieftasche, stand auf und wünschte mir in dem Haus viel Glück. Vor Freude hätte ich am liebsten, stellvertretend für die ganze Welt, meinen neuen Vermieter umarmt.
Noch am selben Tag konnte ich mit Rays tatkräftiger Hilfe in das Haus einziehen. Er montierte Lampen, befestigte die Moskitonetze über den Betten, spannte die Leintücher über die Matratzen, die er zuvor ins Haus geschleppt hatte, während ich die Töpfe und das Geschirr einräumte. In kürzester Zeit war alles fertig. Wenn alles gut ging, sollten Manuel und die Kinder in drei Tagen da sein. Bis dahin kauften Ray und ich gemeinsam ein, ich kochte, er deckte den Tisch und wusch das Geschirr ab. Aaya hatte ein paar Tage frei genommen. Allein die Tatsache, dass Ray nach dem Abendessen in das Gästehaus ging, unterschied uns von einem Ehepaar, das seit dreißig Jahren verheiratet ist.
Der Tag kam, an dem Manuel und unsere beiden Töchter eintrafen. Ray und ich saßen gerade beim Abendessen. Ganz schwindelig vor Glück umarmte ich als Erstes die Kinder. Derweil machten sich der Hausherr und der Eindringling miteinander bekannt. Ray steuerte im allgemeinen Tumult der Wiedersehensfreude dem Tor zu, um einfach zu verschwinden. Ich eilte ihm hinterher und konnte wegen meiner eigenen Gemütsverfassung gar nicht nachempfinden, dass Ray traurig war, so traurig, dass er weinte. Wir umarmten uns kurz, und ich flüsterte ihm ins Ohr: „Danke für alles. Lass die Sonne nicht untergehen, Sunray.“