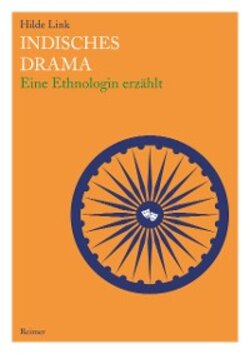Читать книгу Indisches Drama - Hilde Link - Страница 14
ОглавлениеEin Spinnennetz: Jeder Knoten eine Aufführung
Meine Erfahrung in Murukambakkam lehrte mich, dass ich einen Dolmetscher brauchte, der bereit war, mit mir auf die Dörfer zu fahren. Konrad, ohne den ich in diesem Land gar nicht lebensfähig gewesen wäre, kannte einen geeigneten Menschen an der Pondicherry University: Shivanandan. Dieser hatte in den USA seinen Doktor erworben, sprach also perfekt Englisch, und war Professor am Institut für Tamil-Studien, welches am Ende der Rue La Bourdonnais lag. Nichts wie hin. Konrad stellte mich vor. Herr Shivanandan, der einfach Shivan genannt werden wollte, war Anfang vierzig, ein freundlicher, charmanter und offensichtlich kompetenter Mann. Er war sofort bereit, mir zu helfen, nicht ahnend, was diese Zusage bedeuten würde: dreiundvierzig Nächte mit einer überforderten Europäerin auf einer Reisstrohmatte in Indiens Dörfern zubringen. Aber auch Shivan wusste nicht, wo Schauspieler zu finden waren. Ich machte den Vorschlag, doch einfach mal irgendwohin raus auf irgendein Dorf zu fahren und dort zu fragen, ob jemand was weiß. Die Idee fand Shivan gut. Wir verabredeten uns gleich für den übernächsten Tag, er wollte ein Taxi besorgen, Mietautos gibt es im Süden Indiens nicht, und mich abholen kommen.
Endlich! Shivan war, wie vereinbart, um zehn Uhr vormittags da, eilte mit einem kurzen Gruß auf die Veranda, und dann kam gleich die Überraschung: Der Taxifahrer stammte aus einem Dorf, ganz in der Nähe von Pondicherry, und dort wohnten Schauspieler. Meine Freude war verhalten, nach dem, was ich in Murukambakkam erlebt hatte. Für die große Reise hatte ich Wasser, Obst und Nüsse eingepackt und einen bunten Punjabi Dress angezogen, das ist eine Hose mit einem Kleid darüber und einem Schal. Von Saris hatte ich vorerst genug. Man lernt dazu.
Shivan war mit einer uralten, zerbeulten Schrottkarre gekommen, einem Hindustan Ambassador. Diese Autos werden in Indien nach der Vorlage des Morris Oxford Series III in Lizenz gebaut.
Es ist tatsächlich als eine unwiderlegbare Wahrheit festzuhalten, dass es auf diesem gesamten Globus nichts Unappetitlicheres gibt als ein indisches Taxi. Ich stieg ein und nahm auf der Rückbank Platz. Vorne saßen schon der Fahrer, Ganeshan, und ein junger Mann, dessen Aufgabe darin bestand, an Kreuzungen auszusteigen und regelnd in den chaotischen Verkehr einzugreifen. Abgestandener Schweißgeruch schlug mir entgegen. Die Rückbank war feucht. Dank des Drucks meines Körpergewichtes konnte sich der angestaute Uringeruch, der auf diesen Augenblick schon gewartet hatte, entfalten wie der freigelassene Flaschengeist. Der mit dunklem blumengemustertem Samt bezogene Sitz ließ nicht sofort erkennen, dass wohl schon so mancher Fahrgast, so vermutete ich mit meinem westlichen kulturellen Hintergrund, sich im Angesicht des Todes wähnend, sich vor Schreck in die Hose gemacht hatte. Im ersten Impuls wollte ich aufspringen und laut protestierend rufen, dass ich keinen Meter in diesem Gefährt zurücklegen werde. Aber da war Shivan schon eingestiegen, und der Geruch intensivierte sich. Soll doch er was sagen, schließlich hatte er das Taxi organisiert. Und außerdem wollte ich nicht gleich zum Auftakt unserer Zusammenarbeit die überkandidelte Zicke geben. Shivan sagte dem Fahrer, er könne losfahren. Vorsichtig fragte ich: „Riechst du das?“ Shivan bejahte und gab mir gleich die erste Lektion in indischer Kulturkunde:
„Wenn die indische Frau auf Reisen geht, dann trinkt sie vorher nichts, damit sie nicht den Fahrer bitten muss, mitten auf der Strecke anzuhalten. Das ist unanständig. Es geht einfach nicht, dass eine Frau sich in die Büsche schlägt. Lokale gibt es so gut wie keine am Straßenrand, und wenn, dann haben sie keine Toilette. Jetzt kommt es bei langen Reisen aber dennoch vor, dass auch eine indische Frau irgendwann mal muss. Und dann, naja...“
Schon wieder was gelernt.
„Was meinst du wohl“, ergänzte Shivan, „warum hier alles mit dickem Samtstoff bezogen ist.“
Ich verriet nicht, dass ich ganz ohne Arg dachte, das würde der indische Fahrgast vielleicht schön finden.
Wir fuhren also los, und ich bestand mit Nachdruck darauf, dass alle Fenster offenblieben. In der Nähe der ersten Kreuzung bückte sich Ganeshan, um die Handbremse mit einem Ruck anzuziehen. Instinktiv, eine Vollbremsung erwartend, hielt ich mich an der Rückenlehne des Vordersitzes fest, da, wo der Samt abgewetzt war. Aber nichts passierte. Das heißt, doch, der Wagen verlangsamte sich etwas, bis er schließlich genau an der Kreuzung ausrollte. Die Zehen von Ganeshans linkem Fuß, er fuhr ohne Schuhe, wie alle Taxifahrer, umklammerten das Kupplungspedal, während er dieses drückte, der rechte Fuß stand ruhig auf der Fußmatte.
„Shivan, das Auto hat keine Bremsen!“, rief ich erschrocken. Mein Mitreisender beruhigte mich:
„Keine Sorge, Ganeshan hat viel Erfahrung mit diesem Auto, er weiß genau, was er tut.“
„Und die Beulen?“, warf ich ein.
„Kleine Karambolagen, nichts weiter, das siehst du doch. Und außerdem: schau da.“
Shivan zeigte auf eine kleine Figur auf dem Armaturenbrett: Maria auf der Mondsichel. Sie stand direkt neben dem beigefarbenen Plastik-Elefantengott Ganesh. Eine Hibiskusblüte klemmte unter einem seiner vier Arme und welkte erwürgt vor sich hin. Eines der Blütenblätter verdeckte halb das Gesicht des Propheten, dessen Abbild zu den Füßen des Gottes klebte. Etwas abseits der Götterwelt gab eine orangefarbene Duft-Chemikalie, die in einem geriffelten Flakon vor sich hin schaukelte, mit ihrem beißenden Dampf ihr Bestes. Ich hielt den Schal vor Nase und Mund. Als Shivan mich irritiert anschaute, entfernte ich mein Schutzschild kurz, nickte lächelnd und sagte so überzeugend wie möglich: „Der Fahrtwind.“ Von der Landschaft bekam ich rein gar nichts mit. Vornübergebeugt, die Fingernägel in die Rücklehne des Vordersitzes gekrallt, beobachtete ich angestrengt die Straße mit all ihren Ochsenkarren, Hunden, Kühen, Enten, Hühnern, Fahrrädern, Menschen, Lastwagen und den anderen Ambassadors. Meine Mitreisenden nervte ich mit angstvollen „Careful!!! Careful!!!“ - Zwischenrufen. Immer dann, wenn ich die Situation als ganz besonders gefährlich einstufte, schickte ich nach „Careful!!!“ ein Stoßgebet zum Himmel. Eine Klosterschule geht nicht spurlos an einem vorüber, und Mater Ancilla, eine Nonne des Ordens der „Englischen Fräulein“, in München-Nymphenburg, und treue Magd des Herrn, meine Lateinlehrerin, hat immer gesagt, Stoßgebete sind die allerwirksamsten Gebete überhaupt, da kann nicht mal ein kompletter Rosenkranz mithalten, und im Krieg seien viele Soldaten wegen ihrer Stoßgebete gerettet worden. In der Gewissheit, dass meine Gebete, von wem auch immer, erhört werden, lehnte ich mich irgendwann zurück und schloss die Augen. Fahrgast sein in einem indischen Taxi ist anstrengend. Auf Kopfhöhe der hohen Rückenlehnen hinten zeugte eine glänzende Fettschicht davon, dass schon viele Menschen mit Kokosnussöl-gepflegten Haaren mitgefahren waren. Die Läuse der früheren Fahrgäste machten es sich auf meinem Kopf gemütlich (als ich dann zu Hause war auch auf den Köpfen der Kinder). Ganeshan steuerte das Gefährt mit großer Sicherheit und Weitblick durch die Landschaft; anstatt zu bremsen, wich er aus.
Das Dorf, in dem wir Schauspieler zu finden hofften, war natürlich nicht „ganz in der Nähe“, sondern nach mehrstündiger Fahrt immer noch nicht in Sicht. Nach einer halben Stunde Hauptstraße bogen wir ab und fuhren auf endlosen einspurigen Wegen dahin. Die Hitze und der Gestank im Auto waren wegen der langsamen Fahrt und des damit verbundenen Mangels an frischer Luft eine ausgesprochen unglückselige Verbindung eingegangen. Hielt ich den Schal vor Mund und Nase, wurde mir wegen Sauerstoffmangels schwindelig. Atmete ich ganz normal, wurde mir ebenfalls schwindelig. In kurzen Abständen ließ ich anhalten. Sollten die doch denken, was sie wollten, schließlich war ich keine indische Frau. Abseits des Autos setzte ich mich auf die heiße Erde, sobald Schlangen, Skorpione und sonstiges Getier Reißaus genommen hatten, und genoss für ein paar Minuten die grandiosen Aussichten auf das weite, flache Tamil-Land mit seiner roten Erde. Ich nahm mir vor, einen Bildband herauszugeben mit dem Titel: „Die schönsten Pinkelplätze Südindiens.“
Irgendwann am Nachmittag waren wir in der Nähe von Kanchipuram, mitten in der Pampa. Shivan machte den Vorschlag, wir sollten einkehren. Geschickt steuerte Ganeshan das Gefährt in die Nähe eines Tempels, wo unter einem Palmblatt-Verschlag Bananenblätter mit einem scharfen Reisgericht für ausgehungerte Pilgerreisende dargeboten wurden. In meiner Kultur isst man nicht mit den Fingern, und so stellte ich mich wegen mangelnder Übung dementsprechend dämlich an. Aber immerhin war es mir gelungen, den einen oder anderen Happen des Spinat-artigen Gemüsereises außer auf meinen Punjabi Dress und den Tisch auch in den Mund zu befördern. Die Speise war höllenscharf, was mir egal war, Hauptsache überhaupt was zu essen. Endlich hatte ich alles brav aufgegessen, meine Mutter wäre stolz auf mich gewesen, da kam ein alter Mann mit einem Kübel und schüttete mit Hilfe einer halben Kokosnussschale Rasam, das ist eine Art klare Suppe, auf das Bananenblatt. Dieses scharfe Gewürzwasser wird zusammen mit den restlichen Reiskörnern des Hauptgerichtes mit der flachen Hand verrührt, die Finger werden zu einer Art Löffel geformt, und schon kann der Tamile (die Tamilin natürlich auch) die Brühe mit lautem Schlürfen zu sich nehmen. Die Sache war mir keinen Versuch wert. Nicht dass ich etwa anderen Kulturen unaufgeschlossen gegenüberstehen würde, sowas darf man von mir nicht denken, aber ich habe mich über all die Jahre hindurch, die ich noch in Indien arbeiten sollte, konsequent geweigert, mir diese Tischsitte anzueignen, nämlich mit den Fingern Suppe zu essen, nachdem man zuvor die ganze Hand darin gebadet hat. Den linken Ellbogen auf den Tisch zu stemmen und die linke Hand lässig herabhängen zu lassen hingegen schon. So kommt man nicht in Versuchung, mit der linken, der unreinen Hand (Toilettenpapier ist in Indien unhygienisch) Nahrungsmittel zu berühren. Wie oft musste ich meine Kinder bei Einladungen in Indien ermahnen: „Ellbogen auf den Tisch!“
In den restlichen zwanzig Minuten der Fahrt, Essen stärkt ja bekanntlich die Nerven, rief ich nur noch ab und zu „Careful!!!“ Dem Ziel nahe, quälte ich mich mit dem Gedanken, von dem wohl jeder Ethnologe zu Beginn seiner Arbeit „im Feld“ geplagt wird, nämlich: Wie werde ich aufgenommen? Wollen die Leute mich überhaupt dabeihaben? Werden sie mich als Eindringling sehen? Nehme ich womöglich Einfluss auf das kulturelle Geschehen? – Das schlimmste Verbrechen, dessen sich ein Ethnologe schuldig machen kann. Verändere ich gar allein durch meine Anwesenheit den Ablauf der Dramen? Was übrigens, dies sei schon jetzt gesagt, so war: Die Darsteller erfanden originelle Einlagen, in denen eine weiße Frau mit Kladde unruhig auf ihrer Sitzmatte herumzappelt, weil ihr dauernd die Beine einschlafen, die mit der Videokamera nicht zurechtkommt und die immerzu Tee trinkt, um wach zu bleiben. Ganzen Dörfern bleibe ich in lustiger Erinnerung. Man gibt ja gerne was zurück, wenn man was bekommt. Auf eine Gabe folgt eine Gegengabe.
Shivans Ankündigung, dass wir gleich da seien, ließ mich nervös in meiner Tasche kramen und die fertig frankierten, mit meiner Adresse beschrifteten Postkarten suchen. Waren sie auch wirklich dabei? Werden die Schauspieler sie überhaupt annehmen, Ort und Datum ihrer Vorführungen darauf notieren und die Nachricht an mich schicken? Werden sie die Karten auch an ihre Kollegen verteilen? Vor meinen Augen sah ich ein Netz, ein Spinnennetz, gesponnen von den Schauspielern, jeder Knoten eine Aufführung.
Aus lauter Angst vor einer Abweisung konnte ich mich kaum noch auf den Verkehr konzentrieren. Offensichtlich lässt die menschliche Psyche nicht mehrere Ängste gleichzeitig zu und setzt automatisch Prioritäten. Der Straßenverkehr war mir plötzlich egal.
Ganeshan bog beherzt, ohne die Handbremse zu ziehen – er hatte den Wagen wirklich voll im Griff –, von der einspurigen „Hauptstraße“ in eine sandige Nebenstraße und ließ das Auto genau vor dem Haus ausrollen, in dem seine Schauspielerbekannten wohnten. Vor lauter Aufregung hatte ich feuchte Hände. Wie gut, dass man sich in Indien nicht die Hand gibt. Drei ernst dreinblickende Männer in Lunghi und Unterhemd kamen auf das Auto zu und falteten die Hände vor der Brust zum Gruße. Wir befreiten uns aus den klebrigen Sitzen und grüßten ebenso. Ganeshan stellte uns die Schauspieler Dakshinamurti, Devan und Babu vor und beteuerte ihnen eifrig, dass wir ungeheuer bedeutende und wichtige Leute von der Universität seien und dass diese weiße Frau da extra ihretwegen angereist sei, aus einem Land weit, weit weg. Die Männer musterten mich aufmerksam. Ich glaube, sie wussten nicht so recht, was sie von dem Ganzen halten sollten. Mein bettelnder Blick, am liebsten hätte ich wie ein Kleinkind, das Schokolade will, „bitte, bitte“ gesagt, schien sie dazu zu bewegen, mich zu empfangen und uns sogar zu einem Tee einzuladen. Ganeshan hatte seine Mission erfüllt und verschwand mit dem Beifahrer im Nachbarhaus bei seinen Verwandten.
Wir stellten unsere Schuhe draußen ab und betraten den kleinen Vorraum des traditionell gebauten Hauses mit einem Innenhof. Eine ältere Frau im einfarbigen, dunkelgrünen Sari mit schmaler Goldborte begrüßte uns freundlich. Sie hieß Kamala und war, so würde man das bei uns etwas altmodisch sagen, die Dame des Hauses. Ihre schwarzen Haare hatte sie zu einem strengen Knoten zusammengebunden und mit Jasminblüten geschmückt. An den zahlreichen Armreifen, den schweren Ohrsteckern, dem fein gearbeiteten Nasenschmuck, alles aus Gold, konnte ich sehen, dass Kamalas Eltern ihr eine ordentliche Mitgift gegeben hatten und dass ihr Mann, der offensichtlich lebte, diese nicht versoffen hatte.
Man hört und liest immer wieder, die indische Frau habe nichts zu sagen und sei dem Mann untertan. Das stimmt zwar in der Regel für junge, verheiratete Frauen, nicht aber für ältere Frauen mit Söhnen, denn diese genießen ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Das Problem ist, dass es nur wenige Frauen bis zu dieser Lebensphase schaffen. Mädchen werden oft schon nach der Geburt umgebracht oder bei Krankheit vernachlässigt, weil ihr Vater schon zu diesem Zeitpunkt weiß, dass er eine Mitgift nicht wird aufbringen können.
Frau Kamala jedenfalls hatte es geschafft – fünf Söhne sind eine sichere Kletterhilfe –, den Gipfel des sozialen Ansehens zu erklimmen. Sie begleitete uns in den Atrium-Innenhof des Hauses. Es war relativ kühl unter dem von geschnitzten Holzsäulen gehaltenen Ziegeldach, das wie der Kreuzgang eines Klosters den besonnten, freien Innenhof umgab. Wir wurden gebeten, auf Eisenstühlen Platz zu nehmen. Eine junge Frau mit duftenden Jasminblüten im hüftlangen Zopf und grell-buntem, blau-rosafarbenen Blumensari, vermutlich eine von Frau Kamalas Schwiegertöchtern, brachte uns Tee. Mit anmutigen Bewegungen stellte sie die Edelstahlbecher auf dem Holztisch ab, lächelte freundlich und ging. Die drei Schauspieler setzten sich zu Shivan und mir, Frau Kamala blieb stehen und wollte wissen, ob ich Söhne hätte. „Zwei Töchter!“, sagte ich mit dem Stolz der Mutter, woraufhin mir Frau Kamala ihr tiefstes Beileid bekundete und mich mit einem mitfühlenden Blick bedachte, bevor sie sich diskret zurückzog. Kinder scharten sich um unseren Tisch, beobachteten uns neugierig und kicherten verlegen.
Die drei Schauspieler, der schöne Dakshinamurti, der ernste Devan und der süße Babu, überprüften mit den Handflächen ihre lockeren Haarknoten und machten sich bereit zu erfahren, was denn ihre Gäste nun genau wollten. Shivan erklärte ausführlich unser Anliegen. Devan und Dakshinamurti betrachteten mich mit ernster Miene und wiegten wohlwollend den Kopf hin und her zum Zeichen, dass sie verstanden hatten. Babu wollte gefallen, legte seinen Kopf keck in den Nacken und öffnete seinen Haarknoten. Die schwarzen Haare fielen ihm über die Schultern, und er frisierte sie mit seinen langen, knallrot lackierten Fingernägeln und anmutigem Schwung. Also er, Babu, fände es ja supertoll, unterbrach er Shivan, wenn ich ihn filmen würde. Schließlich habe er die wichtigsten Rollen, er spiele nämlich Göttinnen. Die anderen Darsteller dürfe ich natürlich auch filmen. Die Filmgöttin stand auf und tanzte sich wiegend und drehend vor unseren Augen, wohl wissend um ihre anmutige Eleganz. Schön, wirklich sehr schön. Spontan wollte ich klatschen, hielt mich aber zurück. Womöglich hat Klatschen irgendeine mir unbekannte rituelle Bedeutung. Lieber auf der Hut sein in einer Kultur, die man nicht kennt. Ein anerkennendes Lächeln musste genügen. Das ist überkulturell und wird weltweit verstanden. Jetzt tauten auch Devan und Dakshinamurti auf und erzählten, dass sie in der Saison, März/April bis Juli, dann, wenn es so richtig heiß ist, ihre Dramen aufführen würden. Hauptsächlich die großen Epen Mahabharata und Ramayana, das ist die Geschichte vom Prinzen Rama, der schönen Sita und dem Großen Affen Hanuman. Ich sei herzlich willkommen, dabei zu sein. Immer gegen zehn Uhr abends gehe es los bis morgens etwa um sechs oder sieben Uhr. Ach, du meine Güte! Doch nicht etwa die gesamte liebe lange Nacht lang.
„Und tagsüber?“, versuchte ich schon im Vorfeld meinen Schlaf zu retten, „gibt es auch Aufführungen am Tag?“
„Theaterstücke nicht, aber Rituale manchmal am Morgen nach den Aufführungen. Feuerläufe zum Beispiel.“
Hach, das versprach aufregend zu werden.
„Und ich darf wirklich kommen, mit meiner Videokamera, mit meinem Fotoapparat und meinem Tonbandgerät und alles dokumentieren?“, vergewisserte ich mich.
„Welcome! Welcome!“, rief Babu begeistert, die beiden anderen sagten einfach ja.
Jetzt war der richtige Zeitpunkt für meine Postkarten. Ich legte einen Stapel auf den Tisch und erklärte das System. Gerne, sehr gerne würden sie die Karten weitergeben.
„Es dauert noch einige Zeit, bis die Saison losgeht. Aber Sie brauchen sicherlich nicht so lange zu warten. Irgendwer stirbt immer, und dann führen wir ein Karna Moksha [Karnas Befreiung] auf. Karna kennen Sie?“, fragte Devan.
„Ja, ja, Karna, natürlich weiß ich, wer Karna ist“, sagte ich im Ton des Insiders.
Im Geiste hatte ich Johannas Bilderbuch vor Augen: Karna, seinem in der Gegenpartei kämpfenden Halbbruder Arjuna den Rücken zuwendend, versucht verzweifelt, das Rad seines Kampfwagens aus dem Schlamm zu befreien. In dem Moment schießt Arjuna den tödlichen Pfeil auf ihn ab, und der Krieg ist zugunsten der fünf Pandavas, von denen Arjuna einer ist, entschieden.
Dakshinamurti, offensichtlich der Chef der Truppe, stand unvermittelt auf, ich erhob mich ebenfalls in Erwartung eines: „Goodbye“ oder eines „Gehen Sie und kommen Sie wieder.“ Inzwischen war ich aufgrund meiner unglückseligen Erfahrungen mit Beamten schon auf Rausschmiss konditioniert. Zu meinem Erstaunen bat mich Dakshinamurti mitzukommen. In einem fensterlosen Raum knipste er das Licht an. Auf dem Boden stand eine große Truhe. In der befanden sich bunte Röcke, glitzernde Hosen, Schminke und Kämme, Kopfschmuck aus Holz und Federn, Pfeil und Bogen, Halsketten, Plastik-Armreifen in allen Farben, Tücher. Sorgfältig nahm Dakshinamurti einen Gegenstand nach dem anderen heraus und legte ihn auf den Boden. Ich stand da in andächtigem Staunen und war nur noch glücklich, erleichtert, dankbar, froh. Mir war klar, dass Dakshinamurti mir ein Tor zu seiner Welt geöffnet und mich gebeten hatte einzutreten. Er hatte ja auch versprochen, die Postkarten an seine Kollegen weiterzugeben. Meine Rechnung wird aufgehen: Wenn ich den ersten Schauspieler gefunden habe, dann werde ich alle anderen auch kennenlernen. Mir wurde erlaubt, Notizen zu machen und Skizzen anzufertigen. Ich setzte mich auf den Boden und arbeitete mit Sorgfalt an meiner ersten Aufgabe in Indien, die nicht in irgendeiner Weise sinnlos, uneffektiv und vergeblich war.
Inzwischen war es schon dunkel geworden, und Shivan motivierte Ganeshan und seinen Begleiter im Nachbarhaus zur Heimfahrt. Vor Mrs. Kamalas Haus hatte sich zum Abschied die gesamte Familie versammelt, gut und gerne an die dreißig Personen. Mrs. Kamala kam mit einem kleinen Behältnis, in dem sich ein rotes Pulver befand. Vorsichtig streute sie mir etwas davon in den Scheitel und sprach Segenswünsche für meinen Mann. Die Götter mögen ihn behüten, er möge lange leben. Genau genommen galt der Segen mir, denn wenn der Mann stirbt, dann bin ich, in Kamalas Weltbild, erledigt. Ich finde, dieses Ritual hat was von Frauensolidarität.
Das ist immer wieder erstaunlich festzustellen, wie normal doch in kürzester Zeit zunächst absonderliche Dinge werden. Auf der Heimfahrt rief ich kein einziges Mal „Careful!“ und störte mich auch nicht mehr daran, dass unser Taxi keine Bremsen hatte. Das fehlende Scheinwerferlicht nahm ich einfach zur Kenntnis. In Unabänderliches muss man sich fügen. Ein kleines Gebet mit einem Appell an meinen Schutzengel zu Beginn der Reise ersetzte die zahlreichen Stoßgebete unterwegs. Ich konnte entspannt mit Shivan plaudern.