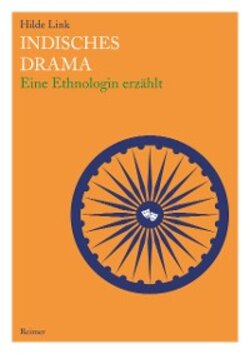Читать книгу Indisches Drama - Hilde Link - Страница 13
ОглавлениеDer Beseitiger aller Hindernisse
Wie das so ist, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat, sind die ersten vier Tage und Nächte immer voll des reinen Glücks. Zwar waren Manuel, die Kinder und ich nur insgesamt zehn Tage voneinander getrennt, aber trotzdem. Es waren uns vier Tage vergönnt, in denen alles, aber auch alles, wunderbar war.
Die Kinder tanzten in der großen Halle herum und sangen dazu Lieder, die man ihnen in der Waldorfschule reichlich beigebracht hatte, sie bastelten mit Naturmaterialien, die sie im Garten fanden. Entzückend! Manuel und ich tranken Unmengen von Tee und wurden nicht müde, die kleinen Kunstwerke unserer Töchter und das herrliche Haus zu bewundern und unserem Gott zu danken, dass er alles so wunderbar gefügt hatte.
Zwischen zwei Teepausen präsentierten wir uns unserem Nachbarn, Herrn Shubash, als die nette Familie von nebenan. „Shubash“ heißt auf Sanskrit „der Gute“. Nomen est Omen, und deshalb würde ich persönlich so nicht heißen wollen, denn immerzu gut sein müssen wäre mir zu anstrengend. Herr Shubash war einer der wunderbarsten Menschen, denen ich in meinem Leben je begegnet bin. Er war von einer Gelassenheit, einer Freude, einer Ruhe, einer Spiritualität, ach was soll ich sagen! An einem Nachmittag zeigte uns Herr Shubash, was er in der anderen Haushälfte macht: Er kreierte auf kostbaren weißen Seidensaris Designs mit Blüten und Blättern, die durch bestimmte Techniken und Farben die wunderschönsten Muster ergaben. Manuel war begeistert, geradezu ergriffen, wie ein Mensch sein Leben so ausschließlich und bedingungslos der Kunst widmet. Bestimmt hatte Herr Shubash bei seinem Aufnahmegespräch in den Ashram gesagt, dass er unter keinen Umständen Saris gestalten wolle.
Nach einer Woche begann Aaya ihren Dienst. An diesem Tag erlitt ich einen Schock. Dieser bestand darin, dass ich rein gar nichts von dem verstand, was sie sagte. Zuerst dachte ich noch, naja, jemand der aus dem Slum kommt, der spricht eben einen unverständlichen Dialekt. Das allein ist ja noch nicht schlimm und bewegt sich im Rahmen des Normalen. Allerdings war ich blitzschnell zu der Erkenntnis gelangt, und das ist der eigentliche Schock, dass ich einfach rein gar nichts konnte, außer „vanakkam“ (guten Tag, willkommen) sagen, und das, obwohl ich eifrig zwei Semester am Institut für Indologie und Iranistik in München Tamil gelernt zu haben glaubte.
Wer in der Ethnologie einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ein Projekt im Ausland stellt, muss nachweisen, dass er die entsprechende Verkehrssprache kann. Logisch. Schließlich will man sich ja mit den Leuten unterhalten können und in meinem Falle sogar ganze Schauspiele kapieren. Also belegte ich einen Tamil-Kurs bei Herrn Dr. Huber. Schon nach zwei Unterrichtsstunden war ich seine einzige Schülerin, die anderen beiden lernten lieber Tibeti, das Herr Huber auch unterrichtet hat, ebenso wie Sanskrit, Nepali und Hindi. Herr Huber hatte ein Hobby, dem er sich mit großer Hingabe in jeder freien Minute gewidmet hat, nämlich Tamil. Diese Sprache ist selbst für einen außergewöhnlich Sprachbegabten, der Herr Huber zweifelsohne ist, eine Herausforderung. Denn Tamil ist eine drawidische Sprache und nur etwas für masochistisch veranlagte Linguisten. Herr Huber fühlte sich zu ihr hingezogen. Er kam aus Dresden und hatte selbst nie Tamil mit einem Lehrer gelernt, geschweige denn je jemanden in dieser Sprache sprechen hören. Gemeinsam mit seinem Russisch-Tamil/Tamil-Russisch-Lexikon arbeitete er sich wacker durch die Lektionen seines englischsprachigen Lehrbuchs, das er seinerzeit auf einem Flohmarkt erworben hatte. Ich wusste zwar, das hatte er mir ganz klar gesagt, dass zwischen dem literarischen und dem gesprochenen Tamil ein Unterschied besteht, aber ich dachte mir, ach was, der wird schlimmstenfalls so sein wie zwischen Latein und Italienisch. Wer Latein kann, versteht auch Italienisch, was ja so etwas wie ein verdorbenes Latein ist, wie mein Doktorvater, Prof. Vajda, immer sagte.
Immer am Freitagnachmittag um drei, sowohl Herr Huber als auch ich waren bereits in Feierabend-Stimmung, machten wir uns im Münchener Institut für Indologie fröhlich ans Werk. Der Kurs begann deshalb um drei Uhr, weil mein Lehrer da sein Schönheitsschläfchen beendet hatte. Zu diesem Zweck hatte er ein Sofa im Zimmer mit einem flauschigen Kissen und einer warmen Wolldecke. Ich sollte ihn dann immer aufwecken, wenn ich kam. Also jeweils freitags um drei klopfte ich vorsichtig an seine Bürotür, damit er nicht aus seinen Träumen aufschrecken musste, und rief erst leise, dann immer lauter seinen Namen, bis ein langgezogenes „jaaaaa, kommen Sie herein“ ertönte. Beim Betreten des Zimmers hatte sich Herr Huber schon in die Sitzhaltung hochgerappelt und tastete mit den Füßen nach seinen braunbeige- karierten Filzschlappen und mit den Händen nach seiner Brille. Der von seiner Frau selbst gestrickte Pullunder korrelierte farblich mit den Schuhen. Die Kekse hatte Herr Huber schon in einer hübschen Schale auf dem Tisch stehen, meist brachte ich noch Schokolade mit, der Teekocher wurde angeschmissen. Bald duftete es nach wunderbarem Darjeeling, den mein Lehrer in einer komplizierten Zeremonie zubereitet hatte. Teebeutel waren für ihn Barbarei. Es konnte losgehen. Ich lernte lesen und schreiben, die Tamil-Sprache hat über zweihundert Zeichen, für das Sprechen behalfen wir uns mit dem, was da stand. Herr Huber wurde nicht müde zu beteuern, dass er selbst Autodidakt sei. Er war dem, was wir im Unterricht durchnahmen, immer ein oder zwei Kapitel voraus. Bei Kapitel sechsunddreißig war dann Herr Huber mit seinem Latein, bzw. seinem Tamil, am Ende. Und ich somit automatisch auch.
Es war Aaya, die mich in Verzweiflungszustände hineinmanövriert hat, um jetzt wieder auf meinen Schock zu sprechen zu kommen. Hatte ich denn nicht ein Jahr lang, jeden Tag, den der Herr werden ließ, nach dem Frühstück eine Stunde lang, sozusagen als Morgenmeditation, eifrig und geradezu mit Hingabe – ja, das muss man so sagen, mit Hingabe – mich dieser Sprache gewidmet? Und jetzt sagt Aaya was zu mir und ich stehe da und schaue dumm. Umgekehrt verstand Aaya außer „vanakkam“ von mir kein einziges Wort, und wenn ich es noch so schön aussprach. Es war zum Haare-Raufen. Mit sechsunddreißig Lektionen sollte man sich doch wohl wenigstens rudimentär verständigen können. Ich begriff, dass mit meinem Spracherwerb irgendwas fundamental schiefgelaufen war, und ich vertraute mich Konrad an. Er musste sich zusammenreißen, um nicht laut über meine Naivität zu lachen.
„Gesprochenes Tamil und literarisches Tamil, Hilde, das sind zwei ganz verschiedene Dinge“, klärte er mich auf.
Ach nee, das immerhin hatte ich auch schon kapiert. So lernte ich bei Herrn Huber, nur um ein Beispiel zu nennen, für die Zahl zwei „irantu“ zu sagen, denn so schreibt man das Wort. Aber man spricht „rende“. Schon ein kleiner Unterschied.
Mir war klar, dass ich erst einmal anständig Tamil lernen musste. Konrad bot mir an, mein neuer Lehrer zu sein, und kam regelmäßig zum Unterricht ins Haus. Selbst als er später, zurück in Heidelberg, am Südasien-Institut lehrte, fuhr ich zwei Jahre lang, DFG-finanziert, jeden Mittwoch von München mit dem Zug nach Heidelberg in der Hoffnung, irgendwann einmal mit diesem Horror von Sprache auf einen grünen Zweig zu kommen. Zu meinem größten Bedauern ist dieser Zweig aber nie ganz grün geworden, schöne Blüten sind mir bis heute nicht vergönnt.
Ich war froh, dass Konrad jeden Tag kam, um mir Tamil beizubringen. So gut es meine Begriffsstutzigkeit zuließ, lernte ich eifrig. Das gab meinem Leben vorerst einen beruflichen Sinn. Nichtsdestotrotz schlichen sich zaghaft Erinnerungen ein, weswegen ich eigentlich hergekommen war. Manuel ging es auch nicht viel anders. Weder er noch ich hatten irgendeine Ahnung, wo wir anfangen sollten.
Wenigstens über die schulische Zukunft der Kinder brauchten wir uns keine Sorgen zu machen. Lena wäre in Deutschland in die erste Klasse gekommen. Wir trauten uns zu, ihr die Grundlagen von Lesen, Schreiben und Rechnen selbst vermitteln zu können. Eurythmie fiel allerdings erstmal flach. Immerhin, Wachsmalkreiden waren dabei. Lena hat ihre Schulzeit in Deutschland dann einfach mit der zweiten Klasse begonnen. Johanna war bei unserer Abreise schon in der vierten Klasse. Waldorflehrer im Allgemeinen sind engagiert, Johannas Lehrerin war es ganz besonders. Mit ihr hatten wir vereinbart, dass meine Mutter einmal im Monat in die Schule fährt, alle Arbeitsunterlagen abholt und uns diese nach Indien schickt. Jede Woche wurde einem anderen Kind die Aufgabe zugeteilt, für Johanna mitzuschreiben, und einmal im Monat schrieben alle zweiunddreißig Kinder in der Klasse einen Brief, in dem stand, was sie besonders bewegt hatte. Natürlich sollte auch Johanna über ihre Erlebnisse in Indien berichten. Ihre Briefe wurden in der Klasse vorgelesen. Das hat dann auch alles funktioniert, und so ist Johanna integriert geblieben. Bei ihrer Rückkehr war alles so, als wäre sie nie weg gewesen.
Den Tagen des Glücks folgten Tage der Ratlosigkeit und der Verwirrung. Wir werkelten im Garten und im Haus herum. Mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit und Mühe, viele Stunden waren totgeschlagen, wurde in einer Ecke ein kleines Regal für den brokatgewandeten lockigen Rauschgold- Schutzengel mit den goldenen Flügeln befestigt, den meine Mutter Manuel mitgegeben hatte. Kaum war unser Hausaltar fertig, kniete Aaya schon davor und betete. In Pondicherry leben vierzig Prozent Christen. Aaya, die Germaine (sprich „Dschärman“, Betonung auf ä), die Deutsche, hieß, war eine von ihnen. Sie war fromm und gottesfürchtig. Wir zeigten Aaya, dass wir unter dem Deckchen, auf dem der Engel stand, Geld, Pass und Papiere, darunter auch die inzwischen ungültig gewordene Aufenthaltsgenehmigung, deponiert hatten. Nicht dass sie beim Putzen versehentlich das Versteck entdeckte. Mit einer pantomimischen Darbietung, meine neu erworbenen Sprachkenntnisse ließen noch nichts anderes zu, machte ich Aaya klar, dass sie und ihre Kinder und Enkelkinder für ewig in der Hölle schmoren würden, sollte etwas fehlen. Bereits im Paradies angekommene Vorfahren würde der Höchste Herr persönlich verstoßen, so wie er es damals mit Luzifer getan hatte, der dann, wie sie ja weiß, zum Teufel geworden ist. Das Depot war sicherer als jeder Tresor.
Wie gut, dass wir die Kinder hatten. Sie waren der Grund, so redeten wir uns das ein, dass wir beruflich nichts zustande brachten. Gute Eltern kümmern sich. Manuel war vorerst der einzige Spielkamerad und baute mit ihnen im Garten Erdburgen, spielte Fangen, soweit es seine Puste zuließ, oder Verstecken. Ich tat etwas für die Bildung, erwarb das gesamte große Epos Mahabharata, da geht es um einen Erbfolgekrieg, und das Ramayana, eine Liebesgeschichte, als mehrbändige Kinderbücher mit grell-farbigen Abbildungen. Als Gute-Nacht-Geschichten las ich den Kindern in englischer Sprache einzelne Episoden vor und erklärte, was sie nicht verstanden hatten. Noch heute kennen sie die beiden Epen in- und auswendig. Johanna, die später Indologie, Ethnologie und Vergleichende Religionswissenschaften studierte, hatte noch in ihrer Studienzeit die bunten Bilder vor Augen. Allerdings hatten sich zwischen Manuel und mir Meinungsverschiedenheiten aufgetan. Er fand nämlich, dass das Mahabharata zu grausam ist für zarte Kinderseelchen. Vor allem die Geschichte von Hidimba, dem Dämon, der gerne Blut trank und Menschenfleisch verzehrte und der mit blutigen Fangzähnen abgebildet war, sollte ich unter keinen Umständen vorlesen, schon gleich gar nicht die entsprechende Abbildung zeigen. Das würde Albträume auslösen, an deren Folgen die Kinder für immer ein Trauma davontragen würden. Künstler sind sensibel. Ich hingegen war der Ansicht, das Mahabharata ist, wie es ist, und da kommt eben Hidimba drin vor, und man darf nicht eigenmächtig an jahrtausendealten indischen Traditionen herummurksen, indem man einfach das weglässt, was man aus ethnozentristischer Sicht für didaktisch unpassend hält. Ich würde schließlich auch nicht sagen, dass das Fangen-Spielen bei den Kindern einen Erschöpfungszustand hervorruft, der im Alter dann die Ursache für einen Herzinfarkt ist.
Manuel und ich versuchten verzweifelt, in diesem Land beruflich irgendwie Fuß zu fassen. Zwar hatte Manuel begonnen, alle möglichen Künstler- Kollegen anzuschreiben, weil er vorhatte, ein internationales Symposion zu organisieren, auch zum Deutschen Generalkonsulat hatte er Kontakt wegen einer Finanzierung aufgenommen, aber bisher hatte noch niemand geantwortet. Kein Wunder, der Briefträger konnte nicht lesen und stellte, wenn überhaupt, nur zu, was schön und deutlich auf Tamil aufgemalt war. Ach, wären wir doch nie hierhergekommen. Ich fragte Aaya, ob sie mir helfen könne, wen zu finden, der etwas mit Straßentheater zu tun hat. Sie versprach, sich umzuhören.
Um mich theoretisch auf meine Aufgabe vorzubereiten, ging ich in die École Française d’Extrème-Orient in der Rue Dumas. Das im französischen Kolonialstil gebaute Gebäude ist inzwischen Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Für einen Wissenschaftler ist diese Institution ein Traum. Kein Buch zu meinem Forschungsvorhaben, das nicht da war. Ich traute meinen Augen nicht, welche Raritäten sich vor mir auftaten. Als Erstes wies mir der Direktor, dem ich mich vorgestellt hatte, einen eigenen Arbeitsplatz zu. Auf einem riesigen Teakholztisch fanden sich schon am nächsten Tag alle bestellten Bücher, die der Bibliothekar für mich herausgesucht hatte. Kopien wurden selbstverständlich gemacht, ich brauchte nur die entsprechenden Seitenzahlen zu notieren. Das ist nicht so wie in der Bayerischen Staatsbibliothek, wo man mehr mit Suchen, Bestellen, Kopieren und Abholen beschäftigt ist als mit Lesen. Ich liebte es, mich in der Stille meines Arbeitsraumes aufzuhalten. Der Duft von Neem-Öl, mit dem die alten Palmblatt-Handschriften eingelassen werden, um sie zu konservieren, verursachte in mir fast ein Gefühl der Andacht. Erst einmal war ich damit beschäftigt, in diesem Eldorado all das zu lesen und mir zu erarbeiten, was ich für meine praktische Arbeit auf den Dörfern brauchen würde.
Die Kinder fingen an, sich zu langweilen. Manuel meinte, man müsse für sie Tiere anschaffen. Für bunte Fische wurde ein Aquarium auf der Terrasse platziert, für Trick und Track, zwei Enten, ein Teich im Garten angelegt. Die dicke Katze Anjimaniku, die zum Haus dazu gehörte, hatte Gesellschaft. Der Name der Katze bedeutet „um fünf Uhr“. Zu dieser Uhrzeit war sie damals bei Rebecca eines schönen Tages aufgetaucht. So etwas wie Alltag war eingezogen. Manuel und ich wechselten uns mit der Kinderbetreuung ab. Bald hatte sich in der Straße herumgesprochen, dass zwei weiße Mädchen hergezogen waren, und Johanna und Lena bekamen regelmäßig Besuch von indischen Kindern aus der Nachbarschaft. Eines der Mädchen war Rani, „die Königin“. Rani tauchte schon am frühen Morgen vor der Schule auf, weil es bei uns Reisbrei mit Milch zum Frühstück gab. Nach der Schule kam sie zum Mittagessen und blieb bis zum Abend, außer sie hatte am Nachmittag Unterricht. Ganz unbemerkt wurde Rani Teil unserer Familie.
Eines Tages machte mir Aaya klar, dass sie fündig geworden sei. Ein Freund von ihrem Mann, auch ein Riksha-Fahrer, kannte einen Schauspieler in einem Dorf. „Going native“ ist unter Ethnologen verpönt, aber Aaya wollte mir den Ort nur verraten, wenn ich bereit wäre, beim Besuch einen Sari zu tragen. Also zog ich los und erstand einen für meine Begriffe wunderschönen weißen Baumwollsari mit zarter taubenblauer, fast grauer Blütenborte. Ich hatte an was Dezentes gedacht, an sowas wie in unserer Kultur das „kleine Schwarze“. Am Nachmittag, bevor ich mich mit meinem neu angeschafften Fahrrad auf den Weg machen wollte, bat ich Aaya, mir beim Ankleiden zu helfen. Einen Sari anziehen ist nicht ganz einfach. Ohne einen für mich ersichtlichen Grund war Aaya entsetzt und sträubte sich, mir zur Hand zu gehen. Sie wiederholte mehrere Male ein Wort, das ich noch nicht kannte. Das war mir, ehrlich gesagt, auch egal, ich wollte ja den Sari anziehen und nicht Tamil lernen. Das Wort hieß „Witwe“.
In Indien bringen Witwen anderen Menschen Unglück. Und zwar deshalb, weil es die Schuld der Frau ist, wenn der Ehemann stirbt. Ganz einfach. Hätte sie sich ausreichend gekümmert, wäre der Mann ja wohl noch am Leben. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit hat man auf den Dörfern in Südindien zur Verbrennung des Leichnams eines Ehemannes eine Grube ausgehoben. Sobald das Feuer loderte, stieß man die Ehefrau hinein. Die meisten Frauen wollten nämlich nicht freiwillig ihrem Mann in die nächste Wiedergeburt oder in die endgültige Befreiung, Moksha, folgen. Heutzutage müssen Witwen wenigstens kenntlich gemacht werden, damit man sich vor ihnen in Acht nehmen kann, nicht dass einem noch was Schlimmes widerfährt. Zwar kannte ich die Bedeutung des weißen Saris, aber ich kam wegen der schönen Borte nicht auf die Idee, dass dieses Kleidungstück dennoch für Witwen gemacht war. Zu allem Überfluss trug ich, außer meinem Ehering, keinerlei Schmuck. Witwen dürfen sich nicht schmücken, und die Symbolik eines Eherings kennt ein indischer Mensch auf dem Dorf nicht. Ich war also, wenn man so will, mit weißem Sari und Ehering ein interkultureller Widerspruch.
Aaya hatte mir versichert, dass das Dorf Murukambakkam in Fußnähe zur Rue La Bourdonnais liege. Es gab keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie die Unwahrheit sprach. Ich solle einfach auf die Hauptstraße Richtung Cuddalore fahren, dann komme es gleich. Also brach ich gemütlich am Nachmittag mit meinem Fahrrad auf und strampelte los in die Richtung, die mir Aaya beschrieben hatte. Nun ist es aber so, dass ich damals eine sehr wichtige Erfahrung noch nicht gemacht hatte. Nämlich dass „Fußnähe“ oder „walking distance“ für einen verweichlichten Europäer etwas anderes bedeutet als für einen strammen Inder. Nach etwa einer halben Stunde hatte ich die Hauptstraße nach Cuddalore erreicht. Ich fuhr und fuhr und fuhr immerzu, aber der Ort kam und kam nicht. Jeder, den ich fragte, versicherte mir, dass ich auf dem richtigen Weg sei und dass es nur noch wenige Minuten dauere, dann sei ich da. Wie der Esel, dem man die Karotte vorhält, damit er weiterläuft, so trat ich im Vertrauen auf die Informationen der Menschen am Wegrand in die Pedale, bis ich wegen der Schweißbäche, die mir in die Augen liefen, anhalten musste, weil ich nichts mehr sah. Ein indisches Hero-Fahrrad ist vergleichbar mit einem Fitnessgerät, auf dem man bei einem EKG das Herz zu voller Leistung bringen will. Widerstand so eingestellt, dass sich die Pedale kaum noch bewegen lassen. Ich hatte zwar mein Notizbuch und Stifte dabei, aber kein Wasser. Als ich in Murukambakkam vom Fahrrad stieg, hatte ich den Wunsch, man möge mich stützen. Stattdessen versammelte sich eine Menge aufgeregter Kinder um mich herum, die schnellstens von ihren Müttern in die Hütten dirigiert wurden. Hilfe! Eine Witwe! Ein ernst dreinblickender Mann kam auf mich zu. Was ich wolle. Dank Konrads Unterricht konnte ich mich bereits rudimentär verständigen und nannte immer wieder, Mantra-artig, den Namen meines Informanten, Mr. Raman, und das Wort „kuttukaran“, Schauspieler. Man ließ mich auf einem freien Platz, fernab der Hütten, auf dem Boden Platz nehmen. Nach geraumer Zeit teilte man mir dann mit, Mr. Raman sei leider nicht da. Aber Germaine-Aaya hätte mich doch über ihren Mann, den Riksha-Fahrer, angemeldet. Ach so, ja. Mein Gesprächspartner verschwand und kam ewig nicht wieder. Ich wollte schon aufstehen und gehen, da schlurfte ein älterer, ausgemergelter Herr im Lunghi, dem Beinkleid, heran. Es war tatsächlich der erhoffte Herr Raman. Ich stand auf, faltete die Hände vor der Brust und gab ein paar Höflichkeitsfloskeln von mir, die mir Konrad eingetrichtert hatte. Wir setzten uns. Ich atmete tief durch, konzentrierte mich wie der Stabhochspringer vor dem Anlauf und begann, so gut es mir möglich war, einfache Fragen zu stellen. Ich hätte gerne gewusst, wann ein Drama stattfinde und wo und ob ich kommen dürfe. Hier im Dorf fänden keine Dramen statt, entgegnete mein Gegenüber. Im Nachbardorf auch nicht, überhaupt in der ganzen Gegend nicht. Ich schrieb alles schön auf. Er, Mr. Raman, sei doch Schauspieler, nicht wahr? Ob ich vielleicht einmal seine Kostüme sehen dürfte. Aber ja doch, natürlich, gerne, selbstverständlich. Ich machte mich zum Aufstehen bereit. Die Kostüme sind in einer Kiste. Aha, interessant. Ich schrieb das auf. Und diese Kiste steht im Dorf seines Bruders. Soso, aha. Ach so ist das. Und wo ist dieses Dorf? Da hinten, weit, weit weg, ganz weit. Wie heißt das Dorf? Vergessen. Vergessen? Ja, vergessen. Na gut, kann ja mal vorkommen, dass man vergisst, wo der Bruder wohnt. Ich vergesse auch so manches. Ob Kostüme wohl grundsätzlich in Kisten im Dorf des Bruders eines Schauspielers gelagert werden? Dieser Frage wollte ich bei anderen Gelegenheiten nachgehen, und so notierte ich sie, damit ich sie nicht vergaß. Tja. Was sonst noch? – Darf ich wiederkommen? Aber ja doch, jederzeit!
Inzwischen war es dunkel geworden, und das zweistündige Sitzen auf der feuchten Erde – es hatte zuvor geregnet – hinterließ nicht nur einen riesigen braunen Fleck auf meinem nagelneuen Sari, sondern ich spürte auch ein extremes Unwohlsein in meinem Bauch, das sich in den nächsten Tagen zu massiven Bauchschmerzen steigerte. Ich verabschiedete mich mit überschwänglichem Dank und wurde das Gefühl nicht los, dass Herr Raman mir nichts sagen wollte. Unterliegen diese Schauspieler einem Geheimhaltungsgebot? Würde mich nicht wundern, schließlich hatten sie es mit sakralen Texten zu tun. Oder gibt es Voraussetzungen, dass sie sprechen, die ich nicht erfülle? Vielleicht weil ich eine Frau bin? Na, das ging ja schon mal gut an. Später brachte ich in Erfahrung, dass mein Gefühl mich getrogen hatte und meine Befürchtungen unbegründet waren. Herr Raman hatte mit Straßentheater nämlich rein gar nichts zu tun. Er war Riksha-Fahrer, wie sein Freund, Aayas Mann, auch. Mal Besuch bekommen von einer Europäerin, das ist schon was und fördert das eigene Prestige in der Dorfgemeinschaft. Konnte doch kein Mensch ahnen, dass die Gute Witwe ist.
Entmutigt machte ich mich auf den Heimweg. Mein Sari war inzwischen etwas verrutscht. Aus Versehen trat ich mit einem Pedal in den Saum und stand mit abgewickeltem Stoff in meinem engen Oberteil, das wie ein BH mit kurzen Ärmeln gearbeitet ist, und meinem Unterrock am Straßenrand. Keiner scherte sich darum. Für jeden, der vorbeikam, schien es ein alltäglicher Anblick zu sein, eine Europäerin in Unterwäsche mit ihrem Fahrrad und der Kleidung um die Knöchel am Straßenrand stehen zu sehen. Ich drapierte die sieben Meter Stoff irgendwie um meinen Körper, so dass ich wenigstens weiterfahren konnte. Abends donnern durch die Cuddalore Road mit ohrenbetäubendem Hupen, vergleichbar mit einer Schiffssirene, die in höchster Seenot „Feuer auf Elbe 1“ meldet, ein Lastwagen und ein Bus nach dem anderen. Bei Gegenverkehr wird voll aufgeblendet. Einer der beiden Fahrer, der mit den schwächeren Nerven, weicht aus, reißt das Steuer herum und lenkt seinen Mehrtonner auf den Sandstreifen neben der Fahrbahn. Da fuhr ich mit meinem Hero-Fahrrad. Ich weiß noch heute nicht, wie ich heil nach Hause gekommen bin.
Am nächsten Tag war ich krank. Ich brauchte keinen Arzt, um zu wissen, was mir fehlte. Das war ganz eindeutig: Ich hatte mich verkühlt. Waldorf- Muttis rennen nicht gleich bei jeder Gelegenheit zum Arzt und schlucken Antibiotika. Sie greifen zu alternativen Heilmethoden. Eine Wärmflasche oder etwas Entsprechendes war in ganz Pondicherry nicht aufzutreiben. Also schnappte ich mir Anjimaniku, die dicke, träge Katze und legte sie mir auf den Bauch. In der Zeit meines Leidens auf dem Sofa mit Anjimaniku auf dem Bauch ergriff Schwermut mein Gemüt. Zumal ausgerechnet da auch noch alle Ventilatoren ausgefallen waren und die stickige Hitze mir den Rest gab. Ein Mann vom Elektrizitätswerk war nämlich an diesem Morgen gekommen, weil er was im Elektrokasten überprüfen musste, wie er sagte. Nachdem er weg war, ging kein einziger Ventilator mehr. Das fehlte gerade noch, dass ich mich jetzt zusammen mit Anjimaniku auch noch zu Tode schwitzen musste. Genau genommen ging doch schon vom ersten Augenblick an alles schief, angefangen mit meiner Aufenthaltsgenehmigung, die jetzt als wertloser Papierfetzen vom Schutzengel bewacht wurde. Ganz zu schweigen von meiner Forschung, die schon zu Ende war, bevor sie überhaupt begonnen hatte.
Herr Shubash, der Gute, hatte von Aaya gehört, dass es mir nicht gut ging. Er stattete mir einen Krankenbesuch ab und brachte mir zur Aufmunterung Cashewnuss-Süßigkeiten mit. Beiläufig erwähnte er, dass für ihn eine Odyssee ein unerwartetes Ende genommen habe: Wochenlang habe er darum gekämpft, dass jemand vom Elektrizitätswerk kommt, um seine Ventilatoren zu reparieren. Heute Vormittag nun sei endlich jemand da gewesen. Erst wollte der Mechaniker wieder gehen, weil ihm ein Ersatzteil fehlte. Aber er hatte dann doch ganz schnell eines bereit. Ich erzählte vom Elektriker, der in meiner Anlage etwas überprüfen musste, und dass seitdem bei uns kein Ventilator mehr läuft. Herr Shubash fühlte sich schuldig. Nachdem er weg war, setzte sich Manuel an mein Bett. Er wusste nicht, wie er die Leichtigkeit des Seins der ersten Tage zurück in meine verzagte Seele bringen sollte.
„Ich weiß jetzt, was zu tun ist, Manuel“, sagte ich matt. „Ich schreibe einen Brief an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, in dem steht, dass ich meiner Aufgabe weder psychisch noch physisch noch wissenschaftlich gewachsen bin.“ Schon nach kürzester Zeit war ich völlig zermürbt und konnte mir nicht vorstellen, wie das hier die nächsten zwei Jahre lang weitergehen sollte.
Im Grunde meines Herzens erwartete ich natürlich aufmunternde Worte. Sowas wie: „Das wird schon“ oder „Jetzt sei doch nicht so entmutigt“ oder gar: „Du, das sind nur die üblichen Anfangsschwierigkeiten.“
Manuel jedoch meinte ganz sachlich, das sei eine gute Idee, und ich solle das so machen. Er schreibe parallel zu meinem Brief an den Deutschen Akademischen Austauschdienst mit einem vergleichbaren Text. Wir waren uns wieder einmal einig. Bevor wir die Briefe schrieben, zögerten wir dann doch etwas. Manuel kaufte an einem Stand vor dem Tempel, als Alternative zu den Briefen, ein buntes Papierbildchen des elefantenköpfigen Gottes Ganesh, des Beseitigers aller Hindernisse, und hängte es gegenüber dem Schutzengel auf – zur Beförderung eines interreligiösen Dialogs sozusagen.
Die Idee mit dem Ganesh-Bildchen als letzten Ausweg aus unserer seelischen Misere fand ich gut. Tröstlich, dass die indische Kultur für so jemanden wie uns eine eigene Gottheit bereithält. Da ist das Christentum nicht so praktisch und lebensnah. Nichts gegen den Grundgütigen. Aber ich finde, er macht es einem manchmal nicht ganz einfach. Da ist man in Not und soll sich an einen Schmerzensmann wenden, an einen, der selber in eine ausweglose Situation geraten ist, der hilflos am Kreuz hängt, mit Nägeln in Händen und Füßen, und nicht mehr kann. Das eigene Anliegen ist dann immer lächerlich. Man könnte natürlich einwenden, dass es ja noch Gottvater gibt. Der hängt an keinem Kreuz, sondern sitzt auf seinem Thron im Himmel und hat ein offenes Ohr für jeden, der ihn braucht. Aber war nicht er derjenige, der seinen Sohn verlassen hat, so sehr dieser auch Rettung von ihm erhofft hatte? Und dieser Gott, der seinem eigenen Sohn, als es um Leben und Tod ging, jede Hilfe verweigert hat, ausgerechnet der soll jetzt dafür sorgen, dass Manuel sein Symposion auf die Reihe bekommt und ich einen Schauspieler finde? Also mir leuchtet das ein, dass ein dicker Elefantengott mit seinen vier Armen, wie er da so neben seinen Zuckerbällchen sitzt und fidel in die Welt schaut, in der Lage ist, alle Hindernisse aus dem Weg zu schaffen.
Ob nun Ganesh in unser Leben eingetreten war, das sei dahingestellt. Jedenfalls ging es mit uns allen aufwärts:
Herr Shubash, der Gute, war persönlich zum Elektrizitätswerk gefahren und tauchte schon bald mit einem Mechaniker bei uns auf, der die Ventilatoren wieder zum Laufen brachte.
Manuel hatte einen Steinmetz gefunden, mit dem zusammen er draußen vor der Gartenmauer an einem Kunstwerk arbeitete, das er auf seinem Symposion auszustellen gedachte. Der Garten war für die Kinder, die Pflanzen und die Tiere reserviert. Niemand hatte etwas dagegen einzuwenden, dass auf dem Gehweg ein tonnenschwerer Granitblock lag, an dem immerzu herumgehämmert wurde, was ja nicht gerade leise ist. Außerdem korrespondierte Manuel frischen Mutes mit dem Deutschen Generalkonsulat. Bald kam ein Brief mit der Einladung zu einer Vernissage im Hause des britischen Konsuls in Madras. Wir hatten dem Briefträger einen Crash-Kurs im Lesen unseres Namens und unserer Adresse verpasst, zusammen mit einer kleinen Zuwendung für seine Kinder. Die Post kam an.
Dank meiner Katzentherapie wurde ich bald wieder gesund, arbeitete in der Bibliothek oder lernte Tamil.
Die Kinder waren mit ihren neuen Freundinnen und den Tieren beschäftigt, an Unterricht war allerdings auch mit raffiniertesten Belohnungen und den ausgefeiltesten Argumenten nicht zu denken. Nicht mal mit Drohungen, zu denen man ja gerne mal greift, wenn alles andere nichts mehr nützt. Als die großen Meisterpädagogen hatten wir schon gleich zu Beginn unseres Indienaufenthaltes versagt. Bereitwillig ließen wir uns, hilflos, von unseren Kindern in die Ecke drängen. Wir riefen uns Rudis pädagogisches Konzept des „latenten Reifungsprozesses“ ins Gedächtnis, mit dem schon Generationen besorgter Waldorf-Eltern ruhiggestellt worden sind, wenn ihre Kinder faul, unmotiviert oder gelangweilt waren. Wir brauchen uns doch gar nicht zu verkrampfen, auch Johanna und Lena werden irgendwann mal, wenn sie reif genug sind, das drängende Bedürfnis nach Wissen entwickeln. Ganz von selbst, ganz von alleine, ganz spielerisch. Auf diesen Moment müssten wir eben vertrauensvoll warten. Jetzt bloß nicht aufregen, ganz ruhig bleiben und die Kinder nicht verunsichern. Empathie ist angesagt: Haben denn die Armen nicht schon genug unter dem gewaltigen Kulturschock zu leiden? Waren nicht wir diejenigen, die sie herausgerissen haben aus allem Vertrauten, aus allem, was ihnen lieb war? Weg von Oma und Opa, den Legosteinen, dem Halma- Spiel und den Schlagern der Fünfzigerjahre; weg von ihren Freundinnen und Freunden; weg von ihrem Zimmer in unserer engen Bude mit dem fleckigen, einst gelben Flauschteppich, auf dem schon viele Saftgläser und Kakaobecher umgekippt sind; weg von Johannas Super-Lehrerin und der geliebten Schule, in der die Böden so gemütlich nach Bienenwachs und die Toilettenanlagen nach nichtionischen Tensiden auf pflanzlicher Basis, Duftnote Zitrus, rochen; weg von Lenas Kindergarten, in dem schon in aller Früh die zarten Klänge der Kantele ertönten, wo sie Brot backen und Apfelmus kochen durfte. Von Fix und Foxi ganz zu schweigen, den beiden Wüstenrennmäusen mit den vom vielen Streicheln fettigen Fellchen, die sich selbständig ihr Nestchen in meinem linken Skistiefel gebaut hatten. – Alles weg von einem Tag auf den anderen, alles verloren. Und mitten hinein in diese Tragödie, da sollen wir auch noch die Kinder zum Lernen antreiben? Wir ruderten zurück, ließen die Kinder spielen und konzentrierten uns auf unsere Arbeit.