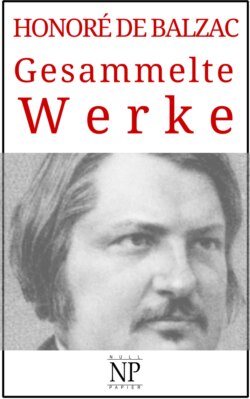Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Todeskampf
ОглавлениеIn den ersten Dezembertagen schritt ein siebzigjähriger Greis ungeachtet des Regens durch die Rue de Varennes, schaute an jedem Gebäude empor und suchte mit der Naivität eines Kindes und der gedankenversunkenen Miene eines Philosophen die Wohnung des Marquis de Valentin. Aus diesem Gesicht, das von langen wirren Haaren umrahmt und eingedorrt war wie ein altes Pergament, das sich im Feuer krümmt, sprach bitterer Kummer im Kampf mit einem despotischen Charakter. Wäre ein Maler diesem seltsamen, klapperdürren alten Mann in seinem schwarzen Anzug begegnet, hätte er ihn, ins Atelier zurückgekehrt, wahrscheinlich sofort in seinem Skizzenbuch verewigt und darunter geschrieben: »Klassischer Poet auf der Suche nach einem Reim.« Nachdem dieser leibhaftig wiedererstandene Rollin1 die Nummer gefunden hatte, die ihm angegeben worden war, klopfte er behutsam an das Tor eines prächtigen Gebäudes.
»Ist Monsieur Raphael zu Hause?« fragte der wackere Alte einen Schweizer in Livree.
»Monsieur le Marquis empfängt niemanden«, erwiderte der Diener und verschlang dabei eine riesige Brotscheibe, die er in eine große Kaffeetasse getunkt hatte.
»Sein Wagen steht dort«, sagte der unbekannte Alte und wies auf eine glänzende Equipage, die unter einem hölzernen Vordach in Form eines Zeltes stand, das zugleich die Stufen der Freitreppe vor dem Regen schützte. »Er wird bald ausfahren, ich werde warten.«
»Ja, Alterchen, da können Sie bis morgen früh hier warten«, versetzte der Schweizer. »Es steht immer ein Wagen für Monsieur bereit. Bitte, gehen Sie; ich würde 600 Francs Leibrente verlieren, wenn ich nur einmal unerlaubt einen fremden Menschen eintreten ließe.«
In diesem Augenblick trat ein hochgewachsener Greis, dessen Tracht der eines Türhüters in einem Ministerium glich, aus dem Vestibül und stieg rasch ein paar Stufen herab, wobei er den verblüfft dastehenden bejahrten Bittsteller prüfend musterte.
»Da kommt übrigens Monsieur Jonathas«, sagte der Schweizer, »sprechen Sie mit ihm.«
Die beiden alten Männer, die sich durch Sympathie oder durch gegenseitige Neugier zueinander hingezogen fühlten, trafen in der Mitte des weiten Innenhofes zusammen an einem Rondell, wo zwischen den Pflastersteinen ein paar Grasbüschel wuchsen. Schreckliche Stille herrschte in diesem Palast. Wer Jonathas sah, war versucht, das Geheimnis zu lüften, das seine Züge beschattete und von dem jede Kleinigkeit in diesem düsteren Hause zeugte. Als er die riesige Erbschaft seines Oheims angetreten hatte, war es Raphaels erste Sorge gewesen, herauszufinden, wo der alte ergebene Diener lebte, auf dessen Anhänglichkeit er sich verlassen konnte. Jonathas weinte vor Freude, als er seinen jungen Herrn wiedersah, dem er für ewig Lebewohl gesagt zu haben glaubte; aber nichts kam seinem Glück gleich, als der Marquis ihm die wichtigen Aufgaben eines Verwalters übertrug. Der alte Jonathas wurde eine Zwischeninstanz zwischen Raphael und der Welt. Oberster Vermögensverwalter seines Herrn, blinder Vollstrecker eines unbekannten Willens, war er gleichsam ein sechster Sinn, durch den allein die Wellen des Lebens zu Raphael gelangten.
»Monsieur«, sagte der Alte zu Jonathas und stieg ein paar Stufen der Freitreppe hinauf, um sich vor dem Regen zu schützen, »ich möchte Monsieur Raphael sprechen.«
»Monsieur le Marquis sprechen?« rief der Verwalter; »kaum daß er ein Wort zu mir sagt, und ich bin doch sein Pflegevater!«
»Aber auch ich bin sein Pflegevater!« rief der alte Mann; »wenn Ihre Frau ihn einst säugte, so war ich es, der ihn den Musen an die Brust legte. Er ist mein Pflegling, mein Kind, mein carus alumnus!2 Ich habe seinen Verstand geformt, sein Urteilsvermögen entwickelt, seinen Geist geschärft, und, wie ich zu behaupten wage, mir zur Ehre und zum Ruhm. Ist er nicht einer der bedeutendsten Männer unserer Zeit? Bei mir war er in der Sexta, in der Tertia und in der Klasse für Rhetorik. Ich bin sein Lehrer.«
»Ah! Sie sind Monsieur Porriquet?«
»Richtig. Aber Monsieur …«
»Pst! pst!« fuhr Jonathas zwei Küchenjungen an, deren Stimmen das klösterliche Schweigen brachen, das über dem Hause ruhte.
»Aber, Monsieur«, begann der Lehrer von neuem, »der Marquis ist doch hoffentlich nicht krank?«
»Oh, Monsieur«, erwiderte Jonathas, »Gott allein weiß, wie es um meinen Herrn steht. Sehen Sie, es gibt in Paris kein zweites Haus wie das unsere. Verstehen Sie? Kein zweites. Monsieur le Marquis hat diesen Palast, der vormals einem Herzog und Pair gehört hat, kaufen lassen. Er hat es für 300 000 Francs ausstatten lassen. Nicht wahr, das ist doch ein Sümmchen: 300 000 Francs! Aber dafür ist auch jedes Zimmer unseres Hauses ein wahres Wunder. ›Schön!‹ sag ich mir also, wie ich diese Herrlichkeit sehe, ›das ist ganz so wie beim seligen Monsieur, seinem Großvater: der junge Marquis will die Stadt und den Hof empfangen.‹ Nichts damit. Monsieur wollte keine Menschenseele sehen. Er führt ein komisches Leben, Monsieur Porriquet, wissen Sie? Ein unverträgliches Leben. Monsieur steht jeden Tag zur selben Stunde auf. Ich allein, und weiter niemand, sehen Sie, darf in sein Zimmer. Ich öffne um sieben Uhr die Tür, im Sommer wie im Winter. Das ist ein für allemal festgelegt. Nach dem Eintreten sage ich: Monsieur le Marquis, Sie müssen aufwachen und sich ankleiden. Schön, er wacht auf und kleidet sich an. Ich muß ihm seinen Hausrock geben, der immer nach demselben Schnitt und aus demselben Stoff gemacht ist. Ist er abgetragen, so habe ich für einen neuen zu sorgen, nur um ihn der Mühe zu entheben, einen neuen zu verlangen. Man stelle sich das einmal vor! Allerdings hat er auch 1000 Francs täglich zu verzehren, der liebe Junge kann tun, was er will. Und übrigens habe ich ihn so lieb, ich würde ihm die linke Backe hinhalten, wenn er mir eine Backpfeife auf die rechte gäbe! Er könnte mir noch viel schwierigere Dinge auftragen, ich würde alles tun, verstehen Sie? Und dann habe ich so viel Kleinkram für ihn zu erledigen, daß ich kaum weiß, wo mir der Kopf steht. Also nicht wahr, er liest Zeitungen? Laut Befehl habe ich sie auf ein und dieselbe Stelle auf ein und denselben Tisch zu legen. Ich muß ihn auch in eigener Person und stets zur nämlichen Stunde rasieren und zittere dabei nicht im geringsten. Der Koch würde 1000 Taler Leibrente verlieren, die ihn nach dem Tod von Monsieur erwarten, wenn das Frühstück nicht unweigerlich jeden Morgen Punkt zehn Uhr und das Diner Punkt fünf Uhr auf dem Tische ständen. Der Speiseplan ist für das ganze Jahr festgelegt, Tag für Tag. Monsieur le Marquis bleibt nichts zu wünschen übrig. Er hat Erdbeeren, wenn es Erdbeeren gibt, und die erste Makrele, die in Paris ankommt, ißt er. Das Menü ist gedruckt, er weiß am Morgen auswendig, was er zum Diner bekommt. Ferner kleidet er sich zur nämlichen Stunde mit den nämlichen Kleidern, der nämlichen Wäsche, die ich immer – verstehen Sie? – auf den nämlichen Sessel lege. Ich habe auch dafür zu sorgen, daß er immer dasselbe Tuch hat, notfalls, wenn beispielsweise sein Rock schäbig wird, muß ich einen neuen dafür hinlegen und darf kein Wort darüber verlieren. Ist es schönes Wetter, so gehe ich hinein und sage zu meinem Herrn: »Sie sollten ausfahren, Monsieur le Marquis!« Er antwortet ja oder nein. Will er aber spazierenfahren, so wartet er nicht auf seine Pferde, sie sind immer angespannt; der Kutscher sitzt unweigerlich mit der Peitsche in der Hand, wie Sie ihn da sehen. Abends nach dem Diner fährt der Monsieur einmal in die Oper und ein andermal zu den Ital … aber nein, bei den Italienern3 war er noch nicht, ich habe mir erst gestern eine Loge verschaffen können. Um elf Uhr pünktlich kommt er nach Hause und legt sich schlafen. Während der Zwischenzeiten am Tag, wo er nichts zu tun hat, liest er; er liest immerzu, sehen Sie! Das ist so seine fixe Idee! Ich habe Befehl, vor ihm das »Journal de la Librairie« zu lesen und die neuen Bücher zu besorgen, damit er sie am Tage des Erscheinens auf seinem Kamin liegen hat. Weiterhin bin ich gehalten, stündlich zu ihm hineinzugehen, um nach dem Feuer, nach allem zu schauen und darauf zu achten, daß nichts fehlt. Er hat mir ein kleines Buch zum Auswendiglernen gegeben, Monsieur, wo alle meine Pflichten drinstehen, ein kleiner Katechismus! Im Sommer muß ich mit großen Eisblöcken die Temperatur immer gleichmäßig kühl halten und jederzeit überall frische Blumen aufstellen. Er ist reich! Er hat 1000 Francs täglich zu verzehren, er kann seinen Launen nachgehen. Lange genug hat der arme Junge sogar das Notwendigste entbehrt. Er quält niemanden, er ist gut wie das tägliche Brot, nie sagt er ein einziges Wort, und Sie sehen: völliges Schweigen im Haus und im Garten! Kurz, mein Herr braucht keinen einzigen Wunsch zu äußern, alles läuft am Schnürchen und exakt! Er hat auch ganz recht: wenn man die Dienerschaft nicht kurzhält, geht alles drunter und drüber. Ich sage ihm alles, was er tun muß, und er hört auf mich. Sie können sich kaum vorstellen, wie weit er das getrieben hat. Seine Gemächer sind in einer … einer … na, wie denn nun? … in einer Flucht, will ich sagen. Aber macht er nun, sagen wir einmal, die Tür seines Schlafzimmers oder seines Studierzimmers auf, … krach! öffnen sich alle Türen von selbst durch einen Mechanismus. Sehen Sie, so kann er in seinem Haus von einem Zimmer zum anderen gehen und braucht keine einzige Tür zu öffnen. Das ist bequem und praktisch und sehr angenehm für uns! Aber das hat uns einen Batzen Geld gekostet, das können Sie glauben! Und, Monsieur Porriquet, schließlich und endlich hat er zu mir gesagt: ›Jonathas, du wirst für mich sorgen wie für ein Wickelkind.‹ Ein Wickelkind, so hat er gesagt, wie für ein Wickelkind hat er gesagt. ›Du wirst für mich an meine Bedürfnisse denken …‹ Ich bin der Herr, verstehen Sie? Er ist sozusagen der Diener. Warum? Ja, sagen wir einmal, das weiß niemand in der Welt als er und der liebe Gott. Das ist unweigerlich.«
»Er arbeitet an einer Dichtung«, rief der alte Professor.
»Sie glauben, er schreibt ein Gedicht, Monsieur? Das muß ja eine schöne Plackerei sein, was? Aber sehen Sie, ich glaub das nicht. Er sagt mir oft, er wolle durchaus vergetieren, ja, sagen wir einmal, ganz vegetatierisch wolle er leben. Ja, erst gestern, Monsieur Porriquet, besah er sich eine Tulpe, so beim Ankleiden, wissen Sie, und da sagte er: »So ist mein Leben. Ich vergetiere, guter Jonathas!« Nun wahrhaftig, es gibt andere, die behaupten, er sei ein Monomane. Das ist unweigerlich!«
»Das alles beweist mir«, versetzte der Professor mit schulmeisterlicher Würde, die dem alten Kammerdiener tiefen Respekt einflößte, »daß Ihr Herr sich mit einem großen Werk beschäftigt. Er ist in tiefe Meditationen versunken und will durch die Bedürfnisse des gemeinen Lebens nicht davon abgelenkt werden. Ein geistvoller Mensch vergißt in seiner Gedankenarbeit alles. Eines Tages verbrachte der berühmte Newton …«
»Ah! Newton, schön …«, sagte Jonathas; »den kenne ich nicht.«
»Newton, ein großer Mathematiker«, fuhr Porriquet fort, »blieb 24 Stunden unbeweglich sitzen, die Ellbogen auf einen Tisch gestützt; als er aus seinem Sinnen erwachte, glaubte er, es sei noch der vorige Abend, als hätte er geschlafen. Ich will den lieben Jungen sehen, ich kann ihm nützlich sein.«
»Halt!« rief Jonathas. »Und wenn Sie der König von Frankreich wären, der alte natürlich, würden Sie nur hineingelangen, wenn Sie die Türen sprengten und über mich hinwegschritten. Aber, Monsieur Porriquet, ich lauf hin und sag ihm, daß Sie da sind, und frage ihn etwa so: ›Soll man ihn heraufkommen lassen?‹ Dann kann er ja oder nein antworten. Niemals sage ich zu ihm: ›Wünschen Sie? Wollen Sie? Möchten Sie?‹ Solcherlei Worte sind aus unserem Gespräch gestrichen. Einmal ist mir solch eins entwischt, und da fragte er mich gleich in vollem Zorn: ›Willst du mich töten?‹
Jonathas ließ den alten Lehrer im Vestibül zurück und bedeutete ihm, sich nicht von der Stelle zu rühren; aber es dauerte nicht lange, bis er mit einem günstigen Bescheid zurückkam und den alten pensionierten Professor durch kostbar ausgestattete Gemächer führte, deren Türen samt und sonders offenstanden. Porriquet sah seinen Schüler schon von weitem an seinem Kamin sitzen. Raphael trug einen auffallend gemusterten Schlafrock, saß in einem bequemen Lehnstuhl und las die Zeitung. Die tiefe Schwermut, der er zum Opfer gefallen schien, drückte sich in der hinfälligen Haltung seines abgezehrten Körpers aus; sie stand auf seiner Stirn und auf seinem bleichen Antlitz, das einer verkümmerten Blüte glich. Seine Erscheinung verriet eine gewisse weibliche Anmut und die reichen Kranken eigenen bizarren Absonderlichkeiten. Seine Hände waren weiß, weich und zart wie die einer hübschen Frau. Seine blonden, bereits schütteren Haare lockten sich mit gesuchter Koketterie um seine Schläfen. Eine griechische Kappe aus Kaschmir wurde von einer für den leichten Stoff zu schweren Quaste heruntergezogen und saß schief auf seinem Kopf. Er hatte ein mit Gold ausgelegtes Malachitmesser, das er zum Aufschneiden eines Buches benutzt hatte, achtlos zu Boden fallen lassen. Auf seinen Knien lag das Bernsteinmundstück einer prachtvollen indischen Nargileh,4 deren glasierter Schlauch sich wie eine Schlange in seinem Zimmer ringelte, doch er vergaß, ihren frischen Duft einzuziehen. Die offenkundige Schwäche seines jungen Körpers wurde indessen von blauen Augen Lügen gestraft, in die sich das ganze Leben zurückgezogen zu haben schien: ein außerordentliches Gefühl strahlte aus ihnen, das sogleich ergriff. Dieser Blick tat weh, wenn man ihn sah. Der eine mochte Verzweiflung darin lesen; ein anderer einen inneren Kampf ahnen, der so schrecklich sein mußte wie Gewissenspein. Es war der tiefe Blick des Ohnmächtigen, der seine Wünsche auf den Grund seines Herzens zurückdrängt, oder der Blick des Geizigen, der in Gedanken mit all den Freuden spielt, die sein Geld ihm verschaffen könnte und auf die er verzichtet, um seinen Schatz nicht anzutasten; oder der Blick des gefesselten Prometheus, des gescheiterten Napoleon, der 1815 im Elysée vom strategischen Fehler5 seiner Feinde erfährt, für 24 Stunden das Kommando verlangt und es nicht erhält. Wahrhaft der Blick des Eroberers und Verdammten! Ja, mehr noch, der Blick, den Raphael einige Monate zuvor auf die Seine oder auf das letzte Goldstück geworfen hatte, das er im Spiel setzte. Er unterwarf seinen Willen, seinen Intellekt dem plumpen gesunden Menschenverstand eines alten Bauern, den 50 Jahre Dienststellung nur notdürftig zivilisiert hatten. Fast froh, eine Art Automat zu werden, entsagte er dem Leben, um zu leben, und versagte seiner Seele alle Poesie des Wünschens. Um der grausamen Macht, deren Herausforderung er angenommen hatte, besser entgegenzutreten, war er nach Art des Origenes6 keusch geworden, indem er seine Phantasie entmannte. An dem Tag, nachdem er, durch ein Testament schlagartig reich geworden, gesehen hatte, wie das Chagrinleder kleiner wurde, hatte er seinen Notar aufgesucht. Dort hatte ein damals beliebter Arzt beim Dessert allen Ernstes erzählt, wie ein Schweizer sich von der Schwindsucht geheilt hatte. Dieser Mann hatte zehn Jahre lang kein Wort gesprochen und sich gezwungen, nur sechsmal in der Minute in der dicken Luft eines Kuhstalles zu atmen, außerdem hatte er nur ganz leichte Speisen zu sich genommen. »So werde ich es auch machen!« hatte sich Raphael gesagt. Er wollte um jeden Preis leben. Von Luxus umgeben, führte er das Leben einer Maschine. Als der alte Professor diesen jungen Leichnam ansah, erbebte er; alles schien ihm an diesem schmächtigen und gebrechlichen Körper künstlich zu sein. In diesem Marquis mit dem brennenden Blick, der gedankenschweren Stirn konnte er nicht mehr den Schüler mit dem frischen und rosigen Gesicht, den jugendlichen Gliedern erkennen, wie er in seiner Erinnerung lebte. Wenn der wackere Verfechter klassischer Ideale, der feinsinnige Kritiker und Bewahrer des guten Geschmacks Lord Byron gelesen hätte, hätte er geglaubt, einen Manfred vor sich zu sehen, wo er einen Childe Harold7 erwartet hatte.
»Guten Tag, Vater Porriquet«, sagte Raphael zu seinem Lehrer und drückte die eisigen Finger des alten Mannes mit seiner heißen, feuchten Hand. »Wie geht es Ihnen?«
»Mir geht es schon gut«, erwiderte der Greis, von der Berührung mit dieser fiebernden Hand erschreckt. »Und Ihnen?«
»Oh! Ich hoffe, mich bei guter Gesundheit zu erhalten.«
»Sie arbeiten ohne Zweifel an einem schönen Werk?«
»Nein«, erwiderte Raphael, »exegi monumentum,8 Vater Porriquet, ich habe eine große Schrift vollendet und der Wissenschaft für immer Valet gesagt. Ich weiß nicht einmal genau, wo mein Manuskript sich befindet.«
»Es ist doch hoffentlich in einem reinen Stil geschrieben?« fragte der Professor; »ich hoffe, Sie haben nicht die barbarische Sprache dieser neuen Schule angenommen, die wunder was zu tun glaubt, wenn sie Ronsard9 entdeckt!«
»Mein Werk ist ein rein physiologisches Buch.«
»Oh, damit ist alles gesagt!« gab der Professor zurück; »in den Wissenschaften muß die Grammatik den Erfordernissen der Entdeckungen Genüge leisten. Nichtsdestoweniger, mein Sohn, kann ein klarer, harmonischer Stil, die Sprache Massillons,10 Monsieur de Buttons, des großen Racine,11 kurz, ein klassischer Stil nie von Schaden sein. Aber, mein Freund«, unterbrach sich der Professor, »ich vergaß den Zweck meines Besuchs. Es ist ein eigennütziger Besuch.«
Raphael erinnerte sich zu spät der wortreichen Eleganz und der beredten Umschreibungen, an die ein langjähriges Professorendasein seinen alten Lehrer gewöhnt hatte. Er bereute jetzt fast, ihn empfangen zu haben; aber in dem Augenblick, als er geneigt war, den Alten lieber wieder draußen zu sehen, unterdrückte er hastig diesen geheimen Wunsch und warf einen verstohlenen Blick auf das Chagrinleder, das vor ihm, auf einen weißen Stoff gespannt, hing, auf dem seine prophetischen Konturen sorgfältig mit einer roten Linie nachgezogen waren, die das Leder genau abschlossen. Seit der verhängnisvollen Orgie unterdrückte Raphael den leisesten Anflug eines Begehrens und lebte in einer Weise, die dem schrecklichen Talisman nicht das geringfügigste Zucken verursachen konnte. Das Chagrinleder war wie ein Tiger, mit dem er leben mußte, ohne seine blutdürstigen Instinkte zu wecken. Er hörte also die weitläufigen Erklärungen des alten Professors geduldig an. Vater Porriquet brauchte eine Stunde, um ihm von den Verfolgungen zu erzählen, deren Gegenstand er seit der Julirevolution geworden war. Der biedere Bürger hatte, vom patriotischen Verlangen nach einer starken Regierung beseelt, geäußert, man möge die Krämer in ihren Läden, die Staatsmänner in der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten, die Advokaten im Justizpalast und die Pairs von Frankreich im Luxembourg lassen; aber einer der populären Minister des Bürgerkönigs hatte ihn des Karlismus beschuldigt und ihn von seinem Katheder verbannt. Der alte Mann war ohne Stellung, ohne Einkünfte, ohne Brot. Da er für einen armen Neffen zu sorgen hatte, für den er im Seminar von Saint-Sulpice die Pension bezahlte, kam er, weniger für sich selbst als für seinen Adoptivsohn, seinen ehemaligen Schüler zu bitten, er möchte sich bei dem neuen Minister für ihn verwenden. Es war ihm nicht einmal um die Wiedereinsetzung in sein früheres Lehramt zu tun, sondern nur um eine Rektorstelle an irgendeinem Provinzgymnasium. Raphael war von einer unüberwindlichen Schlafsucht befallen, als die eintönige Stimme des redlichen Alten schließlich aufhörte, in seinen Ohren zu tönen. Aus Höflichkeit hatte er dem Greis bei dessen langsamen und umständlichen Darlegungen in die farblosen und fast starren Augen geblickt, und eine unerklärliche Trägheit war über ihn gekommen und hatte ihn magnetisiert und fast betäubt.
»Nun ja, guter Vater Porriquet«, erwiderte er, ohne recht zu wissen, auf welche Frage er antwortete, »da kann ich nichts tun, gar nichts. Ich wünsche lebhaft, es möchte Ihnen gelingen …«
Mit einemmal bäumte sich Raphael, der gar nicht darauf achtete, welche Wirkung diese banalen, egoistischen und leichtfertigen Worte auf der gelben, runzligen Stirn des Alten hervorbrachten, heftig auf wie ein aufgescheuchtes junges Wild. Er bemerkte eine dünne weiße Linie zwischen dem Rand des schwarzen Leders und der roten Kontur; er stieß einen so furchtbaren Schrei aus, daß der arme Professor entsetzt zusammenfuhr.
»Fort, alter Blödian!« rief er, »Sie werden zum Rektor ernannt werden! Konnten Sie nicht eine Leibrente von 1000 Talern erbitten, statt eines derart mörderischen Wunsches! Dann hätte Ihr Besuch mich nichts gekostet. Es gibt 100 000 Stellen in Frankreich, und ich habe nur ein Leben! Ein Menschenleben ist mehr wert als alle Stellen der Welt … Jonathas!«
Jonathas erschien.
»Das hast du nun angestellt, du dreifacher Trottel! Warum hast du mir vorgeschlagen, diesen Herrn da zu empfangen?« Damit wies er auf den Alten, der wie versteinert dastand. »Habe ich meine Seele in deine Hände gelegt, damit du sie in Stücke reißt? Du hast mir in diesem Augenblick zehn Jahre meines Lebens geraubt! Noch einen Fehler wie den, dann kannst du mich an den Ort bringen, wo ich meinen Vater hingebracht habe. Da hätte ich doch wahrhaftig besser getan, die schöne Fœdora zu besitzen, als dem alten Gerippe da, diesem Jammerlappen, einen Dienst zu erweisen! Ich habe Gold für ihn genug. Und außerdem, wenn alle Porriquets in der Welt Hungers stürben, was kümmert das mich?«
Raphaels Gesicht war vor Zorn fast weiß geworden; ein leichter Schaum trat auf seine zitternden Lippen, und in seinen Augen lag Mordlust. Bei diesem Anblick wurden die beiden Alten von krampfhaftem Zittern befallen; sie standen da wie zwei Kinder vor einer Schlange. Der junge Mann sank in seinen Sessel zurück; in seiner Seele vollzog sich eine Art Reaktion, und in Strömen flossen die Tränen aus seinen flammenden Augen.
»Oh, mein Leben! mein schönes Leben!« stöhnte er. »Keine wohlwollenden Gedanken mehr! Keine Liebe! Nichts!« Er wandte sich zum Professor. »Das Unglück ist geschehen, alter Freund«, sagte er mit sanfter Stimme. »Sie sind für Ihre treuen Dienste nun reichlich belohnt; und mein Unglück wird wenigstens einem guten und würdigen Manne Gutes bringen.« Es lag in diesen fast unverständlichen Worten so viel Seele, daß die beiden Alten weinten, wie man wohl beim Anhören einer rührenden Melodie in einer fremden Sprache weint.
»Er ist Epileptiker«, flüsterte Porriquet.
»Ich verstehe Ihre Güte, alter Freund«, versetzte Raphael sanft, »Sie wollen mich entschuldigen. Krankheit ist ein mißlicher Zufall, Unmenschlichkeit hingegen wäre ein Laster. Verlassen Sie mich jetzt!« fügte er hinzu. »Sie werden morgen oder übermorgen, vielleicht noch heute abend Ihre Ernennung erhalten, denn der »Widerstand« hat über die »Bewegung« gesiegt … Adieu.«
Der Greis zog sich, von Entsetzen gepackt und in lebhafter Unruhe über Valentins Geisteszustand, zurück. Dieser Auftritt hatte für ihn etwas Übernatürliches gehabt. Er zweifelte an sich selbst und fragte sich, ob er aus einem schweren Traum erwache.
»Höre, Jonathas«, sagte der junge Mann zu seinem alten Diener, »gib dir Mühe, die Aufgabe, die ich dir anvertraut habe, endlich zu begreifen.«
»Ja, Monsieur le Marquis.«
»Ich bin wie ein Mensch, der außerhalb der gewöhnlichen Daseinsgesetze steht.«
»Ja, Monsieur le Marquis.«
»Alle Genüsse des Lebens wiegen sich um mein Totenbett und umtanzen mich wie schöne Frauen; wenn ich sie rufe, sterbe ich. Immer der Tod! Du mußt eine Schranke sein zwischen mir und der Welt.«
»Ja, Monsieur le Marquis«, sagte der Diener und trocknete die Schweißtropfen, die auf seiner runzligen Stirn standen. »Aber wenn Sie keine schönen Frauen sehen wollen, was wollen Sie dann heute abend in der Italienischen Oper? Eine englische Familie, die nach London zurückreist, hat mir den Rest ihres Abonnements abgetreten, und Sie haben eine schöne Loge, oh, eine prächtige Loge im ersten Rang.«
Raphael war in tiefes Träumen versunken und hörte nicht mehr zu.
Sehen Sie diesen prunkvollen Wagen, dieses äußerlich schlichte und braune Coupé, auf dessen Türen aber das Wappen einer alten Adelsfamilie glänzt? Wenn dieses Coupé vorüberrollt, bewundern es die Grisetten, werfen begehrliche Blicke auf den gelben Atlas, die echte Savonneriedecke, die Borten, die wie Reisstroh blinken, die molligen Kissen und die geschlossenen Scheiben. Zwei Lakaien in Livree stehen hinten auf diesem aristokratischen Gefährt; innen aber liegt auf Seidenkissen ein fiebrig-brennender Kopf mit umränderten Augen, der Kopf von Raphael, traurig und in sich gekehrt. Düsteres Bild des Reichtums. Er rast durch Paris wie eine Rakete, langt am Säulenvorbau des Théâtre Favart12 an, der Tritt wird heruntergelassen, seine beiden Diener stützen ihn, eine neidische Menge starrt ihn an.
»Was hat der getan, daß er so reich ist?« fragte ein armer Student der Rechte, dem der Taler fehlte, um die bezaubernden Klänge Rossinis hören zu können.
Raphael schritt langsam durch die Gänge des Theaters; er versprach sich von diesem Vergnügen, das er früher so ersehnt hatte, keinerlei Genuß. Den zweiten Akt der »Semiramis«13 erwartend, ging er im Foyer auf und ab, irrte durch die Galerien, unbekümmert um seine Loge, die er noch nicht betreten hatte. Das Gefühl für Eigentum existierte für ihn nicht mehr. Wie alle Kranken dachte er nur an sein Leiden. An den Kamin im Foyer gelehnt, wo junge und alte Stutzer, frühere und jetzige Minister, Pairs ohne Pairswürde und Pairswürden ohne Pairs, wie sie die Julirevolution hervorgebracht hat, und schließlich eine Menge Spekulanten und Journalisten auf und ab wandelten, erblickte Raphael, einige Schritte von sich entfernt, unter all diesen Köpfen ein seltsames, gleichsam übernatürliches Gesicht. Er näherte sich diesem absonderlichen Wesen, um es aus der Nähe zu betrachten, wobei er ungeniert die Augen zusammenkniff. »Was für eine wunderbare Malerei!« sagte er sich. Die Brauen, die Haare, das Spitzbärtchen à la Mazarin, mit dem der Unbekannte sich eitel spreizte, waren schwarz gefärbt; aber da das Schönheitsmittel offenbar auf zu weißes Haar aufgetragen war, hatte es eine violette, widernatürliche Färbung erzeugt, deren Töne je nach den mehr oder weniger starken Reflexen der Lichter wechselten. Sein schmales und plattes Gesicht, dessen Falten mit einer dicken Schicht Puder und Rouge bedeckt waren, drückte zugleich Verschlagenheit und Unruhe aus. An einigen Stellen fehlte die Schminke, und das abgelebte Gesicht, seine bleierne Haut traten um so deutlicher hervor; so konnte man das Lachen nicht verbeißen, wenn man diesen Kopf mit dem spitzen Kinn und der vorstehenden Stirn sah, der an die grotesken Holzschnitzereien erinnerte, die deutsche Schäfer in ihren Mußestunden schnitzten. Wer abwechselnd diesen alten Adonis und Raphael betrachtete, hätte in dem Marquis die Augen eines Jünglings in der Maske eines Greises und in dem Unbekannten die erloschenen Augen eines Greises in der Maske eines jungen Mannes zu erkennen geglaubt. Valentin suchte sich zu erinnern, wo und wann er diesen vertrockneten Alten schon gesehen hatte, der so eine zierliche Halsbinde trug, gestiefelt und gespornt wie ein Jüngling einherschritt, und die Arme über der Brust kreuzte, als hätte er alle Kräfte einer sprühenden Jugend zu verschwenden. In seinem Gang lag nichts Vorgetäuschtes oder Erzwungenes. Den alten, starkknochigen Körper vermummte ein eleganter, sorgfältig zugeknöpfter Rock und verlieh ihm das Aussehen eines alten Gecken, der noch der Mode huldigt. Diese seltsame lebendige Puppe hatte für Raphael den ganzen Reiz einer Gespenstererscheinung, und er betrachtete sie wie einen alten, verräucherten, kürzlich restaurierten, gefirnißten und in einen neuen Rahmen gesteckten Rembrandt. Dieser Vergleich führte ihn in seinen wirren Erinnerungen wieder auf die rechte Spur: er erkannte den Antiquitätenhändler wieder, den Mann, dem er sein Unglück verdankte. In diesem Augenblick lachte dieser phantastische Alte ein lautloses Lachen, das sich auf seinen blutleeren Lippen abzeichnete, hinter denen ein falsches Gebiß sichtbar war. Bei diesem Lachen entdeckte Raphaels lebhafte Phantasie die frappierende Ähnlichkeit dieses Gesichts mit dem Typus des Kopfes, den die Maler Goethes Mephistopheles gegeben haben. Tausend abergläubische Vorstellungen bemächtigten sich Raphaels starker Seele, auf einmal glaubte er an die Macht des Teufels, an all die Hexenkünste, die in den Legenden des Mittelalters überliefert und von den Dichtern aufgegriffen worden sind. Ihn schauderte vor dem Schicksal Fausts, er rief den Himmel an, denn den Sterbenden gleich erfüllte ihn plötzlich ein glühender Glaube an Gott und die Jungfrau Maria. Ein strahlendes Licht ließ ihn den Himmel Michelangelos und Raffaels schauen: Wolkengebilde, einen alten Mann mit weißem Bart, Engelsköpfe, eine schöne Frau, von einem Heiligenschein umgeben. Jetzt begriff er diese wunderbaren Schöpfungen und machte sie sich zu eigen, da ihre geradezu menschlichen Phantasien ihm sein Abenteuer deuteten und ihm noch eine Hoffnung ließen. Als er aber seine Augen wieder ins Foyer der Oper senkte, erblickte er anstelle der Heiligen Jungfrau ein reizendes Mädchen, die verdorbene Euphrasie, die Tänzerin mit dem biegsamen und graziösen Körper, die in einem strahlenden, mit orientalischen Perlen überladenen Gewand ungeduldig auf ihren ungeduldigen Greis zuschritt und sich mit kecker Stirn und blitzenden Augen dreist dieser neidisch lauernden Gesellschaft präsentierte, um den grenzenlosen Reichtum des Händlers zu bezeugen, dessen Schätze sie verschwendete. Raphael entsann sich des spöttischen Wunsches, mit dem er das verhängnisvolle Geschenk des Alten angenommen hatte, und genoß alle Wonnen der Rache, da er nun die tiefe Erniedrigung dieser erhabenen Weisheit sah, deren Sturz noch vor kurzem unmöglich schien. Das Grabeslächeln des Hundertjährigen war an Euphrasie gerichtet, die es mit einem Liebeswort erwiderte; er bot ihr seinen Knochenarm, machte zwei- oder dreimal die Runde um das Foyer, empfing selig die leidenschaftlichen Blicke und die Komplimente, welche die Menge seiner Geliebten zuwarf, ohne das verächtliche Lachen und den beißenden Spott zu bemerken, dessen Gegenstand er war.
»Auf welchem Kirchhof hat dieser junge Vampir den Leichnam ausgescharrt?« rief der eleganteste der Romantiker.
Euphrasie lächelte. Der Spötter war ein schlanker junger Mann mit blonden Haaren, blauen, strahlenden Augen und einem Schnurrbart; er trug einen kurzen Frack, den Hut auf dem Ohr, war nicht auf den Mund gefallen: ganz die Sprache der neuen Schule.
»Wie viele Greise«, sagte sich Raphael im stillen, »krönen ein ehrbares, arbeitsames, tugendhaftes Leben mit einer Torheit! Der steht schon mit den Füßen im Grab und hält sich eine Geliebte.«
»Nun, wie ist es?« rief er den Händler an und liebäugelte mit Euphrasie; »erinnern Sie sich nicht mehr der strengen Grundsätze Ihrer Philosophie?«
»Ach«, antwortete der Händler mit schon gebrochener Stimme, »ich bin jetzt glücklich wie ein Jüngling! Ich hatte das Leben verkehrt angefangen. In einer Liebesstunde liegt ein ganzes Leben.«
In diesem Augenblick ertönte das Klingelzeichen, und die Zuschauer verließen das Foyer, um sich auf ihre Plätze zu begeben. Der Alte und Raphael trennten sich. Als der Marquis in seine Loge trat, bemerkte er Fœdora, die ihm gerade gegenüber auf der anderen Seite des Theaters saß. Sie war offenbar eben erst gekommen, löste ihren Schal, entblößte den Hals und vollführte all die unbeschreiblichen kleinen Bewegungen einer Kokotte, die sich zur Schau stellt: alle Blicke waren auf sie gerichtet. Ein junger Pair von Frankreich begleitete die Comtesse; sie ließ sich von ihm das Opernglas reichen, das sie ihm zu tragen gegeben hatte. An ihren Gesten, an der ganzen Art, wie sie den neuen Verehrer ansah, erriet Raphael, welcher Tyrannei sein Nachfolger unterworfen war. Sicher ebenso bezaubert, ebenso betrogen wie einst er selber und wie er mit der ganzen Kraft einer wahren Liebe gegen die kalten Berechnungen dieser Frau ankämpfend, mußte dieser junge Mann Qualen erleiden, auf die Valentin zu seinem Glück verzichtet hatte. Nachdem Fœdora ihr Opernglas auf alle Logen gerichtet und mit einem Blick die Toiletten gemustert hatte, strahlte unbeschreibliche Freude aus ihrem Gesicht; denn sie hatte sich vergewissert, daß sie mit ihrem Schmuck und ihrer Schönheit die schönsten und elegantesten Frauen von Paris ausstach; sie lachte, um ihre weißen Zähne zu zeigen, und neigte ihren blumengeschmückten Kopf lebhaft, um sich bewundern zu lassen. Ihr Blick glitt von Loge zu Loge; mal machte sie sich über ein Barett lustig, das schlecht auf dem Kopf einer russischen Fürstin saß, mal über einen geschmacklosen Hut, der einer Bankierstochter abscheulich schlecht stand. Plötzlich wurde sie blaß, sie war den starren Augen Raphaels begegnet; ihr verschmähter Liebhaber schmetterte sie mit einem unerträglichen Blick der Verachtung nieder. Keiner ihrer in Ungnade gefallenen Liebhaber entzog sich ihrer Macht, nur Raphael war, als einziger von allen, gegen ihre Verführungskünste gefeit. Eine Macht, der man ungestraft trotzen kann, nähert sich dem Untergang. Dieser Grundsatz ist in ein Frauenherz tiefer eingegraben als in das Hirn der Könige. So sah denn Fœdora in Raphael das Ende ihres Ruhms und ihrer Koketterie. Ein Wörtchen, das er gestern in der Oper hatte fallenlassen, war in sämtlichen Pariser Salons von Mund zu Mund gegangen. Der schneidende Witz dieses furchtbaren Epigramms hatte die Comtesse unheilbar verletzt. Wir können in Frankreich zwar eine Wunde ausbrennen, aber wir kennen noch kein Heilmittel gegen den Schaden, den ein Wort anrichtet. In dem Augenblick, da alle Frauen abwechselnd auf den Marquis und auf sie blickten, hätte Fœdora ihn in ein Verlies der Bastille stürzen mögen; denn trotz all ihrer Verstellungskunst, die Rivalinnen errieten, wie sie litt. Und schließlich wurde sie ihres letzten Trostes beraubt. Die köstlichen Worte: »Ich bin die Schönste!«, dieser ewige Satz, der alle Kümmernisse ihrer Eitelkeit besänftigte, fing an zur Lüge zu werden. Während des Vorspieles zum zweiten Akt nahm eine Frau in Raphaels Nähe Platz, in der Nachbarloge, die bis dahin leer geblieben war. Aus dem Parterre drang ein Murmeln der Bewunderung. Alle Augen und alle Sinne in diesem Meer von menschlichen Gesichtern waren auf die Unbekannte gerichtet. Jung und alt gerieten in eine so lang anhaltende Unruhe, daß die Musiker im Orchester sich, während der Vorhang hochging, erst einmal umdrehten, um Schweigen zu gebieten; aber auch sie brachen in beifällige Rufe aus und vermehrten so den wirren Lärm. Lebhafte Unterhaltung setzte in jeder Loge ein. Die Frauen hatten sich alle mit ihren Operngläsern bewaffnet, Greise wurden wieder jung und putzten mit dem Leder ihrer Handschuhe die Lorgnetten. Allmählich flaute die Begeisterung ab; auf der Bühne begann der Gesang; alles kehrte zur Ordnung zurück. Die gute Gesellschaft schämte sich, einer natürlichen Regung nachgegeben zu haben, und nahm wieder die aristokratische Kälte ihrer höfischen Manieren an. Die Reichen wollen über nichts staunen, sie wollen beim ersten Anblick eines schönen Werks den Fehler entdecken, der sie der Bewunderung – einem niederen Empfinden – enthebt. Indessen blieben doch einige Männer reglos, ohne die Musik zu hören, in naiver Bewunderung verloren und hörten nicht auf, Raphaels Nachbarin zu betrachten. Valentin bemerkte in einer Parterreloge neben Aquilina das gemeine, blutunterlaufene Gesicht Taillefers, der ihm wohlwollend zugrinste. Dann sah er Émile, der in seiner Orchesterloge stand und ihm zu sagen schien: »Aber sieh doch das himmlische Geschöpf neben dir an!« Schließlich entdeckte er noch Rastignac, der neben Madame de Nucingen und ihrer Tochter saß und die Handschuhe unruhig in der Hand ballte, als sei er verzweifelt, an seinen Platz gebannt zu sein und nicht zu der entzückenden Unbekannten eilen zu können. Raphaels Leben hing von einem Pakt ab, den er mit sich selbst geschlossen und bis jetzt noch nicht verletzt hatte: er hatte sich gelobt, niemals ein weibliches Wesen aufmerksam anzusehen; und um sich vor jeder Versuchung zu schützen, benutzte er ein Opernglas, dessen Gläser so kunstvoll geschliffen waren, daß es die Harmonie der schönsten Züge zerstörte und ihnen ein häßliches Aussehen gab. Raphael stand noch unter dem Eindruck des Entsetzens, das ihn heute morgen ergriffen hatte, als sich der Talisman auf einen bloß aus Höflichkeit geäußerten Wunsch unverzüglich zusammengezogen hatte, und war fest entschlossen, sich nicht nach seiner Nachbarin umzuwenden. Er saß da wie eine Herzogin, mit dem Rücken gegen die Ecke seiner Loge und nahm der Unbekannten rücksichtlos den halben Ausblick auf die Bühne, geradeso, als wäre sie für ihn Luft, als wüßte er gar nicht, daß eine schöne Frau hinter ihm saß. Die Nachbarin ahmte Valentins Stellung genau nach. Sie hatte ihren Ellbogen auf die Brüstung der Loge gestützt und wandte den Kopf zu drei Vierteln den Sängern zu; es sah aus, als säße sie einem Maler. Die beiden glichen zwei verzankten Liebenden, die schmollen, sich den Rücken zukehren und sich beim ersten Liebeswort wieder um den Hals fallen. Manchmal streiften die leichten Marabufedern oder die Haare der Unbekannten Raphaels Kopf und erregten ein sinnliches Gefühl in ihm, gegen das er sich tapfer wehrte; bald spürte er die schmeichelnde Berührung der Spitzenrüschen, mit denen ihr Kleid besetzt war, vernahm das seidige Rascheln der Falten, ein frauliches Geräusch, süß und bestrickend; endlich teilten sich die kaum merklichen Atembewegungen der Brust, des Rückens, der Kleider der schönen Frau, ihr ganzes holdes Leben Raphael mit, wie ein elektrischer Funke, der überspringt. Der Tüll und die Spitzen, die an seiner Schulter hinstrichen, übertrugen ihm getreulich die köstliche Wärme dieses weißen nackten Rückens. War es eine Laune der Natur, daß diese beiden durch den guten Ton getrennten und durch die Abgründe des Todes geschiedenen Wesen im selben Takt atmeten und vielleicht aneinander dachten? Ein durchdringendes Aloeparfüm berauschte Raphael vollends. Seine Einbildungskraft, durch ein Hindernis gereizt und die ihr aufgezwungenen Fesseln bis ins Phantastische gesteigert, entwarf gedankenschnell in feurigen Linien das Bild einer Frau. Er wandte sich rasch um. Die Unbekannte, der es gewiß unangenehm war, mit einem Fremden in Berührung zu kommen, machte die gleiche Bewegung; ihre Gesichter, die derselbe Gedanke beseelte, verharrten einander unmittelbar gegenüber.
»Pauline!«
»Monsieur Raphael!«
Starr vor Staunen, sahen sie einander einen Augenblick lang schweigend an. Raphael sah Pauline in schlichter und geschmackvoller Toilette. Durch den Schleier, der ihren Busen keusch verhüllte, hätte ein scharfes Auge die lilienweiße Haut sehen und Formen erraten können, die jede Frau bewundern würde. Dazu bestach sie wie einst durch ihre jungfräuliche Bescheidenheit, ihre himmlische Unschuld, ihre anmutige Haltung. Der Stoff ihres Ärmels verriet das Zittern, welches sich von ihrem bebenden Herzen auf ihren Körper übertrug.
»Oh«, sagte sie, »kommen Sie morgen in das Hotel Saint-Quentin und holen Sie Ihre Papiere! Ich bin um zwölf Uhr dort. Seien Sie pünktlich!«
Sie stand rasch auf und entfernte sich. Raphael wollte Pauline folgen, fürchtete, sie zu kompromittieren, blieb, sah Fœdora an und fand sie häßlich; da er aber der Musik nicht mehr zu folgen vermochte, in dem Saal fast erstickte und das Herz ihm überströmte, stand er auf und fuhr nach Hause zurück.
»Jonathas«, sagte er zu seinem alten Diener, als er im Bett lag, »gib mir ein Tröpfchen Laudanum14 auf ein Stückchen Zucker und wecke mich morgen erst zwanzig Minuten vor zwölf Uhr.«
»Ich will von Pauline geliebt werden!« rief er am nächsten Tag und blickte mit unbeschreiblicher Angst auf den Talisman.
Das Leder bewegte sich nicht um ein Haarbreit, es sah aus, als hätte es seine Kraft, sich zusammenzuziehen, eingebüßt. Ohne Frage konnte es einen Wunsch, der schon erfüllt war, nicht noch einmal erfüllen.
»Ah!« rief Raphael. Er fühlte sich wie von einem bleiernen Mantel befreit, der seit dem Tage, an dem er den Talisman erhalten hatte, auf ihm lastete.
»Du lügst«, rief er aus, »du gehorchst mir nicht, der Pakt ist gebrochen! Ich bin frei, ich werde leben. Alles war nur ein schlechter Scherz.«
Während er diese Worte sprach, wagte er nicht, an seine eigenen Gedanken zu glauben. Er kleidete sich so einfach wie früher und ging zu Fuß in seine einstige Wohnung. Unterwegs versuchte er, sich in jene glücklichen Tage zurückzuversetzen, wo er sich gefahrlos seinen rasenden Begierden überlassen konnte, wo er noch nicht allen menschlichen Freuden abgeschworen hatte. So ging er seines Wegs, sah Pauline vor sich, nicht mehr die Pauline des Hotel Saint-Quentin, sondern die des vergangenen Abends, diese vollendete Geliebte, die er so oft erträumt hatte, ein kluges, liebevolles junges Mädchen, das künstlerisches Gefühl besaß, Dichter und Dichtung verstand und im Luxus lebte; mit einem Wort: Fœdora, nur mit einer schönen Seele begabt, oder Pauline als Comtesse und zweifache Millionärin, wie Fœdora es war. Als er auf der abgetretenen Schwelle stand, auf der zerbrochenen Fliese an dieser Tür, wo er so oft mit seinen verzweifelten Gedanken gestanden hatte, trat eine alte Frau aus dem Vorsaal und fragte ihn:
»Sind Sie nicht Monsieur Raphael de Valentin?«
»Jawohl, gute Frau«, antwortete er.
»Sie kennen Ihr altes Zimmer«, fuhr sie fort, »Sie werden dort erwartet.«
»Wird dieses Haus nicht mehr von Madame Gaudin geführt?« fragte Raphael.
»O nein, Monsieur, Madame Gaudin ist jetzt Baronin. Sie wohnt in einem schönen Haus, das ihr gehört, auf der anderen Seite des Flusses. Ihr Mann ist zurückgekehrt. Ja, sehen Sie, der hat einen schönen Batzen Geld mitgebracht. Die Leute sagen, sie könnte das ganze Quartier Saint-Jacques kaufen, wenn sie wollte. Sie hat mir die ganze Einrichtung und die restliche Pacht umsonst überlassen. Ja, sie ist eine gute Frau geblieben. Sie ist heute nicht stolzer, als sie gestern war.«
Raphael stieg langsam zu seiner Mansarde hinauf. Als er die letzten Treppenstufen erreichte, hörte er die Klänge des Klaviers. Pauline war da; sie trug ein einfaches Kattunkleid; aber der Schnitt des Kleides, die Handschuhe, der Hut, der Schal, nachlässig aufs Bett geworfen, sprachen von großem Reichtum. »Aber da sind Sie ja!« rief Pauline und wandte sich um. Sie sprang rasch auf und verhehlte ihre Freude nicht. Raphael setzte sich neben sie. Er war errötet, beschämt, glücklich. Er betrachtete sie, ohne ein Wort zu sagen.
»Warum haben Sie uns denn verlassen?« fragte sie, schlug die Augen nieder, und purpurne Röte überzog ihr Antlitz. »Wie ist es Ihnen ergangen?«
»Ach, Pauline, ich war sehr unglücklich und bin es noch!«
»Ach!« rief sie bewegt; »ich habe Ihr Schicksal gestern abend geahnt. Ich sah, wie fein Sie gekleidet waren, wie reich Sie aussahen, aber in Wirklichkeit, nicht wahr, Monsieur Raphael, ist es immer noch wie früher?«
Valentin konnte die Tränen nicht zurückhalten, die aus seinen Augen rollten. »Pauline! …« rief er. »Ich …«
Er brach ab. Seine Augen strahlten vor Liebe, und sein ganzes Herz lag in seinen Blicken.
»Oh! Er liebt mich! Er liebt mich!« rief Pauline.
Raphael nickte stumm. Er fühlte sich außerstande, ein einziges Wort hervorzubringen. Bei dieser Bewegung ergriff das junge Mädchen seine Hand, drückte sie und sagte bald lachend, bald schluchzend: »Wir sind reich, reich, glücklich und reich! Deine Pauline ist reich! Aber heute müßte ich eigentlich sehr arm sein. Ich habe tausendmal gesagt, ich wollte für dieses Wort: »Er liebt mich!« alle Schätze der Erde geben. O mein Raphael! Ich besitze Millionen. Du liebst den Luxus, du sollst zufrieden sein; aber du mußt auch mein Herz lieben; es lebt soviel Liebe für dich darin! Du weißt es noch nicht? Mein Vater ist zurückgekommen. Ich bin eine reiche Erbin. Meine Mutter und er überlassen es mir, über mein Leben frei zu bestimmen; ich bin frei, verstehst du?«
Raphael war wie im Taumel; er hielt Paulines Hände und küßte sie so glühend, so gierig ungestüm, ja fast gewaltsam. Pauline machte ihre Hände frei, legte sie auf Raphaels Schultern und zog ihn an sich; sie umfingen, umarmten und küßten sich mit der heiligen, köstlichen Glut, die keinen anderen Gedanken kennt und die man in einem einzigen Kuß empfängt, im ersten Kuß, wenn zwei Seelen Besitz voneinander ergreifen.
»Ach!« rief Pauline und sank in den Stuhl zurück. »Ich will dich nie mehr verlassen. Ich weiß nicht, woher ich soviel Kühnheit nehme!« setzte sie errötend hinzu.
»Kühnheit, meine Pauline? Oh, fürchte nichts, das ist die Liebe, die wahre Liebe, so tief, so ewig wie die meine. Ist es nicht so?«
»Oh! sprich, sprich!« rief sie; »dein Mund war so lange stumm für mich!«
»Du liebtest mich also?«
»O Gott! ob ich dich liebte! Wie oft habe ich geweint, hier, wenn ich dein Zimmer aufräumte, wie oft habe ich dein und mein Elend beklagt. Ich hätte mich dem Teufel verschrieben, um dir einen Kummer zu ersparen! Heute ›mein Raphael‹ sagen zu dürfen. Ja, du bist mein; mein dieser schöne Kopf, mein dein Herz! O ja, dein Herz vor allem, ein unergründlicher Schatz! Nun, wo hielt ich vorhin inne?« fuhr sie nach einer kurzen Pause fort. »Ja, siehst du, wir haben drei, vier, fünf Millionen, glaube ich. Wenn ich arm wäre, würde ich mir vielleicht wünschen, deinen Namen zu tragen, deine Frau genannt zu werden; jetzt aber möchte ich dir die ganze Welt opfern, möchte ich noch immer deine Magd sein und immer und ewig bleiben. Siehst du, Raphael, wenn ich dir heute mein Herz, meine Person, mein Vermögen darbringe, gebe ich dir nicht mehr als damals, als ich hier hinein« – sie zeigte auf die Tischlade – »ein gewisses 100-Sous-Stück schob. Oh! wie hat mir damals deine Freude weh getan!«
»Warum bist du reich?« rief Raphael. »Warum bist du nicht eitel? Ich kann nichts für dich tun!«
Er rang die Hände vor Glück, vor Verzweiflung, vor Liebe.
»Wenn du die Marquise de Valentin sein wirst, ich kenne dich, himmlisches Herz, werden dieser Titel und mein Vermögen dir nicht soviel wert sein …«
»Wie ein einziges Haar von dir!« rief sie.
»Auch ich habe Millionen; aber was ist jetzt für uns der Reichtum? Ach, ich habe mein Leben, das kann ich dir bieten, nimm es!«
»Oh, deine Liebe, Raphael, deine Liebe wiegt die Welt auf. Wie, dein Denken gehört mir? So bin ich die Glücklichste aller Glücklichen!«
»Man wird uns hören«, sagte Raphael.
»Ach, es ist kein Mensch da«, gab sie übermütig zurück.
»Dann komm!« rief Valentin und breitete die Arme aus.
Sie sprang auf seine Knie und umschlang Raphaels Hals.
»Küssen Sie mich«, sprach sie, »um des Kummers willen, den ich um Ihretwillen erlitt, um die Schmerzen zu tilgen, die Ihre Freuden mir zugefügt haben, um all der Nächte willen, die ich wach saß, um meine Lichtschirme zu bemalen …«
»Deine Schirme?«
»Da wir reich sind, mein Schatz, kann ich dir alles sagen. Armer Junge! wie leicht ist es doch, geistvolle Männer zu täuschen! Konntest du für drei Francs Waschgeld im Monat zweimal in der Woche weiße Westen und saubere Hemden haben? Trankst du nicht doppelt so viel Milch, als dir für dein Geld zukam? Ich führte dich in allem an: mit dem Feuer, dem Öl und auch mit dem Geld! Liebster Raphael, nimm mich nicht zur Frau, ich bin eine zu raffinierte Person.« Sie lachte.
»Aber wie hast du das nur gemacht?«
»Ich arbeitete bis zwei Uhr morgens und gab meiner Mutter die Hälfte des Erlöses für meine Lichtschirme und dir die andere Hälfte.«
Sie sahen sich an. Beide waren vor Glück und Liebe wie betäubt.
»Oh!« rief Raphael, »wir müssen sicher dieses Glück einmal mit einem furchtbaren Schmerz bezahlen.«
»Bist du verheiratet?« rief Pauline angstvoll; »oh, ich will dich keiner Frau überlassen.«
»Ich bin frei, mein Liebes.«
»Frei!« wiederholte sie; »frei und mein!«
Sie sank auf die Knie, faltete die Hände und sah Raphael mit inbrünstiger Glut an.
»Ich fürchte toll zu werden. Wie schön du bist!« fuhr sie fort und strich mit der Hand über das blonde Haar ihres Geliebten. »Ist sie dumm, deine Comtesse Fœdora! Wie freute ich mich gestern abend, als all diese Menschen mir huldigten! Sie ist nie so begrüßt worden, sie nicht! Denk doch, Lieber, als mein Rücken gestern deinen Arm berührte, hörte ich eine innere Stimme, die mir zurief: »Er ist da!« Ich habe mich umgedreht und sah dich. Oh, ich flüchtete, denn ich fühlte das Verlangen, dir vor aller Welt um den Hals zu fallen.«
»Wie glücklich du bist, daß du sprechen kannst!« rief Raphael. »Mir ist das Herz zugeschnürt. Ich möchte weinen und kann nicht. Zieh deine Hand nicht zurück. Mir ist, als ob ich mein Leben lang dich nur immer ansehen müßte, zufrieden und glücklich.«
»Oh, sag das noch einmal, Geliebter!«
»Ach, was sind Worte!« versetzte Valentin, und seine heißen Tränen fielen auf Paulines Hände. »Später will ich versuchen, dir von meiner Liebe zu sprechen; jetzt kann ich sie nur fühlen …«
»Oh!« rief sie, »diese schöne Seele, dieser große Geist, dieses Herz, das ich so gut kenne, das gehört alles mir, wie ich dir gehöre?«
»Für immer, du holdes Geschöpf«, sagte Raphael bewegt; »du wirst meine Frau sein, mein guter Engel. Deine Gegenwart hat immer meine Sorgen verscheucht und meine Seele erquickt; in diesem Augenblick hat mich dein himmlisches Lächeln gleichsam gereinigt. Mir ist, als beginne ich ein neues Leben. Die grausame Vergangenheit und meine traurigen Torheiten scheinen mir nur noch böse Träume zu sein. Ich bin rein, wenn ich bei dir bin. Ich spüre den Hauch des Glücks. O bleib immer bei mir!« Er drückte sie innig an sein schnell pochendes Herz.
»Nun mag der Tod kommen, wann er will«, rief Pauline verzückt, »ich habe gelebt!«
Glücklich, wer ihre Wonnen errät, er hat sie empfunden!
»Mein Raphael«, sagte Pauline nach Stunden des Schweigens, »ich wollte, kein Mensch käme je mehr in unsere liebe Mansarde.«
»Da muß die Tür vermauert und das Dachfenster vergittert werden; wir müssen das Haus kaufen«, versetzte der Marquis.
»Das ist das Rechte«, sagte sie. Einen Augenblick später fiel ihr ein: »Wir haben eigentlich vergessen, deine Manuskripte zu suchen!«
Sie fingen in süßer Unschuld zu lachen an.
»Bah! ich spotte aller Wissenschaft!« rief Raphael.
»Ah! Und wo ist der Herr, der nach dem Ruhm begehrte?«
»Du bist mein einziger Ruhm.«
»Du warst sehr unglücklich, als du diese kleinen Krähenfüße maltest«, sagte sie und blätterte in den Papieren.
»Meine Pauline …«
»O ja, ich bin deine Pauline. Nun?«
»Wo wohnst du eigentlich?«
»In der Rue Saint-Lazare. Und du?«
»Rue de Varennes.«
»Wie weit wir voneinander sind, bis …« Sie hielt inne und sah ihren Geliebten kokett und schelmisch an.
»Aber«, versetzte Raphael, »wir werden höchstens noch vierzehn Tage getrennt sein.«
»Wahrhaftig! In vierzehn Tagen sind wir Mann und Frau!« Sie sprang umher wie ein kleines Kind. »Oh!« fuhr sie dann fort, »ich bin ein entartetes Kind, ich denke nicht mehr an Vater und Mutter, noch sonstwas auf der Welt! Du weißt nicht, Liebster, daß mein Vater sehr krank ist. Er ist sehr leidend aus Indien zurückgekehrt. In Le Havre, wo wir ihn abgeholt haben, lag er auf den Tod darnieder. Mein Gott«, sie sah auf die Uhr, »es ist schon drei Uhr. Ich muß bei ihm sein, wenn er um vier Uhr aufwacht. Ich bin Herrin im Haus: meine Mutter tut, was ich will, und mein Vater betet mich an; aber ich will ihre Güte nicht mißbrauchen, das wäre nicht recht! Der arme Vater, er war es, der mich gestern in die Italienische Oper geschickt hat. Du besuchst ihn morgen, nicht wahr?«
»Wollen Madame la Marquise de Valentin mir die Ehre erweisen, meinen Arm zu nehmen?«
»Ach, ich will den Schlüssel zu dieser Kammer mitnehmen«, sagte sie. »Ist sie nicht ein Palast, diese holde Kammer?«
»Pauline, noch einen Kuß!«
»Tausend! Mein Gott«, sagte sie und sah Raphael ins Auge, »so soll es immer bleiben. Ich glaube zu träumen.«
Sie stiegen langsam die Treppe hinab; dann gingen sie einträchtig nebeneinander, in gleichem Schritt, in gleicher Glückseligkeit erbebend, eng aneinandergeschmiegt wie zwei Tauben, bis zur Place de la Sorbonne, wo Paulines Wagen wartete.
»Ich will mit zu dir fahren. Ich will dein Zimmer, dein Kabinett sehen und mich an den Tisch setzen, an dem du arbeitest. Dann wird es sein wie früher«, setzte sie errötend hinzu. – »Joseph«, befahl sie einem Diener, »ich fahre in die Rue de Varennes, ehe ich nach Hause zurückkehre. Es ist Viertel vier, und um vier muß ich zu Hause sein, Georges soll die Pferde antreiben.«
In wenigen Augenblicken waren die beiden Liebenden in Valentins Palast.
»Oh, wie gut, daß ich das alles gesehen habe!« rief Pauline und knüllte die Seide von Raphaels Bettvorhängen in ihrer Hand. »Wenn ich einschlafe, werde ich in Gedanken hier sein. Ich werde deinen lieben Kopf auf diesem Kissen vor mir sehen. Sage mir, Raphael, es hat dich niemand bei der Einrichtung deines Hauses beraten?«
»Niemand.«
»Ganz sicher? Hat gewiß keine Frau …«
»Pauline!«
»Oh, ich bin furchtbar eifersüchtig! Du hast einen guten Geschmack. Ich will morgen ebenso ein Bett haben wie deines.«
Raphael war trunken vor Glück, er umarmte Pauline.
»Oh, mein Vater, mein Vater!« rief sie.
»Ich will dich nach Hause begleiten; ich will so selten wie möglich ohne dich sein.«
»Wie du lieben kannst! Ich wagte es dir nicht vorzuschlagen …«
»Bist du denn nicht mein Leben?«
Es wäre ermüdend, all dieses entzückende Liebesgeplauder wortgetreu aufzuzeichnen, dem der Ton, der Blick, eine unbeschreibliche Gebärde allein Wert verleihen. Valentin begleitete Pauline bis zu ihrem Hause und kehrte dann zurück, das Herz voller Freude, wie der Mensch hienieden nur empfinden und ertragen kann. Als er in seinem Lehnstuhl am Kamin saß und an die plötzliche und völlige Erfüllung all seiner Hoffnungen dachte, drang ihm ein Gedanke in die Seele, eisig wie der Stahl eines Dolches, der die Brust durchbohrt; er sah nach dem Chagrinleder, es war etwas kleiner geworden. Er stieß den großen Lieblingsfluch der Franzosen ohne die jesuitischen Weglassungen der Äbtissin15 von Andouillettes aus, ließ den Kopf in den Stuhl zurücksinken und blieb reglos liegen; seine Augen waren auf eine Rosette gerichtet, aber er sah sie nicht.
»Großer Gott!« rief er aus. »Alle meine Wünsche, alle! Arme Pauline!«
Er nahm einen Zirkel und maß, wieviel Leben ihm der Vormittag gekostet hatte.
»Mir bleiben kaum noch zwei Monate!« stöhnte er.
Kalter Schweiß brach aus seinen Poren; dann gab er plötzlich einem unaussprechlichen Wutanfall nach, ergriff das Chagrinleder und rief: »Was bin ich für ein Narr!« Er eilte hinaus, lief durch die Gärten und warf das Leder in einen tiefen Brunnen. »Und nun komme, was mag!« rief er. »Zum Teufel mit all diesem Unsinn!«
Raphael überließ sich also dem Liebesglück und lebte Herz an Herz mit Pauline. Ihre Hochzeit, durch Schwierigkeiten verzögert, die zu erzählen sich nicht lohnt, sollte in den ersten Tagen des März gefeiert werden. Sie hatten sich geprüft, zweifelten nicht aneinander, und da das Glück ihnen die ganze Tiefe ihrer Neigung enthüllt hatte, waren nie zwei Herzen, zwei Naturen so völlig eins, wie sie es durch ihre Liebe waren. Je vertrauter sie einander wurden, desto mehr liebten sie sich, beide in gleicher Reinheit und gleicher Zartheit, gleicher Wollust, der süßesten Wollust, der Wollust der Engel; keine Wolke trübte ihren Himmel; die Wünsche des einen waren das Gesetz des anderen. Da sie alle beide reich waren, gab es für sie keine Launen; die sie nicht befriedigen konnten, und daher hatten sie überhaupt keine Launen. Ein erlesener Geschmack, Gefühl für das Schöne, wahre Poesie lebten in der Seele der Braut; sie verachtete den teuren Flitterputz der Frauen, und ein Lächeln ihres Geliebten schien ihr schöner als alle Perlen von Ormuz; Musselin und Blumen waren ihr reichster Schmuck. Pauline und Raphael flohen überdies die Welt, die Einsamkeit war für sie so hold, so freudenvoll! Die Müßiggänger sahen das schöne, heimliche Paar jeden Abend in der Italienischen oder der Großen Oper. Wenn auch anfangs allerlei übler Klatsch in den Salons verbreitet wurde, ließ der Strom der Ereignisse, der Paris durchflutete, zwei harmlose Liebesleute bald in Vergessenheit geraten; schließlich war es für die Prüden eine Art Entschuldigung, daß ihre Hochzeit angekündigt war, und da ihre Dienerschaft zufällig verschwiegen war, strafte sie keine zu scharfe Bosheit für ihr Glück.
Gegen Ende Februar, da schöne Tage schon die Freuden des Frühlings verhießen, frühstückten Pauline und Raphael eines Morgens zusammen in einem kleinen Gewächshaus, einer Art Salon voller Blumen, von dem aus man unmittelbar in den Garten gelangte. Die milde, blasse Wintersonne, deren Strahlen durch seltene Sträucher brachen, erwärmte bereits die Luft. Die Augen wurden durch die kräftigen Gegensätze des verschiedenen Laubwerks, durch die Farben der blühenden Blumenbüschel und durch die Spiele von Licht und Schatten erquickt. Während sich noch ganz Paris am tristen Kaminfeuer wärmte, lachten die beiden jungen Liebenden schon vergnügt unter einer Laube von Kamelien, Flieder und Erika. Ihre fröhlichen Gesichter tauchten aus Narzissen, Maiglöckchen und bengalischen Rosen hervor. In diesem üppigen und reichen Gewächshaus schritten die Füße auf einer afrikanischen Matte, bunt wie ein Teppich. Die mit festem grünen Stoff bespannten Wände ließen keinerlei Feuchtigkeit durch. Die Möbel waren allem Anschein nach aus rohem Holz gefertigt, dessen geglättete Rinde jedoch vor Sauberkeit glänzte. Ein junges Kätzchen hockte, vom Duft der Milch angelockt, auf dem Tisch und ließ sich von Pauline mit Kaffee besprenkeln; Pauline neckte es, zog ihm die Sahne weg, an der es gerade mal schnuppern durfte, um es in Geduld zu üben und das mutwillige Spiel fortzusetzen; sie brach bei jedem seiner possierlichen Bewegungen in Lachen aus und verfiel auf tausenderlei Scherze, um Raphael am Lesen der Zeitung zu hindern, die ihm wohl schon zehnmal aus den Händen gefallen war. Es lag in dieser Morgenszene eine Fülle unaussprechlichen Glücks, wie in allem, was natürlich und wahr ist. Raphael tat immer so, als läse er sein Blatt, beobachtete indes verstohlen Pauline bei ihren Neckereien mit der Katze, seine Pauline, in einen langen Morgenmantel gehüllt, der sie seinen Blicken nicht völlig verbarg, seine Pauline mit ihrem noch ungeordneten Haar und dem kleinen weißen, blaugeäderten Fuß, der in einem schwarzen Samtpantoffel steckte. In ihrem Négligé war sie entzückend anzusehen, köstlich wie die phantastischen Gestalten von Westall,16 schien sie Mädchen und Frau zugleich zu sein; mehr Mädchen vielleicht als Frau, genoß sie ein ungetrübtes Glück und kannte von der Liebe nur die ersten Wonnen. Kaum hatte Raphael über seiner süßen Träumerei seine Zeitung vergessen, als Pauline nach ihr griff, sie zusammenknüllte, eine Kugel aus ihr ballte und sie in den Garten warf; die Katze sprang der Politik hinterher, die sich wie immer um sich selbst drehte. Als Raphael, von dieser kindlichen Szene erheitert, seine Lektüre fortsetzen und das entschwundene Blatt aufheben wollte, brach frisches, fröhliches Lachen los, das wie der Gesang eines Vogels sich selbst immer von neuem erzeugt.
»Ich bin eifersüchtig auf die Zeitung«, sagte sie und trocknete die Tränen, die bei ihrem kindlichen Gelächter hervorgeschossen waren. »Ist es nicht ein frevelhafter Treubruch«, fuhr sie, plötzlich die Frau hervorkehrend, fort, »daß du in meiner Gegenwart russische Proklamationen liest und daß du die Prosa des Zaren Nikolaus meinen Worten und Blicken der Liebe vorziehst?«
»Ich habe nicht gelesen, geliebter Engel, ich habe dich angesehen.«
In diesem Augenblick hörte man den schweren Schritt des Gärtners herankommen, unter dessen nägelbeschlagenen Stiefeln der Sand der Gartenwege knirschte:
»Entschuldigen Sie, Monsieur le Marquis, wenn ich Sie und Madame störe, aber ich bringe ein Ding, das so seltsam ist, wie ich noch keins gesehen habe. Zieh ich doch eben, mit Respekt zu sagen, einen Eimer Wasser hoch und bringe da diese kuriose Wasserpflanze mit herauf! Hier ist sie! Das Ding muß ganz gut ans Wasser gewöhnt sein, denn es war gar nicht aufgeweicht und nicht einmal feucht. Trocken wie ein Stück Holz und dabei kein bißchen Fett dran. Monsieur le Marquis sind sicher gelehrter als ich, und da dachte ich, ich will es Ihnen bringen, das wird Sie interessieren.«
Damit zeigte der Gärtner Raphael das unerbittliche Chagrinleder, das keine sechs Zoll im Quadrat mehr maß.
»Danke, Vanière«, sagte Raphael; »das Ding ist sehr merkwürdig.«
»Was hast du, mein Engel? Du wirst blaß!« rief Pauline.
»Es ist gut. Gehen Sie, Vanière!«
»Deine Stimme ängstigt mich«, fing das junge Mädchen wieder an, »sie ist seltsam verändert. Was hast du? Wie fühlst du dich? Wo tut es dir weh? Dir ist nicht wohl! – Ein Arzt!« rief sie; »Jonathas, zu Hilfe!«
»Sei still, liebe Pauline!« erwiderte Raphael, der sich wieder gefaßt hatte; »wir wollen hinausgehen. Hier in der Nähe muß eine Blume sein, deren Duft mir Übelkeit erregt. Vielleicht ist es dieses Eisenkraut?«
Pauline stürzte sich auf den unschuldigen Strauch, riß ihn heraus und warf ihn in den Garten.
»O mein Alles!« rief sie, umschlang Raphael fest und stark wie ihre Liebe und bot ihm mit beseligender Hingabe ihre glühenden Lippen zum Kuß; »als ich dich erbleichen sah, wußte ich, daß ich dich nicht überleben würde: dein Leben ist mein Leben! Raphael, mein Raphael, leg deine Hand auf meinen Rücken! Ich spüre noch den frostigen Schauer dort, noch die Kälte. Deine Lippen glühen. Und deine Hand? … Sie ist eiskalt.«
»Närrisches Kind!« rief Raphael.
»Was soll diese Träne?« fragte sie. »Laß mich sie trinken.«
»O Pauline, Pauline, du liebst mich zu sehr!«
»Es geht etwas Außerordentliches mit dir vor, Raphael. Sag mir die Wahrheit, ich werde dein Geheimnis doch bald erfahren. Gib mir das!« Damit griff sie nach dem Chagrinleder.
»Du bist mein Henker!« rief der junge Mann und warf einen grauenvollen Blick auf den Talisman.
»Wie verändert deine Stimme ist!« erwiderte Pauline und ließ den verhängnisvollen Schicksalskünder fallen.
»Hast du mich lieb?« fragte er.
»Ob ich dich liebe, ist das eine Frage?«
»Nun, dann laß mich, geh!«
Das arme Kind ging.
»Wie!« rief Raphael, als er allein war, »in einem Jahrhundert der Aufklärung, da wir gelernt haben, daß die Diamanten Kristalle des Kohlenstoffs sind, in einer Zeit, da alles eine Erklärung findet, da die Polizei einen neuen Messias vor Gericht stellen und seine Wunder von der Akademie der Wissenschaften prüfen lassen würde, in einer Zeit, da wir an nichts mehr glauben als an die Unterschrift der Notare, da sollte ausgerechnet ich! an eine Art Menetekel17 glauben? Nein, bei Gott! ich will nicht denken, daß das höchste Wesen Vergnügen daran finden kann, ein ehrliches Geschöpf zu martern. Ich will die Gelehrten befragen.«
So war er denn bald zwischen der Weinhalle, diesem ungeheuren Lager von Fässern, und der Salpêtriêre,18 dieser ungeheuren Pflanzstätte der Trunksucht, vor einem kleinen Teich angekommen, auf dem sich Enten tummelten, die durch die Seltenheit ihrer Arten bemerkenswert waren und deren schillerndes Federkleid bunt wie die Glasfenster eines Doms in der Sonne funkelte. Es waren da alle Enten der Welt, und sie quakten, schnatterten, wimmelten durcheinander und bildeten eine Art wider Willen einberufenes Entenparlament, zum Glück aber ohne Charta und politische Prinzipien. Sie lebten da, ohne sich vor Jägern fürchten zu müssen, unter den Augen der Naturforscher, die sie gelegentlich betrachteten.
»Da ist Monsieur Lavrille«, sagte einer der Wärter zu Raphael, der nach diesem Hohepriester der Zoologie gefragt hatte.
Der Marquis sah ein kleines Männchen, das beim Anblick zweier Enten tief in weise Betrachtungen versunken schien. Der Gelehrte stand in mittleren Jahren und hatte ein sanftes Gesicht, das durch seine entgegenkommende Miene noch gewann; aber aus seiner ganzen Erscheinung sprach die Zerstreutheit eines Gelehrten: seine Perücke, an der er sich unablässig kratzte, war abenteuerlich auf den Kopf gestülpt, ließ einen Kranz weißer Haare sehen und zeugte von einer Entdeckerwut, die uns, wie alle Leidenschaften, den Dingen dieser Welt so weit entrückt, daß wir das Bewußtsein des eigenen Ichs verlieren. Raphael bewunderte als Mann der Wissenschaft und der Forschung diesen Naturforscher, dessen Nächte der Erweiterung der menschlichen Kenntnisse gewidmet waren und dessen Irrtümer sogar noch Frankreich zum Ruhm gereichten; aber ein Modedämchen hätte ohne Zweifel über die Lücke gelacht, die sich zwischen der Hose und der gestreiften Weste des Gelehrten auftat, obwohl dieser Zwischenraum recht sittsam durch ein Hemd ausgefüllt war, das durch das Bücken und Wiederaufrichten während seiner zoogenetischen Beobachtungen einen reichen Faltenwurf bekommen hatte.
Nach den ersten Höflichkeitsfloskeln hielt Raphael es für nötig, Monsieur Lavrille ein Kompliment über seine Enten zu machen.
»O ja, an Enten sind wir reich«, erwiderte der Naturforscher; »diese Gattung ist übrigens, wie Ihnen sicher bekannt ist, die fruchtbarste in der Ordnung der Schwimmvögel: Sie beginnt beim Schwan und endet bei der Zinzinente und umfaßt 137 verschiedene Arten, die alle einen eigenen Namen, eigene Gewohnheiten, eine eigene Heimat und ein eigenes Aussehen haben und einander nicht ähnlicher sind als ein Weißer und ein Neger. Sie können versichert sein, Monsieur, daß wir, wenn wir eine Ente essen, meistens gar nicht ahnen, wie ausgedehnt …«
Er unterbrach sich, als er eine reizende kleine Ente sah, welche die Böschung des Teiches heraufwatschelte.
»Da ist die Krawattenente, das arme Kind aus Kanada hat so weit herkommen müssen, um uns sein graubraunes Gefieder und seine kleine schwarze Krawatte zu zeigen. Sehen Sie, wie es sich kratzt. Da ist die berühmte Eiderente, auf deren Daunen unsere feinen Damen schlafen; wie hübsch sie ist! Muß nicht jeder diesen niedlichen rötlichweißen Leib, diesen grünen Schnabel bewundern? Eben gerade, Monsieur, war ich Zeuge einer Paarung, die ich bislang kaum erhoffte. Die Hochzeit ist recht glücklich vonstatten gegangen, und ich warte ungeduldig auf das Ergebnis. Ich schmeichle mir, eine 138ste Art zu züchten, die vielleicht meinen Namen erhalten wird. Sehen Sie, da haben wir die Neuvermählten!« Damit deutete er auf zwei Enten. »Die eine ist eine Lachgans (anas albifrons), die andere die große Pfeifente (anas ruffina Buffon). Ich habe lange zwischen der Pfeifente, der Ente mit den weißen Augenlidern und der Löffelente (anas clypeata) geschwankt. Sehen Sie, da ist die Löffelente, der dicke schwarzbraune Schlingel mit dem grünlichen Hals, der so reizend irisiert. Aber die Pfeifente, Monsieur, hat eine prächtige Haube, da werden Sie begreifen, daß ich nicht mehr geschwankt habe. Es fehlt uns hier nur noch die Entenvarietät mit der schwarzen Kappe. Die Herren Zoologen behaupten einstimmig, diese Ente sei nur eine Spielart der krummschnabeligen Knäkente; aber ich für mein Teil …«
Er machte eine bewunderswerte Handbewegung, in der zugleich die Bescheidenheit und der Stolz des Gelehrten lagen; ein eigensinniger Stolz und eine dünkelhafte Bescheidenheit.
»Ich allerdings glaube das nicht«, fuhr er fort. »Sie sehen, Monsieur, wir sind nicht zu unserem Vergnügen hier. Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Monographie der Entengattung. Aber womit kann ich Ihnen dienen?«
Auf dem Weg zu einem recht hübschen Haus in der Rue de Buffon19 trug Raphael Monsieur Lavrille sein Anliegen vor, das Chagrinleder zu untersuchen.
»Ich kenne dieses Produkt«, sagte der Gelehrte endlich, nachdem er den Talisman mit der Lupe genau betrachtet hatte; »es hat einmal irgendwie als Schachteldeckel gedient. Das Chagrinleder ist sehr alt! Heutzutage ziehen die Futteralmacher ein Chagrin vor, der nach seinem Erfinder Galuchat genannt wird. Dieser wird, wie Sie zweifellos wissen, aus der Haut des »raja sephen« gewonnen, eines Fisches, der im Roten Meer …«
»Aber das Stück hier, wenn Sie die Güte haben wollten …«
»Das«, unterbrach ihn der Gelehrte, »ist ganz etwas anderes; der Unterschied zwischen dem Galuchat20 und dem Chagrin ist so groß wie zwischen Ozean und Land, zwischen Fisch und Vierfüßer. Die Haut des Fisches ist härter als die des Landtieres. Das«, damit deutete er auf den Talisman, »ist, wie Sie fraglos wissen, eins der seltsamsten Produkte der Zoologie.«
»Wirklich?« rief Raphael.
»Ja«, erwiderte der Gelehrte und ließ sich in seinen Lehnstuhl sinken, »es ist eine Eselshaut.«
»Das weiß ich«, erwiderte der junge Mann.
»Es gibt in Persien«, fuhr der Naturforscher fort, »einen überaus seltenen Esel, den Onager der Alten, equus asinus, den Kulan der Tataren. Pallas ist hingereist, hat ihn beobachtet und der Wissenschaft wiedergegeben. Dieses Tier hat tatsächlich lange als Fabeltier gegolten. Es ist, wie Sie wissen, durch die Heilige Schrift bekannt; Moses hatte verboten, es mit anderen Arten seiner Gattung zu kreuzen. Aber der Onager ist noch berühmter durch die Abgötterei, die mit ihm getrieben wurde, von der die Propheten oft sprechen. Pallas erklärt, wie Sie ohne Zweifel wissen, in seinen Act. Petrop. Band II, daß diese abnormen Ausschweifungen noch bei den Persern und den nogaischen Tataren zu den religiösen Gebräuchen gehören; sie gelten als unübertreffliches Heilmittel gegen Nierenkrankheiten und Hüftweh. Von solchen Dingen haben wir armen Pariser gar keine Ahnung! Das Museum besitzt keinen Onager. Ein wunderbares Tier! Es steckt voller Geheimnisse; sein Auge ist von einer reflektierenden Haut überzogen, der die Orientalen eine bannende Kraft zuschreiben; sein Fell ist geschmeidiger und glatter als das unserer schönsten Pferde, mit mehr oder weniger hellen falben Streifen und gleicht dem des Zebras. Das Haar hat etwas Molliges, Welliges und fühlt sich fettig an. Sein Blick gleicht an Genauigkeit und Schärfe dem des Menschen. Er ist etwas größer als unsere schönsten Hausesel und hat einen außergewöhnlichen Mut. Wenn er zufällig angefallen wird, wehrt er sich gegen die gefährlichsten Raubtiere mit erstaunlicher Überlegenheit. Die Schnelligkeit seines Galopps kann nur mit dem Flug der Vögel verglichen werden. Ein Onager, Monsieur, würde die besten arabischen und persischen Pferde hinter sich lassen. Den Beschreibungen zufolge, die der Vater des gewissenhaften Dr. Niebuhr ….21 veröffentlicht hat, dessen Verlust wir, wie Sie wissen, seit kurzem beklagen müssen, beträgt die durchschnittliche Geschwindigkeit dieser prächtigen Tiere 7000 Feldmesserschritte22 in der Stunde. Unsere degenerierten Esel können uns von diesem unabhängigen, stolzen Esel gar keine Vorstellung geben. Er hat eine anmutige, lebendige Haltung, einen klugen und verständigen Blick, eine gefällige Erscheinung und überaus zierliche Bewegungen. Er ist der König des Tierreichs im Orient. Die abergläubischen Vorstellungen der Türken und Perser schreiben ihm sogar eine geheimnisvolle Abstammung zu, und der Name Salomos kommt in den Berichten vor, welche in Tibet und der Tatarei von den Heldentaten dieser edlen Tiere erzählen. Ein gezähmter Onager kostet enorme Summen; es ist fast unmöglich, ihn in den Bergen zu fangen, wo er wie ein Reh davonsetzt und wie ein Vogel zu fliegen scheint. Die Sage von den geflügelten Pferden, von unserem Pegasus, hat ihren Ursprung ohne Zweifel in den Ländern, wo Hirten oft einen Wildesel im Sprung von einem Felsen zum anderen beobachten konnten. Die Reitesel, die man in Persien aus der Paarung einer Eselin mit einem gezähmten Onager erlangt, werden nach einer uralten Tradition rot bemalt. Dieser Brauch hat vielleicht zu unserer Redewendung: ›Störrisch wie ein roter Esel‹ Veranlassung gegeben. In einer Zeit, wo die Naturgeschichte in Frankreich sehr im argen lag, wird, so denke ich mir, ein Reisender eins dieser seltsamen Tiere, welche die Sklaverei nur widerwillig ertragen, in unser Land gebracht haben. Daher diese Redensart. Die Haut, die Sie mir hier zeigen, ist die Haut eines Onager. Über den Ursprung des Namens gehen unsere Meinungen auseinander. Die einen behaupten, ›Chagri‹ sei ein türkisches Wort, andere geben an, ›Chagri‹ sei die Stadt, in der diese Tierhaut einer chemischen Prozedur unterworfen werde, die Pallas23 recht gut beschrieben hat und die ihm jene eigenartig genarbte Oberfläche verleiht, die wir so schätzen; Monsieur Martellens hat mir geschrieben, Châagri sei ein Bach.«
»Ich danke Ihnen sehr, daß Sie mir Aufschlüsse gegeben haben, die einem Dom Calmet24 Stoff zu einer trefflichen Anmerkung geben könnten, wenn die Benediktiner noch existierten; aber ich hatte mir mitzuteilen erlaubt, daß dieses Stück ursprünglich so groß war … wie diese Landkarte«, sagte Raphael und wies auf einen aufgeschlagen daliegenden Atlas, »seit drei Monaten aber hat es sich unverkennbar zusammengezogen …«
»Schön«, erwiderte der Gelehrte, »ich verstehe. Monsieur, jede abgezogene Haut, die von einem Lebewesen stammt, ist, wie leicht zu begreifen, einem natürlichen Verfall ausgesetzt, dessen Fortschreiten von atmosphärischen Einflüssen abhängt. Selbst die Metalle dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, und zwar sehr merklich; die Ingenieure zum Beispiel haben ziemlich beträchtliche Lücken zwischen Steinblöcken festgestellt, die ursprünglich von Eisenklammern zusammengehalten wurden. Die Wissenschaft ist lang, und unser Leben ist kurz. So können wir nicht den Anspruch erheben, alle Erscheinungen der Natur zu kennen.«
»Monsieur«, sagte Raphael in einiger Verwirrung, »gestatten Sie, daß ich noch eine sonderbare Frage stelle. Sind Sie ganz sicher, daß dieses Stück Leder den allgemeinen Gesetzen der Natur unterworfen ist; daß es sich ausdehnen läßt?«
»Oh, kein Zweifel! Donnerwetter!« rief Monsieur Lavrille bei seinem Versuch, den Talisman zu strecken: »Nun Monsieur, vielleicht suchen Sie einmal Planchette auf, den berühmten Professor der Mechanik, er wird sicher ein Mittel finden, auf dieses Leder zu wirken, es geschmeidig zu machen und zu dehnen.«
»Ich danke Ihnen, Monsieur, Sie retten mir das Leben!«
Raphael verabschiedete sich von dem gelehrten Naturforscher, eilte zu Planchette und ließ den guten Lavrille in seinem Arbeitskabinett zurück, inmitten all der Glasflaschen und getrockneten Pflanzen. Ohne es zu wissen, hatte er bei seinem Besuch die ganze menschliche Wissenschaft mit auf den Weg bekommen: ein Namenverzeichnis! Der wackere Lavrille ähnelte Sancho Pansa, wie er Don Quijote die Geschichte der Ziegen erzählte; er fand Vergnügen daran, Tiere zu zählen und zu numerieren. Er stand nun am Rande des Grabes und kannte kaum einen kleinen Teil aus der unermeßlichen Zahl der großen Herde, die Gott, wir wissen nicht wozu, über den Ozean der Welten verteilt hat. Raphael war zufrieden. »Ich werde meinen Esel im Zaume halten!« rief er. Sterne hatte vor ihm gesagt: »Wer alt werden will, muß seinen Esel schonen«. Aber das Vieh ist so störrisch.
Planchette war groß und hager, ein richtiger Dichter, der immer in Betrachtung eines unermeßlichen Abgrundes, der Bewegung nämlich, versunken war. Gewöhnliche Menschen halten diese erhabenen Geister, diese Unverstandenen, die bewundernswert unbekümmert um Luxus und weltliches Treiben leben, die ganze Tage lang an einem ausgegangenen Zigarrenstummel kauen und einen Salon betreten, ohne die Knöpfe ihres Anzugs in die geziemende Verbindung mit den Knopflöchern gebracht zu haben, für eine Art Verrückte. Eines Tages haben sie, nachdem sie lange die Leere gemessen oder Reihen von X unter Aa-gG gesetzt haben, irgendein Naturgesetz analysiert und ein simples Prinzip zerlegt; auf einmal staunt die Menge über eine neue Maschine oder irgendeinen Karren, dessen einfache Konstruktion uns erstaunt und verblüfft. Der bescheidene Gelehrte lächelt und sagt zu seinen Bewunderern: »Was habe ich denn Neues hervorgebracht? Nichts. Der Mensch kann keine Kraft erfinden, er lenkt sie, und die Wissenschaft besteht darin, die Natur nachzuahmen.«
Raphael fand den Mechaniker so starr und steif dastehend, daß er einem Gehenkten glich, der geradewegs vom Galgen gefallen ist. Planchette beobachtete eine Achatmurmel, die auf einer Sonnenuhr rollte und wartete darauf, daß sie stehenbliebe. Der Ärmste hatte weder einen Orden noch ein Ehrengehalt; er verstand es nicht, seine Berechnungen effektvoll publik zu machen. Er war glücklich zu leben, einer Entdeckung auf der Spur zu sein, und dachte dabei weder an den Ruhm noch an die Welt, noch an sich selbst. Er lebte in der Wissenschaft und für die Wissenschaft.
»Das ist unerklärlich!« rief er. »Ah, Monsieur«, unterbrach er sich, als er Raphael bemerkte, »Ihr ergebener Diener. Wie geht’s der Mama? Treten Sie nur bei meiner Frau ein.«
»So hätte ich auch leben können!« dachte Raphael. Er entriß den Gelehrten seinen Träumen, indem er ihm den Talisman zeigte und ihm die Frage vorlegte, wie man auf ihn einwirken könnte. »Sie mögen über meine Leichtgläubigkeit lachen, Monsieur«, sprach der Marquis abschließend, »ich will Ihnen nichts verhehlen. Dieses Stück Leder scheint mir eine Widerstandskraft zu besitzen, die nichts zu zwingen vermag.«
»Verehrter«, antwortete nun Planchette, »die Menschen der Gesellschaft pflegen die Wissenschaft gemeinhin recht von obenherab zu behandeln, und ungefähr sagen sie uns alle das, was ein Stutzer, der nach der Sonnenfinsternis mit ein paar Damen zu Lalande25 kam, zu ihm sagte: »Wollen Sie so freundlich sein, die Sache zu wiederholen.« Welche Wirkung wollen Sie erzielen? Die Mechanik hat die Aufgabe, die Gesetze der Bewegung entweder anzuwenden oder sie unwirksam zu machen. Was die Bewegung an sich angeht, so erkläre ich Ihnen in aller Bescheidenheit, daß wir nicht imstande sind, sie zu definieren. Das dahingestellt, haben wir einige gleichbleibende Erscheinungen beobachtet, welche die Bewegung der festen und flüssigen Körper fortsetzen, ihnen eine Antriebskraft im Verhältnis zu einer bestimmten Geschwindigkeit verleihen, sie fortschleudern, sie einfach oder ins Unendliche teilen, dadurch daß wir sie zerbrechen oder pulverisieren; wir können sie ferner drehen, sie rotieren lassen, sie verändern, zusammendrücken, dehnen, strecken. Diese ganze Wissenschaft beruht auf einer einzigen Tatsache. Sie sehen diese Kugel. Sie befindet sich auf diesem Stein. Jetzt ist sie hier. Wie nennen wir diesen Akt, der physisch so natürlich und geistig so außergewöhnlich ist? Bewegung, Ortswechsel, Ortsveränderung? Welch ungeheurer Dünkel steckt in den Worten! Ist ein Name denn eine Lösung? Und trotzdem beruht darauf die ganze Wissenschaft. Unsere Maschinen wenden diesen Vorgang, diese Tatsache an oder neutralisieren sie. Wird dieses unscheinbare Phänomen auf große Massen übertragen, kann ganz Paris in die Luft fliegen. Wir können die Geschwindigkeit auf Kosten der Kraft oder die Kraft auf Kosten der Geschwindigkeit vermehren. Was ist Kraft, und was ist Geschwindigkeit? Unsere Wissenschaft ist unfähig, das zu sagen, so wie sie unfähig ist, eine Bewegung hervorzubringen. Eine Bewegung, wie sie auch beschaffen sein mag, ist eine ungeheure Kraft, und der Mensch erfindet keine Kraft. Die Kraft ist ein Ganzes wie die Bewegung; sie ist das Wesen der Kraft. Alles ist Bewegung. Der Tod ist eine Bewegung, deren Grenzen uns wenig bekannt sind. Wenn Gott ewig ist, dann ist er, das dürfen Sie glauben, immer in Bewegung. Vielleicht ist Gott die Bewegung. Darum ist die Bewegung wie er unerklärlich, wie er unergründlich, grenzenlos, unfaßbar und ungreifbar. Wer hat je die Bewegung berührt, erfaßt, gemessen? Wir spüren ihre Wirkung, ohne sie zu sehen. Wir können sie sogar leugnen, wie wir Gott leugnen. Wo ist sie? Wo ist sie nicht? Wo beginnt sie? Wo ist ihr Ursprung? Wo ist ihr Ende? Sie umgibt uns, drängt uns und entweicht uns. Sie ist klar wie eine Tatsache, dunkel wie eine Abstraktion, ist Ursache und Wirkung in einem. Sie braucht wie wir den Raum, und was ist der Raum? Die Bewegung allein erklärt ihn uns; ohne die Bewegung ist er nichts mehr als ein leeres Wort ohne Sinn. Die Bewegung ist wie der leere Raum, wie die Schöpfung, wie das Unendliche ein unlösbares Problem, sie verwirrt das menschliche Denken, und alles, was der Mensch zu begreifen vermag, ist, daß er sie niemals begreifen wird. Zwischen jedem der Punkte, die diese Kugel nacheinander im Raum einnimmt, klafft für die menschliche Vernunft ein Abgrund, der Abgrund, in den Pascal gestürzt ist. Um nun auf den unbekannten Stoff, den Sie einer unbekannten Kraft unterwerfen wollen, einzuwirken, müssen wir zuerst diesen Stoff untersuchen; nach seiner Natur wird er entweder unter einem Stoß zerbrechen oder wird ihm widerstehen; wenn er in Stücke bricht und es nicht in Ihrer Absicht liegt, ihn zu teilen, so können wir das gesetzte Ziel nicht erreichen. Wollen Sie ihn komprimieren, so muß auf alle Teile des Stoffes eine gleiche Bewegung derart übertragen werden, daß der Raum zwischen den Teilen gleichmäßig vermindert wird. Wollen Sie ihn ausdehnen, so müssen wir versuchen, auf jedes Molekül eine gleiche exzentrische Kraft auszuüben; denn ohne genaue Anwendung dieses Gesetzes würden wir den Zusammenhang des Stoffes vernichten. Sie müssen bedenken, die Bewegung kennt unendliche Modalitäten, zahllose Kombinationen. Zu welcher Wirkung wollen Sie sich entschließen?«
»Monsieur«, versetzte Raphael ungeduldig, »ich wünsche irgendeinen Druck, der stark genug ist, um dieses Leder beliebig zu dehnen …«
»Da die Substanz nicht beliebig groß, sondern begrenzt ist«, erwiderte der Mathematiker, »kann sie nicht beliebig oder unbegrenzt gedehnt werden; der Druck wird mit Notwendigkeit den Umfang auf Kosten der Dicke vergrößern; die Substanz wird dünner werden, bis es an Materie zu fehlen beginnt …«
»Wenn Sie dieses Resultat erreichen«, rief Raphael, »so haben Sie Millionen verdient!«
»Ich würde Ihnen Ihr Geld stehlen«, erwiderte der Professor mit dem Phlegma eines Holländers. »Ich will Ihnen mit zwei Worten eine Maschine beschreiben, unter der sogar Gott selber wie eine Fliege zerquetscht würde. Sie ist imstande, einen Menschen samt Stiefeln, Sporen, Krawatte, Hut, Geld, Schmuck, kurz, mit allem in ein Blatt Löschpapier zu verwandeln …«
»Was für eine furchtbare Maschine!«
»Anstatt ihre Kinder ins Wasser zu werfen, sollten die Chinesen sie sich lieber auf diese Weise nutzbar machen«, fuhr der Gelehrte fort, ohne daran zu denken, daß ein Mensch seinen Nachkommen eine gewisse Achtung zollen sollte.
Planchette war ganz von seiner Idee erfüllt, nahm einen leeren Blumentopf, der ein Loch im Boden hatte, und stellte ihn auf die Scheibe der Sonnenuhr; dann holte er aus einem Winkel des Gartens etwas Ton. Raphael stand gespannt da wie ein Kind, dem seine Amme ein Märchen erzählt. Planchette legte seinen Ton auf die Scheibe, zog dann ein Gartenmesser aus der Tasche, schnitt zwei Holunderzweige ab und begann, das Mark herauszudrücken, dabei pfiff er vor sich hin, als ob Raphael gar nicht da wäre.
»Da haben wir die einzelnen Bestandteile der Maschine«, sagte er.
Mit Hilfe eines aus dem Ton geformten Knies befestigte er eine der Holzröhren am Boden des Topfes, so daß die Öffnung des Holunders mit dem Loch des Topfes verbunden war. Es sah wie eine unförmige Pfeife aus. Auf der Scheibe breitete er eine Schicht des Tons aus, daß die Form einer Schaufel entstand, setzte den Blumentopf auf den breitesten Teil und drückte den Holunderzweig auf dem Teil, der den Griff vorstellte, fest. Schließlich klebte er etwas Ton um das äußere Ende des Holunderrohrs, steckte den zweiten hohlen Zweig aufrecht hinein, formte den Ton zu einem zweiten Kniestück, das ihn mit dem horizontalen Zweig verband, so daß die Luft oder eine beliebige Flüssigkeit in dieser improvisierten Maschine von der Mündung des vertikalen Rohres durch den Verbindungskanal bis zu dem leeren Blumentopf fließen konnte.
»Dieser Apparat, Monsieur«, sagte er nun zu Raphael mit dem Ernst eines Akademikers, der seine Antrittsvorlesung hält, »ist eine der wunderbarsten Erfindungen des großen Pascal.«
»Ich verstehe nicht.«
Der Gelehrte lächelte. Er nahm von einem Obstbaum ein Fläschchen, in der sein Apotheker ihm eine Flüssigkeit zum Fangen der Ameisen geschickt hatte; er schlug den Boden ab, so daß ein Trichter entstand, hielt ihn sorgfältig auf die Öffnung des hohlen Zweiges, den er vertikal gegenüber dem großen Reservoir, das der Blumentopf bildete, in den Ton gesteckt hatte; dann goß er aus einer Gießkanne so viel Wasser in den Trichter, daß es in dem großen Topf und in dem kleinen kreisrunden Mundstück des Holunderzweiges gleich hoch stand. Raphael dachte an sein Chagrinleder.
»Das Wasser«, dozierte der Mechaniker, »gilt heute noch als ein Körper, der nicht komprimiert werden kann; beachten Sie dieses fundamentale Prinzip; es kann allerdings komprimiert werden, aber nur so gering, daß wir seine Kontraktionsfähigkeit gleich Null setzen dürfen. Sehen Sie die Oberfläche des Wassers, das in den Blumentopf gelangt ist?«
»Ja, Monsieur«.
»Nun nehmen Sie an, diese Oberfläche wäre tausendmal größer als das Mundstück des Holunderrohrs, durch das ich die Flüssigkeit eingegossen habe. Sehen Sie, ich nehme den Trichter weg.«
»Ganz recht.«
»Wenn ich nun irgendwie das Volumen dieser Masse vergrößere, indem ich durch das Mundstück des kleinen Rohrs noch Wasser einführe, so wird die Flüssigkeit darin hinuntergetrieben und in dem Reservoir, das der Blumentopf bildet, steigen, bis die Flüssigkeit in beiden gleich hoch steht …«
»Das ist einleuchtend!« rief Raphael.
»Aber der Unterschied ist der«, fuhr der Gelehrte fort, »daß, wenn die dünne Wassersäule, die in das kleine Vertikalrohr eingeführt wird, dort eine Kraft darstellt, die beispielsweise etwa dem Gewicht eines Pfundes entspricht, daß sich dann in dem Blumentopf, da die Leistung des Wassers sich getreu auf die flüssige Masse überträgt und auf alle Punkte der Wasseroberfläche im Blumentopf einwirkt, tausend Wassersäulen befinden, die alle die Tendenz haben, zu steigen, als wären sie von einer Kraft getrieben, die derjenigen gleich ist, welche die Flüssigkeit in dem vertikalen Holunderzweig herabtreibt, und also mit Notwendigkeit hier« – er deutete auf die Öffnung des Blumentopfes – »eine Leistung hervorbringen, die tausendmal beträchtlicher ist als die Leistung, die da eingeführt wird.« Der Gelehrte wies dabei mit dem Finger auf die Holzröhre, die senkrecht in dem Ton befestigt war.
»Das ist ganz einfach«, meinte Raphael.
Planchette lächelte.
»Mit anderen Worten«, fuhr er mit der hartnäckigen Logik, die den Mathematikern eigen ist, fort, »müßte man, wenn man dem Anprall des Wassers Widerstand leisten wollte, auf jeden Teil der großen Oberfläche eine Kraft wirken lassen, die der in der vertikalen Röhre gleich ist; nur von dem Unterschied abgesehen, daß, wenn die flüssige Säule hier einen Fuß hoch ist, die tausend kleinen Säulen der großen Oberfläche nur um ein Geringes ansteigen werden. Jetzt aber« – damit stieß Planchette seine Holunderstöckchen verächtlich zur Seite – »denken wir uns diesen komischen kleinen Apparat durch Metallrohre von genügender Stärke und Länge ersetzt. Bedecken wir nun die flüssige Oberfläche des großen Reservoirs mit einer starken beweglichen Platte, setzen wir ihr eine andere, deren Widerstandskraft und Festigkeit erprobt ist, entgegen, verschaffen wir uns ferner die Möglichkeit, der flüssigen Masse durch das kleine Vertikalrohr fortgesetzt Wasser hinzuzufügen, so muß der Gegenstand zwischen den beiden festen Platten notwendigerweise dem ungeheuren Druck, der unaufhörlich auf ihn ausgeübt wird, nachgeben. Das Mittel, durch das kleine Rohr fortwährend Wasser zuzuführen, ist für die Mechanik ein Kinderspiel, ebenso das Verfahren, den Druck der flüssigen Masse auf eine Platte zu übertragen. Zwei Kolben und ein paar Ventile genügen. Verstehen Sie nun, Verehrtester« – damit faßte er Valentin am Arm –, »daß es kaum einen Stoff geben kann, der, wenn man ihn zwischen diese beiden unaufhörlichen Widerstände bringt, sich nicht zwangsläufig ausdehnen müßte.« – »Wie, der Verfasser der ›Lettres provinciales‹ hat das erfunden?« rief Raphael.
»Er allein, Monsieur. Die Mechanik kennt nichts Einfacheres und nichts Schöneres. Das entgegengesetzte Prinzip, die Expansionskraft des Wassers, hat die Dampfmaschine hervorgebracht. Aber die Expansionskraft des Wassers geht nur bis zu einem gewissen Grade, während seine Nichtkomprimierbarkeit, die eine gewissermaßen negative Kraft ist, notwendigerweise unendlich ist.«
»Wenn dieses Leder sich dehnt«, sagte Raphael, »verspreche ich Ihnen, Blaise Pascal26 eine Kolossalstatue zu errichten, einen Preis von 100 000 Francs für das beste Problem zu stiften, dessen Lösung der Mechanik in jedem Jahrzehnt gelingt, Ihre Nichten und Großnichten auszustatten und schließlich ein Hospital für verrückte oder verarmte Mathematiker zu gründen.«
»Das wäre sehr nützlich«, erwiderte Planchette und fuhr dann mit der Ruhe eines Mannes, der nur in der Sphäre des Verstandes lebt, fort: »Gehen wir also morgen zu Spieghalter. Dieser treffliche Mechaniker hat nach meinen Angaben unlängst eine vervollkommnete Maschine gebaut, mit der ein Kind tausend Bund Heu in seinen Hut brächte.«
»Auf morgen, Monsieur.«
»Auf morgen.«
»Da sage mir noch einer was von der Mechanik!« rief Raphael. »Ist sie nicht die schönste aller Wissenschaften? Der andere mit seinen Onagern, seinen Klassen, seinen Enten, seinen Gattungen und seinen Glasgefäßen voller Scheußlichkeiten taugte zu weiter nichts, als in einem Café die Billardstöße zu markieren.«
Am anderen Tag suchte Raphael ganz vergnügt Planchette auf, und sie fuhren zusammen in die Rue de la Santé,27 ein Name, der von guter Vorbedeutung schien. Spieghalter hatte einen riesigen Betrieb; der junge Mann sah überall rote und donnernde Eisenhämmer. Es war ein Feuerregen, eine Sintflut von Nägeln und Haken, ein Ozean von Kolben, Schrauben, Hebeln, Stangen, Querstücken, Feilen, Muttern, ein Meer von Gußeisen, Holz, Ventilen und Eisenstangen. Die Feilspäne machten das Atmen schwer. In der Luft lag Eisen, die Männer waren mit Eisen bedeckt, alles stank nach Eisen, das Eisen hatte Leben, hatte Organe, es verflüssigte sich, bewegte sich, dachte, indem es alle Formen annahm, allen Launen gehorchte. Durch das Geheul der Blasebälge, das Crescendo der Hämmer, das Pfeifen der Walzen, unter denen das Eisen ächzte, gelangte Raphael in einen großen sauberen und gut durchlüfteten Raum, in dem er die ungeheure Presse, von der ihm Planchette gesprochen hatte, in Muße betrachten konnte. Er bewunderte eine Art gußeiserne Bohlen und Preßwangen aus Eisen, die durch einen unzerstörbaren Kern verbunden waren.
»Wenn Sie siebenmal hintereinander schnell diese Kurbel drehen würden«, sagte Spieghalter und wies auf eine Art Pumpenschwengel aus blankem Eisen, »dann würden Sie eine Stahlplatte in tausend Splitter zersprengen, die Ihnen wie Nadeln ins Fleisch dringen würden.«
»Donnerwetter!« rief Raphael.
Planchette legte eigenhändig das Chagrinleder zwischen die beiden Platten der mächtigen Presse und bediente, voll der von wissenschaftlichen Überzeugungen getragenen Sicherheit lebhaft den Schwengel.
»Auf den Boden, oder wir sind alle des Todes!« schrie Spieghalter mit donnernder Stimme und warf sich selbst flach hin.
Ein schreckliches Pfeifen erfüllte die Werkräume. Das Wasser in der Maschine sprengte das Eisen, schoß in einem Strahl von furchtbarer Gewalt hervor, der sich zum Glück gegen einen alten Schmiedeherd lenkte, den er umwarf, zerschmetterte und herumschleuderte, wie eine Windhose ein Haus erfaßt und mit sich fortreißt.
»Oh«, sagte Planchette in aller Ruhe, »das Chagrinleder ist heil wie mein Auge! Meister Spieghalter, es war ein Sprung in Ihrem Guß oder eine undichte Stelle im großen Rohr.«
»Nein, nein, ich kenne meinen Guß. Monsieur soll nur sein Zeug wieder mitnehmen, der Teufel sitzt drin.«
Der Deutsche nahm einen Schmiedehammer zur Hand, legte das Stück Leder auf einen Amboß und ließ mit der ganzen Kraft, die der Zorn verleiht, einen so furchtbaren Schlag auf den Talisman niedersausen, wie er in seinen Werkstätten noch nie erdröhnt war.
»Er zeigt sich bloß nicht!« rief Planchette und strich über das widerspenstige Leder.
Die Arbeiter liefen herbei. Der Werkmeister nahm das Leder und steckte es in die glühende Steinkohle seines Schmiedefeuers. Alle standen im Halbkreis um das Feuer und beobachteten ungeduldig das Auflodern der von einem ungeheuren Blasebalg angefachten Flammen. Raphael, Spieghalter und Professor Planchette standen in der Mitte dieser schwarzen lauernden Menge. Als Raphael all diese weißen Augen, diese mit Eisenstaub gepuderten Köpfe, diese rußig glänzenden Arbeitskleider, diese behaarten Brüste sah, glaubte er sich in die nächtliche, phantastische Welt der deutschen Balladen versetzt. Der Werkmeister ergriff schließlich das Leder mit einer Zange, nachdem er es zehn Minuten lang im Feuer gelassen hatte.
»Geben Sie es mir«, sagte Raphael.
Der Werkmeister streckte es Raphael wie zum Spaß hin. Der Marquis nahm es einfach in die Hand: es war kalt und geschmeidig. Die Arbeiter schrien vor Entsetzen auf und flohen. Valentin blieb mit Planchette allein in der leeren Werkstatt.
»Kein Zweifel, es sitzt etwas Teuflisches darin!« rief Raphael verzweifelt; »keine Macht der Erde kann mir also einen Tag Leben dazugeben?«
»Ich habe unrecht gehabt«, versetzte der Mathematiker mit zerknirschter Miene, »wir hätten diese absonderliche Haut der Einwirkung eines Walzwerks aussetzen müssen. Wo hatte ich meine Augen, als ich Ihnen eine hydraulische Presse vorschlug!«
»Ich selber hatte es gefordert«, erwiderte Raphael.
Der Gelehrte atmete auf wie ein Schuldiger, der von zwölf Geschworenen freigesprochen wird. Das seltsame Problem, das dieses Stück Leder ihm aufgab, beschäftigte ihn dennoch, er dachte eine Weile nach und sagte schließlich:
»Man muß diesen unbekannten Stoff mit Reagenzien behandeln. Wir wollen Japhet aufsuchen, vielleicht hat die Chemie mehr Glück als die Mechanik.«
Valentin trieb sein Pferd schnell an, damit sie den berühmten Chemiker Japhet noch in seinem Laboratorium anträfen.
»Nun, alter Freund«, sagte Planchette, als er Japhet begrüßte, der in einem Lehnstuhl saß und einen Niederschlag betrachtete, »wie geht’s der Chemie?«
»Sie schläft ein; nichts Neues. Die Akademie hat allerdings die Existenz des Salizin anerkannt, aber Salizin, Asparagin, Vauquelin, Digitalin, das sind alles keine Entdeckungen.«
»Es scheint«, sagte Raphael, »daß Sie, da sich Substanzen nicht erfinden lassen, darauf angewiesen sind, Namen zu erfinden.«
»Das ist bei Gott wahr, junger Mann!«
»Hier«, sagte Professor Planchette zu dem Chemiker, »versuche doch mal, diese Substanz zu zerlegen; wenn du irgendein neues Element daraus gewinnst, nenne ich es von vornherein Diabolin, denn als wir sie eben komprimieren wollten, haben wir eine hydraulische Presse zuschanden gemacht.«
»Schau, schau!« rief der Chemiker vergnügt, »das gibt vielleicht ein neues Element.«
»Monsieur«, sagte Raphael, »es ist weiter nichts als ein Stück Eselshaut.«
»Monsieur«, wollte der Chemiker ernst erwidern, aber der Marquis gab ihm das Chagrinleder mit der Bemerkung: »Ich mache keinen Spaß.«
Baron Japhet prüfte das Leder zunächst mit den Papillen seiner Zunge, die darin geübt war, Salze, Säuren, Alkalien und Gase herauszuschmecken, und meinte nach einigen Versuchen: »Geschmack hat es keinen. Nun wollen wir ihm einmal ein bißchen Flußsäure zu trinken geben.«
Das Leder wurde mit diesem Stoff behandelt, das tierische Gewebe sofort zersetzt, wies aber keinerlei Veränderungen auf.
»Das ist kein Chagrin!« rief der Chemiker. »Nun wollen wir dieses geheimnisvolle Unbekannte wie ein Mineral behandeln und ihm ordentlich einheizen. Tun wir es also in einen Schmelztiegel, in dem ich gerade rote Pottasche habe.«
Japhet ging hinaus und kam bald zurück.
»Bitte Monsieur«, sagte er zu Raphael, »lassen Sie mich ein Stückchen von dieser kuriosen Substanz abnehmen, sie ist so seltsam, daß …«
»Ein Stückchen?« rief Raphael; »nicht ein Haarbreit geht davon ab. Übrigens«, fügte er dann mit einem Ausdruck hinzu, der zugleich düster und spöttisch war, »versuchen Sie es!«
Der Gelehrte zerbrach bei dem Versuch, etwas von dem Leder abzuschneiden, ein Rasiermesser; er versuchte es mit Hilfe einer starken elektrischen Ladung zu zerteilen; dann unterwarf er es der Wirkung der Voltaischen Säule; kurz, alle Blitze seiner Wissenschaft wurden an dem schrecklichen Talisman zunichte. Es war sieben Uhr abends. Planchette, Japhet und Raphael merkten nicht, wie die Zeit entschwand; sie warteten auf das Ergebnis eines letzten Versuches. Jedoch das Chagrinleder ging aus einem furchtbaren Angriff mit einer gehörigen Dosis Chlorstickstoff siegreich hervor.
»Ich bin verloren!« rief Raphael. »Gott will es. Ich muß sterben.« Er ließ die beiden Gelehrten bestürzt zurück.
»Wir wollen uns hüten, dieses Abenteuer der Akademie zu erzählen, unsere Kollegen würden sich über uns lustig machen«, sagte Planchette zu dem Chemiker nach einer langen Pause, in der sie einander angesehen hatten, ohne daß sie auszusprechen wagten, was sie dachten.
Die beiden Gelehrten kamen sich wie Christen vor, die aus ihren Gräbern auferstanden sind und keinen Gott im Himmel gefunden haben. Die Wissenschaft? Ohnmächtig! Die Säuren? Klares Wasser! Die rote Pottasche? Blamiert! Die Voltaische Säule und der elektrische Funke? Zwei Gaukelmännchen!
»Eine hydraulische Presse zerbrochen wie ein Stück Brot!« rief Planchette.
Es trat wieder Schweigen ein, dann murmelte der Baron Japhet: »Ich glaube an den Teufel!«
»Und ich an Gott!« antwortete Planchette.
Sie blieben beide ihrer Rolle treu. Für einen Mechaniker ist das Universum eine Maschine, die einen Arbeiter verlangt; für die Chemie, dieses Werk eines Dämons, der alles zersetzt, ist die Welt ein Gas, das sich verändern kann.
»Wir können die Tatsache nicht leugnen«, versetzte der Chemiker.
»Bah! trösten wir uns mit dem verschwommenen Grundsatz, den die Doktrinäre in die Welt gesetzt haben: Dumm wie eine Tatsache.«
»Dein Grundsatz«, versetzte der Chemiker, »scheint mir aber erst recht dumm zu sein.«
Sie brachen in Lachen aus und speisten zu Abend wie Männer, die in einem Wunder nur noch ein Phänomen der Wissenschaft erblickten.
*
Valentin war zu Hause angelangt. Eine kalte Wut hatte ihn befallen; er glaubte an nichts mehr; seine Gedanken stritten in seinem Hirn, drehten sich und schwankten, wie es einem Menschen geht, der einer unmöglichen Tatsache ins Auge sieht. Er hätte gern an einen verborgenen Fehler in der Maschine Spieghalters geglaubt; auch die Ohnmacht der Wissenschaft und des Feuers hatte ihn nicht gewundert; aber die Geschmeidigkeit des Leders, als er es in die Hand nahm, und seine Widerstandsfähigkeit, als alle dem Menschen zur Verfügung stehenden Zerstörungsmittel gegen es gerichtet wurden, flößten ihm Grauen ein. Diese unbestreitbare Tatsache erregte ihm Schwindel.
»Ich bin wahnsinnig«, sagte er sich. »Ich habe seit heute morgen nichts gegessen und verspüre trotzdem weder Hunger noch Durst, und dabei fühle ich in der Brust eine brennende Glut.«
Er schob das Chagrinleder wieder in den Rahmen, in dem es bis vor kurzem gewesen war, und nachdem er mit roter Tinte die augenblicklichen Konturen des Talismans nachgezogen hatte, setzte er sich in seinen Lehnstuhl.
»Schon acht Uhr!« rief er. »Dieser Tag ist wie ein Traum vergangen.«
Er legte die Arme auf die Sessellehne, stützte den Kopf auf die linke Hand und blieb in düstere Betrachtungen, in jene verzehrenden Gedanken versunken, deren Geheimnis die zum Tode Verurteilten mit sich nehmen.
»Ach, Pauline!« rief er. »Armes Kind! Es gibt Abgründe, die selbst die Liebe nicht zu überwinden vermag, trotz der Kraft ihrer Flügel.« In diesem Augenblick hörte er ganz deutlich einen unterdrückten Seufzer. Er horchte auf, und infolge einer der rührendsten Vorzüge der Liebe erkannte er den Atem seiner Pauline. »Oh«, sagte er sich, »das ist mein Todesurteil. Wenn sie da wäre, wollte ich in ihren Armen sterben!«
Ein unbeschwertes, fröhliches Lachen erklang. Er wandte den Kopf nach seinem Bett und sah durch die durchscheinenden Vorhänge Paulines Gesicht. Sie strahlte, glücklich wie ein Kind, das sich über einen gelungenen Streich freut; ihr schönes Haar fiel ihr in tausend Locken über die Schultern; sie glich einer bengalischen Rose in einem Blütenmeer weißer Rosen.
»Ich habe Jonathas verleitet«, sagte sie; »gehört dieses Bett nicht mir, bin ich nicht deine Frau? Schilt nicht, Geliebter, ich wollte nur in deiner Nähe schlafen, wollte dich überraschen. Verzeih mir die Torheit!« Sie sprang wie eine Katze aus dem Bett, stand strahlend schön in ihrem Musselin vor Raphael und setzte sich ihm auf den Schoß. »Von welchem Abgrund sprachst du denn, Liebster?« fragte sie, und ihre Stirn zeigte ihre Besorgnis.
»Vom Tode.«
»Du tust mir weh«, antwortete sie; »es gibt Vorstellungen, die wir armen Frauen nicht ertragen können; sie töten uns. Kommt es von unserer starken Liebe oder vom Mangel an Mut? Ich weiß es nicht. Der Tod schreckt mich nicht.« Dabei lachte sie schon wieder. »Mit dir morgen früh in einem letzten Kuß zu sterben wäre eine Wonne. Mir ist, als hätte ich schon mehr als 100 Jahre gelebt. Was liegt an der Zahl der Tage, wenn wir in einer Nacht, in einer Stunde ein ganzes Leben voller Frieden und Glück ausgeschöpft haben?«
»Du hast recht. Aus deinem holden Mund spricht der Himmel. Laßt ihn mich küssen, und dann wollen wir sterben.«
»Sterben wir also!« gab sie lachend zur Antwort.
Gegen neun Uhr morgens schien der Tag durch die Spalten der Jalousien; die Musselinvorhänge dämpften das Licht, aber schon konnte man die kräftigsten Farben des Teppichs und die seidenglänzenden Möbel des Zimmers erkennen, in dem die beiden Liebenden ruhten. Vereinzelt schimmerten Vergoldungen auf. Ein Strahl erstarb auf dem weichen Daunenkissen, das im Liebesspiel zu Boden gefallen war. Paulines Kleid, das an einem hohen Spiegel aufgehängt war, sah wie eine Geistergestalt aus. Die zierlichen Schuhe waren weit vom Bett entfernt liegengelassen worden. Eine Nachtigall hatte sich aufs Fensterbrett gesetzt; ihr helles Singen, ihr rascher Flügelschlag, als sie plötzlich davonflog, weckten Raphael auf.
»Wenn ich sterben soll«, sagte er sich und vollendete damit einen Gedanken seines Traumes, »muß mein Organismus, dieser Apparat von Fleisch und Knochen, der von meinem Willen beseelt ist und aus mir ein menschliches Individuum macht, eine beträchtliche Schädigung aufweisen. Die Ärzte müssen die Symptome der angegriffenen Lebenskraft erkennen und mir sagen können, ob ich gesund oder krank bin.«
Er betrachtete seine schlafende Frau, die seinen Kopf umschlungen hielt und ihn auch im Schlummer mit der zärtlichen Fürsorge der Liebe umgab. Zierlich ausgestreckt wie ein Kind, das Gesicht ihm zugewandt, schien Pauline ihn noch immer anzusehen, ihm den hübschen halbgeöffneten Mund darzubieten, aus dem ihr regelmäßiger, reiner Atem drang. Ihre kleinen schimmernden Zähne hoben das Rot ihrer frischen Lippen hervor, um die ein Lächeln schwebte; die rosige Färbung ihres Antlitzes war in diesem Augenblick lebhafter, sein Weiß gewissermaßen noch weißer als in den verliebtesten Stunden des Tages. Ihre anmutige Hingegebenheit, aus der so reines Vertrauen sprach, fügte dem Zauber der Liebe noch den wundervollen Reiz schlummernder Kindheit hinzu. Selbst die natürlichsten Frauen gehorchen während des Tages gewissen gesellschaftlichen Konventionen, die naive Gefühlsäußerungen hemmen, der Schlaf jedoch scheint ihnen jene unbefangene Natürlichkeit wiederzugeben, die die ersten Lebensjahre so köstlich schmückt: Pauline errötete über nichts, sie war eins der holden himmlischen Geschöpfe, denen die Vernunft noch keine Gedanken in die Bewegungen, keine Geheimnisse in die Blicke gemischt hat. Ihr Profil hob sich klar von dem feinen Batist der Kopfkissen ab; die breiten Spitzenrüschen, die sich in ihr gelöstes Haar mischten, gaben ihr ein leicht schelmisches Aussehen; aber sie war auch in Wonne eingeschlafen. Ihre langen Wimpern ruhten auf ihren Wangen, wie um die Augen vor grellem Licht zu schützen oder die Seele, wenn sie eine vollkommene, aber flüchtige Lust festzuhalten sucht, in ihrer Sammlung zu unterstützen; ihr zierliches, rosiges Ohr, das, von Haaren umlockt, aus Mechelner Spitzen hervorschaute, hätte einen Künstler, einen Maler, einen Greis vor Liebe den Verstand verlieren oder gar einen Wahnsinnigen wieder zu Verstand kommen lassen. Seine schlafende Geliebte zu sehen, wie sie unter dem Schutze des geliebten Mannes friedlich lächelnd schlummert, wie sie ihn noch im Traum, wo das Leben geschwunden zu sein scheint, liebt und ihm schweigend die Lippen darbietet, die noch im Schlafe vom letzten Kusse erzählen; eine Frau zu sehen, die arglos, halbnackt, aber in ihre Liebe wie in einen Mantel gehüllt und inmitten der Auflösung keusch daliegt, ihre da und dort verstreuten Kleidungsstücke zu bewundern, diesen Seidenstrumpf, der am Abend vorher dem Liebsten zu Gefallen rasch abgestreift wurde, den gelösten Gürtel, aus dem grenzenloses Vertrauen spricht – ist das nicht namenlose Freude? Dieser Gürtel ist ein ganzes Gedicht; die Frau, die er schützte, existiert nicht mehr; sie gehört dem Geliebten, ist eins geworden mit ihm; verrät er sie von nun an, verwundet er sich selbst. Raphael sah sich gerührt in diesem Zimmer um, das voller Liebe, voller Erinnerungen war, das der Tag in wollüstiges Licht tauchte, und wandte dann seinen Blick wieder der Frau mit ihren reinen, jungen Formen zu, die noch in der Liebe weilte, deren Gefühle mehr als alles andere ihm ungeteilt gehörten. Er wünschte, ewig zu leben. Als sein Blick auf Pauline fiel, schlug sie mit einem Mal die Augen auf, als hätte ein Sonnenstrahl sie getroffen.
»Guten Morgen, mein Freund«, begrüßte sie ihn lächelnd. »Wie schön du bist, Böser.«
Ihre beiden Köpfe, ganz von der Anmut verklärt, welche die Liebe, die Jugend, die Dämmerung und das Schweigen verliehen, zeigten eines jener göttlichen Bilder, deren flüchtiger Zauber nur den ersten Tagen der Leidenschaft gehört, wie Naivität und Unschuld die Attribute der Kindheit sind. Ach, diese Lenzfreuden der Liebe müssen entschwinden wie das Lachen unserer Kindertage und leben nur in unserer Erinnerung fort, um uns je nach den Launen der geheimen Vorgänge unseres Inneren entweder trostlos zu machen oder uns flüchtige Tröstung zu gewähren.
»Warum bist du erwacht?« sagte Raphael; »ich war so glücklich, dich schlafend zu sehen, daß ich weinte.«
»Auch ich habe heute nacht geweint«, erwiderte sie, »als ich deinen Schlummer bewachte, aber nicht vor Freude. Höre, mein Raphael, höre mich an! Wenn du schläfst, ist dein Atem nicht frei, es ist etwas Rasselndes in deiner Brust, das mir Angst gemacht hat. Während du schläfst, hast du so einen kurzen, trockenen Husten, der aufs Haar dem meines Vaters gleicht, der an der Schwindsucht dahinsiecht. An dem Geräusch deiner Lungen habe ich einige Symptome dieser Krankheit erkannt. Und du hattest Fieber, ich weiß es gewiß, deine Hand war feucht und glühend. Geliebter, du bist jung«, fügte sie hinzu und schauerte zusammen, »du könntest noch geheilt werden, wenn zum Unglück … Aber nein«, rief sie froh, »es ist kein Unglück, die Krankheit ist ansteckend, sagten die Ärzte.« Sie umschlang Raphael mit beiden Armen und sog seinen Atem mit einem Kuß ein, in den die ganze Seele strömte. »Ich will keine alte Frau werden. Wir wollen zusammen jung sterben und mit Blumen in den Händen gen Himmel pilgern.«
»Solche Pläne macht man leicht, wenn man gesund ist«, erwiderte Raphael und strich mit beiden Händen durch Paulines Haar.
Aber plötzlich bekam er einen furchtbaren Hustenanfall. Es war ein schwerer, hohler Husten, der aus einer Gruft zu schallen scheint, der Blässe auf die Stirn des Kranken treibt, ihn am ganzen Leibe zitternd und in Schweiß gebadet zurückläßt, seine Nerven aufwühlt, den Brustkorb erschüttert, sein Rückenmark überanstrengt und bleierne Schwere in seinen Adern verbreitet hat. Niedergeschlagen und bleich ließ sich Raphael auf sein Bett sinken, er war erschöpft wie ein Mensch, der seine ganze Kraft in einer letzten Anstrengung verbraucht hat. Pauline sah ihn mit starren, angstvoll geweiteten Augen an. Sie blieb regungslos, blaß und stumm.
»Wir dürfen keine Torheiten mehr anstellen, Liebster«, sagte sie schließlich, um Raphael die furchtbaren Vorahnungen, die sie befielen, zu verbergen.
Sie schlug die Hände vors Gesicht. Das gräßliche Gerippe des Todes stand vor ihr. Raphaels Antlitz war fahl und hohl wie ein Schädel, der für die Studien eines Gelehrten dem Schlund des Kirchhofs entrissen worden ist. Pauline fiel Valentins Ausruf vom Vorabend ein, und sie sprach zu sich selbst: »Ja, es gibt Abgründe, die die Liebe nicht überwinden kann, aber sie muß in ihnen versinken.«
Ein paar Tage nach dieser trostlosen Szene saß Raphael an einem Märzmorgen in seinem Lehnstuhl. Vier Ärzte standen um ihn herum, die ihn ans Fenster seines Schlafzimmers hatten rücken lassen, wo es hell war, und ihm nacheinander den Puls befühlten, ihn abklopften und mit scheinbarem Interesse befragten. Der Kranke suchte aus ihren Gesten und den kleinsten Falten auf ihrer Stirn ihre Gedanken zu erraten. Diese Konsultation war seine letzte Hoffnung. Diese höchsten Richter sollten sein Urteil sprechen: Leben oder Tod. Um der menschlichen Wissenschaft das letzte Wort zu entreißen, hatte Valentin die Orakel der modernen Medizin berufen. Dank seinem Vermögen und seinem Namen befanden sich die drei Systeme, zwischen denen sich das menschliche Wissen bewegt, hier vor ihm. Drei von diesen Doktoren trugen die ganze ärztliche Philosophie mit sich herum und repräsentierten den Kampf, den der Spiritualismus, die Analyse und ein gewisser spöttischer Eklektizismus untereinander führen. Der vierte Arzt war Horace Bianchon, ein Mann der Zukunft und reicher Kenntnisse, vielleicht der ausgezeichnetste unter den neuen Ärzten, der kluge und bescheidene Vertreter der forschenden Jugend, die sich anschickt, die Erbschaft der seit 50 Jahren von der École de Paris angehäuften Schätze anzutreten, und die vielleicht das Monument errichten wird, zu dem die früheren Jahrhunderte soviel verschiedenes Material zusammengetragen haben. Er war ein Freund des Marquis und Rastignac und hatte vor mehreren Tagen seine Behandlung übernommen. Jetzt half er ihm, die Fragen der drei Professoren zu beantworten, die er zuweilen mit einiger Dringlichkeit auf die Symptome hinwies, die ihm eine Lungenschwindsucht anzuzeigen schienen.
»Sie haben ohne Zweifel sehr ausschweifend gelebt, haben, wie man so sagt, ein tolles Leben geführt und haben sich auch großen geistigen Anstrengungen gewidmet?« fragte einer der drei berühmten Doktoren, dessen eckiger Kopf, wuchtige Gestalt und energisches Auftreten auf eine geistige Überlegenheit über seine beiden Gegner schließen ließ.
»Ich wollte mich durch Ausschweifung zugrunde richten, nachdem ich drei Jahre lang an einem großen Werk gearbeitet habe, mit dem Sie sich vielleicht einmal beschäftigen werden«, antwortete ihm Raphael.
Der große Arzt nickte mit dem Kopf als Zeichen seiner Zufriedenheit, als hätte er sich selbst gesagt: »Ich wußte es!«
Dieser Arzt war der erlauchte Brisset, das Haupt der Organizisten,28 der Nachfolger der Cabanis29 und Bichats, ein Vertreter der positivistischen und materialistischen Schule, die im Menschen ein endliches Wesen sieht, das lediglich den Gesetzen seiner eigenen Organisation unterworfen ist und dessen normaler Zustand oder schädliche Anomalien sich aus unverkennbaren Ursachen erklären lassen.
Nach dieser Antwort sah Brisset schweigend auf einen untersetzten Mann, dessen hochrotes Gesicht und glühendes Auge einem alten Satyr zu gehören schienen. Er lehnte mit dem Rücken an der Ecke der Fensternische und betrachtete Raphael aufmerksam, ohne ein Wort zu sagen. Doktor Caméristus war ein schwärmerischer und gläubiger Mann, Führer der Vitalisten30 und poetischer Verteidiger der abstrakten Doktrinen van Helmonts; er sah im menschlichen Leben ein geheimnisvolles höheres Prinzip, eine unerklärliche Erscheinung, der man mit dem Skalpell nicht beikommen kann, die der Chirurgie spottet, den Arzneien der Pharmazeutik, den X der Algebra, den Demonstrationen der Anatomie entschlüpft und all unser Mühen verlacht: eine Art unfaßbare, unsichtbare, irgendeinem göttlichen Gesetz unterworfene Flamme, die oftmals in einem Körper weiterbrennt, über den wir längst das Todesurteil gesprochen haben, wie sie zuweilen auch die lebenskräftigsten Naturen verläßt.
Ein sardonisches Lächeln glitt über die Lippen des dritten, des Doktor Maugredie. Er war ein ausgezeichneter Kopf, aber ein Skeptiker und Spötter, der an nichts als ans Skalpell glaubte, Brisset den Tod eines Menschen zugestand, dem es ausgezeichnet ging, und wiederum mit Cameristus anerkannte, daß ein Mensch noch nach seinem Tode weiterleben könne. Er fand in allen Theorien etwas Gutes, schloß sich keiner an, behauptete, das beste System in der Medizin sei, keins zu haben und sich an die Tatsachen zu halten. Dieser Panurg, dieser König der Beobachtung, der große Diagnostiker und große Spötter, der Mann der verzweifelten Versuche, machte sich jetzt mit dem Chagrinleder zu schaffen.
»Ich möchte mich gern von dem Zusammenhang zwischen Ihren Wünschen und seiner Verkleinerung mit eigenen Augen überzeugen«, sagte er zu dem Marquis.
»Wozu denn?« rief Brisset.
»Wozu denn?« wiederholte Caméristus.
»Ah! Sie sind sich einig«, meinte Maugredie.
»An dieser Zusammenziehung ist weiter nichts Besonderes«, meinte Brisset.
»Sie ist übernatürlich«, sagte Caméristus.
»Ja, in der Tat«, versetzte Maugredie und nahm eine ernste Miene an, während er Raphael sein Chagrinleder zurückgab; »so ist zum Beispiel die hornartige Verhärtung der Haut eine unerklärliche und dennoch natürliche Tatsache, die seit der Erschaffung der Welt die Medizin und die hübschen Frauen zur Verzweiflung treibt.«
Wie genau Valentin seine drei Ärzte auch beobachtete, er entdeckte bei ihnen keinerlei Mitgefühl für seine Leiden. Alle drei blieben nach jeder Antwort stumm, maßen ihn mit gleichgültigen Blicken und fragten ihn aus, ohne ihn zu bedauern. Hinter ihrer Höflichkeit war kühle Teilnahmslosigkeit zu spüren. Sei es, daß sie ihrer Sache sicher, sei es, daß sie in tiefes Nachdenken versunken waren, ihre Worte flossen so spärlich, so träge, daß Raphael manchmal glaubte, sie wären mit ihren Gedanken woanders. Von Zeit zu Zeit antwortete lediglich Brisset: »Gut! Schön!« auf alle hoffnungslosen Symptome, die Bianchon aufzeigte. Caméristus verharrte in einer tiefen Träumerei; Maugredie erinnerte an einen Lustspieldichter, der zwei Originale studiert, um sie treu auf die Bühne zu bringen. Das Gesicht Bianchons verriet große Sorge und traurige Ergriffenheit. Er war erst zu kurze Zeit Arzt, um vor dem Schmerz stumpf, vor dem Bett eines Sterbenden unerschüttert bleiben zu können; er vermochte die Freundestränen nicht zu unterdrücken, die einen Menschen hindern, klar zu sehen und wie ein Befehlshaber den für den Sieg günstigen Augenblick zu packen, ohne auf die Schreie der Sterbenden zu hören. Nachdem die Autoritäten ungefähr eine halbe Stunde darauf verwendet hatten, der Krankheit und dem Kranken sozusagen Maß zu nehmen, wie ein Schneider einem jungen Mann für seinen Hochzeitsanzug Maß nimmt, brachten sie ein paar Gemeinplätze vor, unterhielten sich sogar über Politik; dann wollten sie sich in Raphaels Arbeitszimmer zurückziehen, um ihre Meinungen auszutauschen und das Urteil zu fällen.
»Messieurs«, fragte Raphael, »kann ich der Debatte nicht beiwohnen?«
Gegen dieses Ansinnen erhoben Brisset und Maugredie lebhaften Einspruch und lehnten es trotz der dringlichen Bitten des Kranken ab, in seiner Anwesenheit zu beraten. Raphael fügte sich dem Brauch; er gedachte aber, sich in einen kleinen Gang zu schleichen, von dem aus er die medizinischen Auseinandersetzungen, die zwischen den drei Professoren entbrennen würden, leicht verfolgen konnte.
»Messieurs«, sagte Brisset, als sie eingetreten waren, »gestatten Sie mir, Ihnen sofort meine Meinung darzulegen. Ich will sie Ihnen weder aufdrängen noch sie bestritten sehen; erstens ist sie bestimmt und sicher; sie resultiert aus einer völligen Ähnlichkeit zwischen einem meiner Kranken und dem Patienten, zu dessen Untersuchung wir hierher gerufen worden sind; zweitens erwartet man mich in meiner Klinik. Der Fall, der meine Anwesenheit dort erforderlich macht, ist so wichtig, daß Sie entschuldigen, wenn ich als erster das Wort ergreife. Das ›Subjekt‹, mit dem wir es zu tun haben, ist in gleicher Weise von geistigen Arbeiten erschöpft … Was hat er denn geschrieben, Horace?« Damit wandte er sich an den jungen Arzt.
»Eine Theorie des Willens!«
»Donnerwetter! das ist freilich ein weitreichendes Thema! Er ist, sage ich, durch übermäßige Geistesarbeit, durch eine unvernünftige Lebensweise, durch die wiederholte Anwendung zu starker Stimulantien erschöpft. Die ständige Aufpeitschung des Körpers wie des Gehirns hat die Tätigkeit des ganzen Organismus durcheinandergebracht. Messieurs, es ist leicht, in den Symptomen des Gesichtsausdrucks und des Körpers eine starke Reizung des Magens, die Neurose des großen Sympathikus, die lebhafte Empfindlichkeit des Epigastriums und die Verengung des Hypochondriums zu erkennen. Sie haben die Anschwellung und das Hervortreten der Leber bemerkt. Schließlich hat Monsieur Bianchon die Verdauung seines Patienten ständig beobachtet und uns mitgeteilt, daß sie schwer und mühsam ist. Genaugesagt ist kein Magen mehr da; der eigentliche Mensch ist verschwunden. Der Intellekt ist geschwächt, weil der Mann nicht mehr verdaut. Die fortschreitende Veränderung des Epigastriums, des Zentrums des Lebens, hat das ganze System gestört. Von dort werden die dauernden und unbestreitbaren Störungen ausgestrahlt; sie haben durch das Nervengeflecht auf das Hirn übergegriffen, daher die außerordentliche Reizbarkeit dieses Organs. Es liegt eine Monomanie vor. Der Kranke wird von einer fixen Idee verfolgt. Für ihn wird dieses Stück Chagrinleder wirklich kleiner, vielleicht ist es aber immer so groß gewesen, wie wir es gesehen haben; aber ob es sich zusammenzieht oder nicht, dieses Chagrinleder ist für ihn die Mücke auf der Nase des Großwesirs. Setzen Sie unverzüglich Blutegel an das Epigastrium, beruhigen Sie die Reizung dieses Organs, in dem das menschliche Leben seinen Sitz hat, sorgen Sie für eine strenge Diät, und die Monomanie wird weichen. Ich brauche Doktor Bianchon nichts weiter zu sagen; er muß die Behandlung vornehmen, im Ganzen wie in den Einzelheiten. Vielleicht liegt ein Zusammenwirken von Krankheiten vor, vielleicht sind die Atemwege gleichfalls in Mitleidenschaft gezogen; aber ich halte die Behandlung des Verdauungsapparates für weitaus wichtiger, notwendiger, dringlicher als die der Lungen. Die angespannte Beschäftigung des Geistes mit abstrakten Gegenständen und heftige Leidenschaften haben in diesem lebensnotwendigen Mechanismus ernste Störungen hervorgerufen; aber es ist noch nicht zu spät, dessen Triebkräfte wiederherzustellen; es ist noch nichts zu eingreifend verändert. Sie können also Ihren Freund mühelos retten«, wandte er sich abschließend an Bianchon.
»Unser gelehrter Kollege nimmt die Wirkung für die Ursache«, antwortete Caméristus. »O ja, die Veränderungen, die er so trefflich festgestellt hat, sind bei dem Patienten vorhanden; aber der Magen hat nicht die stufenweisen Ausstrahlungen in den Organismus und das Hirn hervorgebracht, wie ein Loch in einer Fensterscheibe strahlenförmig Sprünge um sich zieht. Es war ein Stoß nötig, um die Scheibe zu zersprengen. Wer hat diesen Stoß geführt? Wissen wir es? Haben wir den Patienten genügend beobachtet? Kennen wir alle Vorfälle seines Lebens? Messieurs, das Lebensprinzip, der ›Archeus‹ des van Helmont,31 ist bei ihm angegriffen; die Lebenskraft selbst ist an ihrer Wurzel verletzt; der göttliche Funke, die transitorische Intelligenz, die der Maschine als Zusammenhalt dient und den Willen erzeugt, das Bewußtsein des Lebens hat aufgehört, die täglichen Erscheinungen des Mechanismus und die Funktionen jedes Organs zu regeln; das verursacht die Störungen, die mein gelehrter Kollege ganz richtig konstatiert hat. Die Bewegung ging nicht vom Epigastrium zum Hirn, sondern vom Hirn zum Epigastrium. Nein!« rief er und schlug sich dabei heftig auf die Brust, »nein, ich bin kein menschgewordener Magen! Nein, da sitzt nicht alles. Ich habe nicht den Mut, zu behaupten, daß, wenn meine Verdauung klappt, alles übrige Nebensache sei. Wir können«, fuhr er dann ruhiger fort, »die schweren Störungen, die bei verschiedenen Menschen mehr oder weniger heftig auftreten, nicht auf die nämliche physische Ursache zurückführen und dürfen sie nicht einförmig behandeln. Kein Mensch ist dem anderen gleich. Wir haben alle besondere Organe, die verschiedene Wirkungen hervorbringen, verschiedene Lebensgrundlagen brauchen, die verschiedene Aufgaben erfüllen und einer Bestimmung folgen, welche zur Vollendung einer uns noch unbekannten Ordnung der Dinge erforderlich ist. Der Teil des großen Ganzen, der gemäß einem höheren Willen in uns das Phänomen des Lebens bewirkt und unterhält, hat in jedem Menschen seine eigene Ausdrucksform und macht aus ihm ein Wesen, das anscheinend endlich ist, das aber in einem Punkt mit einer unendlichen Ursache verbunden ist. Demzufolge müssen wir jedes Subjekt gesondert studieren, es durchdringen, erkennen, worin sein Leben besteht, welche besondere Kraft ihm eigen ist. Von der Weichheit eines nassen Schwammes bis zur Härte eines Bimssteins gibt es unendliche Abstufungen. So ist es auch mit dem Menschen. Zwischen der schwammigen Organisation lymphatischer Menschen und der metallischen Muskelhärte derjenigen, die zu einem langen Leben bestimmt sind, was für Irrtümer begeht da nicht das einzige, unabänderliche System der Heilung durch Schwächung, durch völlige Erschöpfung der menschlichen Kräfte, die Sie stets für gereizt halten! Im vorliegenden Fall also würde ich eine rein seelische Behandlung vorschlagen, eine tiefgehende Prüfung des inneren Wesens. Suchen wir den Sitz des Übels in den Eingeweiden der Seele statt in den Eingeweiden des Körpers! Ein Arzt ist ein erleuchtetes Wesen, das mit einer besonderen Gabe begnadet ist: Gott hat ihm die Macht verliehen, in der Lebenskraft zu lesen, wie er den Propheten Augen gibt, die Zukunft zu schauen, dem Dichter das Talent, die Natur zu beschwören, dem Musiker die Kunst, die Töne in einer harmonischen Ordnung aneinanderzureihen, deren Vorbild vielleicht dort droben ist! …«
»Immer seine absolutistische, monarchistische und religiöse Medizin«, murmelte Brisset.
»Messieurs«, meldete sich Maugredie rasch zu Wort, so daß Brissets Einwand nicht weiter beachtet wurde, »wir dürfen den Kranken nicht aus dem Auge verlieren …«
»So steht es also mit der Wissenschaft!« rief Raphael verzweifelt in seinem Versteck. »Der eine bringt mir einen Kranz von Blutegeln und der andere einen Rosenkranz zur Heilung; ich habe die Wahl zwischen dem Messer Dupuytrens32 und dem Gebet des Prinzen von Hohenlohe!33 Und auf der Linie, die die Tatsache vom Wort, die Materie vom Geiste trennt, steht Maugredie und zweifelt. Das Ja und Nein der Menschen verfolgt mich immer! Überall das ›Carymary, Carymara‹ des Rabelais: ich bin geistig krank, Carymary! Oder körperlich krank, Carymara! Ob ich am Leben bleibe? Sie wissen es nicht. Da war doch Planchette ehrlicher, als er mir sagte: Ich weiß nicht.«
In diesem Augenblick vernahm Valentin die Stimme des Doktor Maugredie: »Der Kranke ist ein Monomane, schön, einverstanden!« rief er; »aber er hat zweimal 100 000 Livres jährlich. Monomanen der Art sind selten, und wir schulden ihnen mindestens einen Rat. Was die Frage angeht, ob sein Epigastrium auf das Hirn gewirkt hat oder das Hirn auf sein Epigastrium, so können wir sie vielleicht nach seinem Tode beantworten. Machen wir es also kurz. Daß er krank ist, ist nicht zu bestreiten. Irgendwie muß er also behandelt werden. Lassen wir die Lehrmeinungen beiseite. Setzen wir ihm Blutegel an, um die innere Reizung und die Neurose, über deren Vorhandensein wir uns einig sind, zu beseitigen, und dann schicken wir ihn in ein Bad; auf diese Weise wenden wir beide Systeme zugleich an! Ist er schwindsüchtig, dann können wir ihn sowieso kaum retten; also …«
Raphael verließ schnell sein Versteck und begab sich wieder in seinen Lehnstuhl. Bald kamen die vier Ärzte aus dem Arbeitszimmer. Horace führte das Wort und sagte zu ihm: »Die Herren haben einstimmig die Notwendigkeit einer sofortigen Behandlung mit Blutegeln in der Magengegend anerkannt. Ferner ist es nötig, Ihr Leiden zugleich physisch und psychisch zu behandeln. Zunächst eine passende Diät, um die Reizung Ihres Organismus zu beruhigen …«
Hier machte Brisset ein Zeichen der Zustimmung.
»Dann eine hygienische Lebensweise, um auf Ihre geistige Verfassung einzuwirken. Wir raten Ihnen also einstimmig, nach Aix in Savoyen zu reisen oder ein Bad am Mont-Dore in der Auvergne aufzusuchen; die Luft und die Lage von Savoyen sind angenehmer als die des Cantal,34 aber wir überlassen das Ihrem Gutdünken.«
Hier war ein Kopfnicken des Doktor Caméristus zu verzeichnen.
»Diese Herren«, fuhr Bianchon fort, »haben in Ihrem Atmungsapparat leichte Veränderungen bemerkt und haben einhellig meinen bisherigen Vorschriften zugestimmt. Sie sind der Meinung, daß Ihre Heilung nicht schwer sein wird und von einem klugen Wechsel in der Anwendung dieser verschiedenen Mittel wesentlich abhängt … Und …«
»Und nun sind wir so klug wie vorher!« sagte Raphael lächelnd, während er Horace in sein Arbeitszimmer führte, um ihm das Honorar für die überflüssige Konsultation auszuhändigen.
»Sie sind logisch«, antwortete ihm der junge Mediziner; »Caméristus empfindet, Brisset untersucht, Maugredie zweifelt. Hat nicht der Mensch eine Seele, einen Körper und einen Verstand? Eine dieser drei Grundursachen wirkt in uns immer mehr oder weniger stark, und die menschliche Wissenschaft wird eben immer eine menschliche sein. Glaub mir, Raphael, wir heilen nicht, wir helfen der Heilung! Zwischen der Heilkunst Brissets und der von Caméristus gibt es noch die abwartende Methode,35 aber um die mit Erfolg anzuwenden, müßte man seinen Patienten seit zehn Jahren kennen. Die Medizin basiert auf Negation, wie alle Wissenschaften. Versuch also, vernünftig zu leben, mach eine Reise nach Savoyen! Es ist das beste und wird es immer bleiben, sich der Natur anzuvertrauen.«
Einen Monat später waren an einem schönen Sommerabend einige Badegäste von Aix nach der Rückkehr von der Promenade in den Salons des Kurhauses versammelt. Raphael saß an einem Fenster und wandte der Gesellschaft den Rücken. So saß er lange allein; er war in ein stumpfes Brüten versunken, in dem unsere Gedanken kommen, sich verschlingen und verlöschen, ohne rechte Gestalt anzunehmen, und wie leichte kaum gefärbte Wolken in uns verfliegen. Die Trauer ist in diesem Zustand sanft, die Freude schemenhaft, und die Seele schlummert. So überließ sich Valentin diesem Leben der Sinne, erquickte sich an der lauen Atmosphäre des Abends und sog die reine, würzige Bergluft ein. Er war glücklich, keinen Schmerz zu fühlen und sein drohendes Chagrinleder endlich zur Ruhe gebracht zu haben. Die roten Töne der Abenddämmerung erloschen auf den Gipfeln, es wurde kühler. Er verließ seinen Platz und schloß das Fenster.
»Haben Sie die Güte, Monsieur«, sagte eine alte Dame zu ihm, »das Fenster nicht zu schließen! Wir ersticken.«
Dieser Satz klang Raphael seltsam schrill und widerwärtig im Ohr; er war wie das Wort, das einem Freund, auf den wir bauten, unvorsichtig entschlüpft und das den süßen Wahn der Freundschaft zerreißt und uns in einen Abgrund des Egoismus blicken läßt. Der Marquis warf der alten Dame den kühlen Blick eines unzugänglichen Diplomaten zu, rief dann einen Diener und befahl diesem trocken: »Öffnen Sie das Fenster!«
Bei diesen Worten breitete sich auf allen Gesichtern lebhaftes Befremden aus. In der Gesellschaft entstand ein Geflüster, und man blickte den Kranken mit mehr oder weniger beredter Miene an, als hätte er sich sehr unziemlich benommen. Raphael, der seine frühere Jünglingsschüchternheit noch nicht abgelegt hatte, spürte eine Regung von Scham; aber er schüttelte seine Erstarrung ab, gewann seine Energie zurück und fragte sich, was diese seltsame Szene wohl bedeute. Blitzartig kam Leben in seine Gedanken, die Vergangenheit erschien ihm in einer deutlichen Vision: die Ursachen der Gefühle, die er hervorrief, sprangen scharf hervor wie die Adern eines Leichnams, an dem die Präparatoren durch eine zweckdienliche Einspritzung die geringsten Verästelungen gefärbt haben; er sah sich selbst in diesem flüchtigen Bilde, verfolgte sein Leben, Tag für Tag, Gedanken für Gedanken; er sah sich, nicht ohne Überraschung, düster und zerstreut inmitten dieser lachenden Welt; er gewahrte sich, wie er immer über sein Schicksal nachgrübelte, mit seinem Leiden beschäftigt war, das harmloseste Gespräch anscheinend verschmähte, wie er die flüchtigen Vertraulichkeiten scheute, die sich zwischen Reisenden schnell einstellen, weil sie zweifellos damit rechnen, einander nie wieder zu begegnen; er war kaum um die anderen bekümmert und glich letztendlich jenen Felsen, die gegen das Kosen wie gegen das Wüten der Wogen unerschüttert bleiben. Jetzt las er mit einer seltenen Gabe der Intuition in allen Seelen: im Schein eines Leuchters entdeckte er den gelben Schädel und das hämische Profil eines Greises und erinnerte sich, daß er ihm sein Geld abgewonnen hatte, ohne ihm Revanche einzuräumen; ein Stück weiter saß eine hübsche Frau, gegen deren kokette Winke er kalt geblieben war; jedes Gesicht warf ihm ein anscheinend unerklärliches Unrecht vor, sein Verbrechen bestand indes immer in einer unsichtbaren Verletzung der Eigenliebe. Ungewollt hatte er all die kleinen Eitelkeiten, die um ihn kreisten, beleidigt. Die Teilnehmer an seinen Festen oder diejenigen, denen er seine Pferde angeboten hatte, hatten sich über seinen Luxus geärgert; von ihrer Undankbarkeit überrascht, hatte er ihnen diese Art Demütigung erspart; von da an hielten sie sich für verachtet und warfen ihm Dünkel vor. Während er so auf dem Grund der Herzen las, konnte er ihre geheimsten Regungen entziffern; die Gesellschaft, ihre Höflichkeit, ihr Firnis waren ihm widerwärtig. Weil er reich und geistig überlegen war, wurde er beneidet und gehaßt; seine Schweigsamkeit enttäuschte die Neugier; seine Bescheidenheit schien diesen kleinlichen, oberflächlichen Leuten Hochmut. Er kannte jetzt das verborgene, das nicht wiedergutzumachende Verbrechen, das er gegen sie begangen hatte: er entzog sich dem Urteilsspruch ihrer Mittelmäßigkeit. Er lehnte sich gegen ihren zudringlichen Despotismus auf, er brauchte sie nicht; um sich für dieses heimliche Königtum zu rächen, hatten sich alle instinktiv verbündet, um ihn ihre Macht spüren zu lassen, ihn einer Art Scherbengericht zu unterwerfen und ihm zu zeigen, daß sie ihn gleichfalls nicht brauchten. Zuerst war er bei diesem Anblick der Welt voller Mitleid; aber bald schauderte ihn, wenn er an die seltsame Gabe dachte, die ihm so den körperlichen Schleier, unter dem die innere Natur geborgen ist, lüftete. Plötzlich senkte sich ein schwarzer Vorhang über dieses düstere Bild der Wahrheit, und er fand sich allein in der furchtbaren Einsamkeit, die das Los der Großen und Mächtigen ist. In diesem Augenblick überfiel ihn ein heftiger Hustenanfall. Anstatt ein einziges der gleichgültigen und banalen Worte zu vernehmen, mit denen die zufällig zusammengeführten Mitglieder der guten Gesellschaft wenigstens eine Art höfliches Mitleid heucheln, hörte er feindselige Rufe und leise gemurmelte Beschwerden. Die Gesellschaft gab sich nicht einmal mehr die Mühe, sich für ihn zu verstellen, vielleicht weil er sie doch durchschaut hätte.
»Seine Krankheit ist ansteckend.« – »Die Direktion müßte ihm verbieten, ins Kurhaus zu kommen.« – »Es ist ja wahrhaftig polizeiwidrig, so zu husten!« – »Jemand, der so krank ist, soll nicht ins Bad reisen.« – »Er wird mir den Aufenthalt verleiden.«
Raphael stand auf, um sich der allgemeinen Verwünschung zu entziehen, und ging im Saal auf und ab. Er wollte einen Schutz finden und näherte sich einer jungen Dame, die gelangweilt dasaß; er dachte, ihr einige Schmeicheleien zu sagen, aber als er herantrat, wandte sie ihm den Rücken und tat so, als sähe sie den Tänzern zu. Raphael fürchtete, an diesem Abend seinen Talisman schon gebraucht zu haben; er fühlte weder den Willen noch den Mut, ein Gespräch zu beginnen, so verließ er den Salon und zog sich in das Billardzimmer zurück. Da sprach niemand mit ihm, keiner grüßte ihn oder warf ihm auch nur den kürzesten wohlwollenden Blick zu. Sein von Natur aus nachdenklicher Geist enthüllte ihm wie in einer Eingebung die allgemeine und verständliche Ursache der Abneigung, die er hervorgerufen hatte. Diese kleine Welt gehorchte, vielleicht unbewußt, dem großen Gesetz, das die vornehme Gesellschaft regiert, deren unversöhnliche Moral sich vor Raphaels Augen völlig enthüllte. Er sah in die Vergangenheit zurück und erkannte das vollendete Urbild dieser Gesellschaft in Fœdora. Er konnte bei dieser Gesellschaft nicht mehr Mitgefühl für seine Leiden finden als bei Fœdora für die Qualen seines Herzens. Die feine Gesellschaft verbannt die Unglücklichen aus ihrer Mitte, wie ein Gesunder einen Krankheitsträger aus seinem Körper abstößt. Die Welt verabscheut Schmerzen und Unglück; sie fürchtet sie wie eine ansteckende Krankheit, und nie schwankt sie zwischen ihnen und den Lastern; das Laster ist ein Luxus. Wie erhaben ein Unglück auch sein mag, die Gesellschaft weiß es herabzuwürdigen, es durch ein Witzwort lächerlich zu machen; sie zeichnet Karikaturen, um den entthronten Königen den Schimpf an den Kopf zu werfen, den sie von ihnen erlitten zu haben glaubt; sie gleicht den jungen Römerinnen im Zirkus und begnadigt den gefallenen Gladiator nie; sie lebt von Gold und Boshaftigkeit. »Tod den Schwachen!« ist die Losung dieser Art Ritterorden, die es bei allen Völkern der Erde gibt; denn überall gibt es Reiche, und dieser Leitspruch ist tief in die Herzen eingegraben, die vom Reichtum verhärtet oder von aristokratischem Dünkel geschwollen sind. Man denke an die Kinder in einer Lehranstalt: das ist ein Bild der Gesellschaft im kleinen, aber ein Bild, das um so treffender ist, als es naiver und ehrlicher ist; stets gibt es da kleine Heloten, Menschenkinder, die zum Leiden und Dulden geschaffen sind und immer zwischen Verachtung und Mitleid stehen: ihrer ist das Himmelreich, sagt das Evangelium. Man steige auf der Stufenleiter der organischen Wesen noch etwas tiefer. Wenn unter dem Geflügel eines Hühnerhofs eins verletzt ist, dann hacken die anderen mit den Schnäbeln auf es ein, reißen ihm die Federn aus und töten es. Diesem Grundgedanken des Egoismus treu, geht die Welt gegen ein Unglück, das keck genug ist, ihre Feste zu stören, ihre Freuden zu trüben, mit grenzenloser Strenge vor. Wer am Körper oder an der Seele leidet, wem es an Geld oder an Macht fehlt, ist ein Paria. Er bleibe in seiner Verlassenheit! Überschreitet er ihre Grenzen, so findet er überall Kälte: frostige Blicke, frostiges Benehmen, kühle Worte, kalte Herzen. Er kann glücklich sein, wenn er da, wo er Tröstung suchte, nicht Schimpf und Schande erntet! Sterbende, bleibt in euren einsamen Betten! Greise, bleibt allein an eurem erloschenen Herd! Arme Mädchen ohne Mitgift, friert und brennt in euren leeren Dachstuben! Duldet die Welt einmal ein Unglück, dann nur, um es für ihren Gebrauch zurechtzumachen, daraus Gewinn zu schlagen, ihm einen Packsattel überzuschnallen, es an die Kandare zu nehmen, ihm eine Schabracke aufzulegen, es zu besteigen und ihren Spaß mit ihm zu treiben. Betrübte Gesellschaftsdamen, schafft euch vergnügte Gesichter an; ertragt die Launen eurer angeblichen Wohltäterin; tragt ihre Hunde spazieren; seid selbst ihre Affenpinscher, amüsiert sie, erratet ihre Wünsche und seid im übrigen still! Und du, König der Lakaien ohne Livree, gieriger Parasit, laß deinen Charakter zu Hause; verdaue genau so wie dein Gastgeber, weine seine Tränen, lache sein Lachen, sei entzückt über seine Witze; willst du dich über ihn lustig machen, warte, bis er in Staub gesunken ist. So ehrt die Welt das Unglück! Sie tötet es oder verjagt es, erniedrigt es oder kastriert es.
Diese Betrachtungen entsprangen Raphaels Innerem mit der Geschwindigkeit einer poetischen Eingebung; er blickte umher und fühlte die unheimliche Kälte, welche die Gesellschaft um sich verbreitete, um das Elend zu entfernen, und die noch eisiger durch die Seele fährt als der Nordwind im Dezember durch die Glieder. Er kreuzte die Arme über der Brust, lehnte sich an die Wand und versank in tiefe Schwermut. Er dachte, wie wenig Glück diese gräßliche soziale Ordnung der Welt verschaffte. Was denn schon? Vergnügen ohne Freude, Lustigkeit ohne Lust, Feste ohne Heiterkeit, Raserei ohne Rausch, kurz, das Holz oder die Asche eines Herdes, aber ohne den Funken, der die Flamme entzündete. Als er den Kopf hob, sah er, daß er allein war, die Spieler waren entflohen. »Ich brauchte ihnen nur meine Macht zu enthüllen, und sie würden meinen Husten anbeten!« sagte er bei sich. Mit diesen Worten warf er seine Verachtung wie einen Mantel zwischen sich und die Welt.
Am nächsten Tag besuchte ihn der Badearzt mit besorgtem Gesicht und erkundigte sich nach seinem Befinden. Raphael verspürte eine Regung der Freude, als er die teilnahmsvollen Worte hörte, die an ihn gerichtet waren. Er fand die Mienen des Arztes sanft und gütig, aus den Locken seiner blonden Perücke wehte Menschenfreundlichkeit, der Schnitt seines karierten Rockes, die Falten seiner Hose, seine breiten Quäkerstiefel, alles, sogar der Puder, der aus seinem kleinen Zopf kreisförmig auf den leichtgebeugten Rücken gefallen war, sprach von einem apostolischen Charakter, drückte die christliche Nächstenliebe und die Hingabe eines Mannes aus, der sich aus Eifer für seine Patienten angewöhnt hatte, so gut Whist und36 Tricktrack37 zu spielen, daß er ihnen immer ihr Geld abnahm.
»Monsieur le Marquis«, sagte er, nachdem er lange mit Raphael geplaudert hatte, »ich hoffe, Ihre düstere Stimmung verscheuchen zu können. Ich kenne jetzt Ihre Konstitution gut genug, um sagen zu dürfen: die Ärzte von Paris, deren großes Können mir bekannt ist, haben sich in der Natur Ihrer Krankheit getäuscht. Wenn nichts dazwischenkommt, Monsieur le Marquis, können Sie so alt werden wie Methusalem. Ihre Lungen sind so kräftig wie die Blasebälge in einer Schmiede, und Ihr Magen könnte es mit einem Straußenmagen aufnehmen; aber wenn Sie in einem Klima mit dünner Luft bleiben, laufen Sie Gefahr, schnell und sicher in geweihte Erde zu kommen. Monsieur le Marquis werden mich in zwei Wochen verstehen. Die Chemie hat bewiesen, daß die Atmung des Menschen ein richtiger Verbrennungsprozeß ist, dessen größere oder geringere Stärke von übermäßig oder spärlich vorhandenen Brennstoffen abhängt, welche in dem besonderen Organismus jedes Individuums angesammelt werden. Bei Ihnen ist Brennstoff im Überfluß da; Sie sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, infolge des feurigen Naturells der zu großen Leidenschaften fähigen Menschen überreich mit Sauerstoff versehen. Wenn Sie die starke und reine Luft atmen, die bei den Menschen mit schlaffen Fibern das Leben beschleunigt, dann beschleunigen Sie den Verbrennungsprozeß, der ohnehin schon zu rasch ist. Zu Ihren Existenzbedingungen gehört also die dicke Luft der Ställe und Täler. Jawohl, die Lebensluft für einen vom Genie verzehrten Mann findet man auf den fetten Weiden Deutschlands, in Baden-Baden oder Teplitz. Wenn Ihnen England nicht zu unangenehm ist, so könnte sein Nebelklima Ihre Siedeglut löschen; aber unser Bad, das tausend Fuß über dem Spiegel des Mittelmeers liegt, ist unheilvoll für Sie. Das ist meine Ansicht«, schloß er mit einer bescheidenen Handbewegung, »ich vertrete sie gegen unsere Interessen; denn wenn Sie diese befolgen, haben wir das Unglück, Sie zu verlieren.«
Ohne diese letzten Worte wäre Raphael durch die falsche Gutmütigkeit des honigsüßen Arztes getäuscht worden; aber er war ein zu guter Beobachter, um nicht aus dem Ton, der Handbewegung, dem Blick und dem leisen Spott, mit denen dieser Satz gesprochen wurde, die Mission zu erraten, die dem kleinen Mann ohne Frage von der Gesellschaft seiner vergnügten Patienten aufgebürdet worden war. Diese Müßiggänger mit dem blühenden Aussehen, diese gelangweilten alten Weiber, diese vagabundierenden Engländer, diese Bürgerweibchen, die ihren Ehemännern entwischt und von ihrem Geliebten ins Bad entführt worden waren, unternahmen es also, einen armen, schwachen, hinfälligen Kranken, der dem Tode geweiht war und unfähig schien, sich gegen tägliche Verfolgung zu wehren, aus dem Bad zu vertreiben! Raphael nahm den Kampf auf. Diese Intrige machte ihm Vergnügen.
»Da Sie über meine Abreise so unglücklich wären«, antwortete er dem Arzt, »will ich versuchen, mir Ihren guten Rat zunutze zu machen und doch hierzubleiben. Ich werde mir ein Haus bauen lassen, in dem wir die Luft Ihrer Verordnung entsprechend modifizieren, und werde gleich morgen darangehen.«
Der Doktor verstand das Lächeln bitteren Spottes, das um Raphaels Lippen schwebte, und empfahl sich, ohne ein Wort der Erwiderung zu finden.
Der See von Bourget ist ein weites, zerklüftetes Gebirgsbecken, 700-800 Fuß über dem Mittelmeer, ein Wassertropfen von einem so leuchtenden Blau wie kein zweiter in der Welt. Sieht man von der Höhe des Dent-du-Chat auf den See hinunter, so liegt er wie ein verlorener Türkis da. Dieser reizende Wassertropfen hat neun Meilen Umfang und ist an manchen Stellen beinahe 500 Fuß tief. Wenn man unter einem strahlenden Himmel in einem Boot auf dieser Wasserfläche dahinfährt, nichts hört als das Klatschen der Ruder, am Horizont nichts sieht als umwölkte Berge, wenn man sich des glitzernden Schnees der französischen Maurienne38 erfreut, bald an Granitblöcken vorübergleitet, die Farnkraut oder Zwerggesträuch in ein grünes Samtkleid hüllt, bald an lachenden Hängen, auf der einen Seite Öde, auf der anderen üppige Natur, ein Armer beim Gastmahl eines Reichen, bilden diese Harmonien und Dissonanzen ein Schauspiel, in dem alles groß, in dem alles klein ist. Der Anblick der Berge ändert die Bedingungen der Optik und Perspektive: eine Tanne, die 100 Fuß hoch ist, sieht wie ein Schilfrohr aus, weite Täler eng wie schmale Pfade. Dieser See ist der einzige, auf dem man traulich von Herz zu Herz sprechen kann. Hier kann man sinnen und lieben. Nirgends trifft man ein schöneres Einvernehmen zwischen Wasser, Himmel, Bergen und Erde. Auf ihm findet man Balsam für jeden Kummer des Lebens. Dieser Ort bewahrt das Geheimnis des Leides, er tröstet und verringert es, der Liebe verleiht er etwas Ernstes, Andächtiges, das die Glut tiefer und reiner macht. Ein Kuß steigert sich dort zur Seligkeit. Aber vor allem ist er der See der Erinnerungen; er ist ihnen hold, gibt ihnen die Farbe seiner Wellen, ist ihnen ein Spiegel, in dem alles erscheint. Raphael ertrug seine Bürde nur in dieser schönen Landschaft. Hier konnte er unbekümmert, träumerisch und wunschlos sein. Nach dem Besuch des Arztes ging er spazieren und ließ sich nach der einsamen Spitze eines hübschen Hügels übersetzen, auf dessen Höhe das Dorf Saint-Innocent liegt. Von dieser Art Vorgebirge aus umfängt der Blick die Berge von Bugey, an deren Fuß die Rhône fließt, und das Ende des Sees; von hier aus betrachtete Raphael gern die melancholisch anmutende Abtei Haute-Combe auf dem gegenüberliegenden Ufer, die Begräbnisstätte der Könige von Sardinien, die zu Füßen der Berge ruhten wie Pilger, die am Ziel ihrer Reise angelangt sind. Ein gleichmäßiger, rhythmischer Ruderschlag störte den Frieden der Landschaft und lieh ihr eine monotone Stimme, die an die Litaneien der Mönche erinnerte. Der Marquis war erstaunt, in diesem Teil des Sees, der für gewöhnlich einsam war, Gesellschaft anzutreffen, und wandte, ohne sein Träumen aufzugeben, seine Aufmerksamkeit den Personen zu, die in dem Boot saßen. Er erkannte auf der hinteren Bank die alte Dame, die ihn am Abend zuvor so hart angelassen hatte. Als der Kahn an Raphael vorüberfuhr, wurde er nur von der Gesellschafterin dieser Dame gegrüßt, einer armen Adligen, die er zum erstenmal zu sehen glaubte. Nach ein paar Augenblicken schon hatte er die Gesellschaft vergessen, die schnell hinter dem Vorgebirge verschwunden war, als er in seiner Nähe das Rascheln eines Kleides und leichte Tritte hörte. Er wandte sich um und erblickte die Gesellschafterin; an ihrer verlegenen Miene merkte er, daß sie ihn sprechen wollte, und näherte sich ihr. Sie war sechsunddreißig Jahre alt, groß und dürr, vertrocknet und kühl, und wie alle alten Jungfern recht beklommen von seinem Blick, der mit einem unsicheren, zögernden Gang ohne Elastizität nicht mehr übereinstimmen wollte. Weder alt noch jung, gab sie durch eine gewisse würdevolle Haltung zu erkennen, welch hohen Wert sie auf ihre Tugenden und Eigenschaften legte. Sie hatte übrigens die stillen und klösterlichen Bewegungen der Frauen, die nur mit sich selbst zärtlich umzugehen pflegen, gewiß um der Liebe, die ihre Bestimmung ist, nicht zu erliegen.
»Monsieur le Marquis, Ihr Leben ist in Gefahr, kommen Sie nicht mehr ins Kurhaus!« sagte sie zu Raphael und wich dabei ein paar Schritte zurück, als wäre ihre Tugend schon in Gefahr.
»Aber bitte, Mademoiselle«, erwiderte Valentin lächelnd, »wollen Sie sich nicht deutlicher erklären, wenn Sie schon die Freundlichkeit hatten, hierherzukommen?«
»Oh!« gab sie zurück, »wäre es nicht eine so wichtige Sache, hätte ich nie gewagt, die Ungnade von Madame la Comtesse auf mich zu lenken, denn wenn sie jemals erführe, daß ich Sie gewarnt habe …«
»Und wer sollte es ihr sagen?« rief Raphael.
»Das ist wahr«, versetzte das alte Fräulein und warf ihm einen scheuen Blick zu, wie ein Käuzchen, das der Sonne ausgesetzt wird.
»Aber denken Sie an sich«, fügte sie hinzu; »mehrere junge Leute, die Sie aus dem Bade vertreiben wollen, haben abgesprochen, Sie zu provozieren und Sie zu zwingen, sich zu duellieren.«
Aus der Ferne hörte man die Stimme der alten Dame.
»Mademoiselle«, sagte der Marquis, »meinen Dank …«
Seine Gönnerin war bereits geflüchtet, als sie die Stimme ihrer Herrin hörte, die abermals aus den Felsen gellte.
»Armes Mädchen! Die Unglücklichen verstehen und helfen einander immer«, dachte Raphael, während er sich unter einen Baum setzte.
Der Schlüssel zu allen Wissenschaften ist unbestritten das Fragezeichen; wir verdanken die meisten großen Entdeckungen dem Wie, und die Lebensweisheit besteht vielleicht darin, sich bei jeder Gelegenheit zu fragen: Warum. Aber das künstliche Vorherwissen zerstört auch unsere Illusionen. So hatte Valentin, ohne lange philosophische Erwägung, die gute Tat der alten Jungfer zum Gegenstand seiner unsteten Gedanken gemacht und fand lauter Galle darin.
»Daß ich von einer Gesellschaftsdame geliebt werde«, dachte er sich, »ist kein Wunder; ich bin siebenundzwanzig Jahre alt, bin Marquis und habe zweimal 100 000 Livres im Jahr! Aber daß ihre Herrin, die den Katzen die Palme der Wasserscheu streitig macht, sie im Boot in meine Nähe geführt hat, ist das nicht seltsam, fast wunderbar? Diese beiden Frauenzimmer, die nach Savoyen gekommen sind, um hier wie Murmeltiere zu schlafen, die des Mittags fragen, ob schon Tag ist, sollten heute vor acht Uhr aufgestanden sein, um dieses Wagstück, mich aufzuspüren, zu unternehmen!«
Bald war diese alte Jungfer und ihre vierzigjährige Unschuld in seinen Augen eine neue Verwandlung dieser künstlichen und tückischen Welt, eine elende List, ein täppisches Komplott, eine boshafte Spitzfindigkeit, die ein Priester oder eine Frau ersonnen hatte. War das Duell ein Märchen, oder wollte man ihm nur Angst einjagen? Diese dürftigen Seelen, die frech und aufdringlich wie Fliegen waren, durften sich rühmen, seine Eitelkeit erregt, seinen Stolz geweckt, seine Neugier gekitzelt zu haben. Er wollte weder ihr Narr sein noch als Feigling gelten, und da ihn diese Posse zu amüsieren anfing, ging er noch am nämlichen Abend ins Kurhaus. Er stützte sich auf den Marmor des Kamins und blieb ruhig in der Mitte des großen Salons stehen, sorgsam bedacht, sich keine Blöße zu geben; aber er prüfte die Mienen und bot vielleicht gerade durch diese Umsicht der Gesellschaft die Stirn. Wie eine Dogge, die ihrer Kraft sicher ist, wartete er den Kampf ruhig ab, ohne unnütz zu bellen. Gegen Ende des Abends schlenderte er durch den Spielsalon bis zur Tür des Billardzimmers, von wo aus er von Zeit zu Zeit einen Blick auf die jungen Leute warf, die dort eine Partie spielten. Nach kurzer Zeit hörte er seinen Namen nennen. Obwohl sie leise sprachen, erriet Raphael doch sofort, daß sich der Disput um ihn drehte, und schließlich hörte er einige Sätze, die laut gesprochen wurden: »Du?« – »Ja, ich!« – »Ich trau dirs nicht zu!« »Wollen wir wetten?« – »Oh! Es gilt!« Als Valentin, der neugierig war zu hören, worum sich diese Wette drehte, stehenblieb, um das Gespräch besser zu hören, trat ein großer, kräftiger junger Mann von gutmütigem Aussehen, aber mit dem festen, unverschämten Blick der Leute, die sich auf irgendeine materielle Macht stützen, vom Billard her auf ihn zu.
»Monsieur«, sagte er ruhigen Tones zu Raphael, »ich habe es auf mich genommen, Ihnen etwas beizubringen, was Sie nicht zu wissen scheinen: Ihr Gesicht und Ihre Person mißfallen hier jedermann und mir im besonderen. Sie sind zu gut erzogen, um sich nicht dem allgemeinen Wohl zu opfern; ich ersuche Sie daher, sich nicht mehr im Kurhaus zu zeigen.«
»Dieser Scherz, Monsieur«, erwiderte Raphael kalt, »machte schon zur Zeit des Kaisers in mehreren Garnisonen die Runde. Heutzutage zeugt er von einem äußerst schlechten Benehmen.«
»Ich scherze nicht«, erwiderte der junge Mann; »ich wiederhole Ihnen: wenn Sie hierherkommen, leidet Ihre Gesundheit; die Hitze, die Lichter, die schlechte Luft im Saal, die Gesellschaft, all das muß bei Ihrem Leiden schädlich sein.«
»Wo haben Sie Medizin studiert?«
»Ich habe den Bakkalaureus im Schießen bei Lepage in Paris gemacht und den Doktor bei Grisier, dem König des Floretts.«
»Der letzte Grad fehlt Ihnen noch, studieren Sie das Gesetzbuch des guten Tons, und Sie werden ein vollkommener Edelmann.«
Jetzt verließen die jungen Leute, teils lachend, teils schweigend, das Billard. Die anderen Spieler wurden aufmerksam und ließen ihre Karten im Stich, um Zeugen eines Streits zu sein, der sie angenehm kitzelte. Raphael stand inmitten dieser Versammlung von Feinden allein da; er gab sich Mühe, kaltes Blut zu bewahren und nicht die geringste Unbesonnenheit zu begehen; aber als sein Gegner sich eine sarkastische Bemerkung erlaubte, die in einer äußerst schneidenden und witzigen Form eine grobe Beleidigung verbarg, antwortete er ihm ernst: »Monsieur, es ist heutzutage nicht mehr gestattet, jemandem eine Ohrfeige zu geben, aber ich finde kein Wort, um ein so erbärmliches Benehmen wie das Ihre zu brandmarken.«
»Genug! genug! Sie können sich morgen erklären!« riefen einige junge Leute und trennten die Streitenden.
Raphael galt als Beleidiger. Als er den Salon verließ, war vereinbart, daß man sich in der Nähe des Schlosses Bordeau, auf einer kleinen Bergwiese, treffen wollte, die unweit einer neuen Straße gelegen war, auf welcher der Sieger Lyon erreichen konnte. Es blieb Raphael nichts übrig, als entweder das Bett zu hüten oder die Bäder von Aix zu verlassen. Die Gesellschaft triumphierte. Am nächsten Morgen gegen acht Uhr traf Raphaels Gegner in Begleitung von zwei Zeugen und einem Wundarzt zuerst an Ort und Stelle ein.
»Der Platz ist gut; das Wetter ist famos, um sich zu schlagen!« rief er fröhlich. Er blickte auf das blaue Himmelsgewölbe, das Wasser des Sees und die Felsen, ohne einen Hauch von Zweifel oder Besorgnis. »Wenn ich ihn an der Schulter treffe«, fuhr er fort, »schicke ich ihn dann wohl für einen Monat ins Bett, nicht wahr, Doktor?«
»Mindestens«, erwiderte der Wundarzt. »Aber lassen Sie die kleine Weide da in Ruhe; sonst ermüden Sie Ihre Hand und haben Ihren Schuß nicht in der Gewalt. Sie könnten Ihren Gegner töten, statt ihn zu verwunden.«
Man hörte das Rasselns eines Wagens.
»Da ist er!« sagten die Zeugen. Bald sah man auf der Straße einen vierspännigen Reisewagen, der von zwei Postillionen gelenkt wurde.
»Sonderbare Art!« rief Valentins Gegner. »Er will sich auf der Reise töten lassen.«
Bei einem Duell wie beim Spiel haben auch die geringsten Nebensächlichkeiten auf die Phantasie der Teilnehmer, die am Erfolg ihrer Sache stark interessiert sind, großen Einfluß; der junge Mann erwartete daher mit einer gewissen Ungeduld die Ankunft dieses Wagens, der auf der Straße hielt. Zuerst stieg der alte Jonathas schwerfällig aus, um Raphael beim Aussteigen zu helfen; er stützte ihn mit seinen schwachen Armen und entfaltete dabei die peinliche Sorgfalt eines Liebenden für seine Liebste. Die beiden verloren sich dann auf den Fußwegen, die die Landstraße von dem Kampfplatz trennten, und kamen erst lange nachher wieder zum Vorschein: sie gingen langsam. Die vier Zuschauer dieser seltsamen Szene waren tiefbewegt, als sie Valentin, auf den Arm seines Dieners gestützt, heraufkommen sahen; bleich und erschöpft kam er mühsam näher, hielt den Kopf gesenkt und sprach kein Wort. Man konnte die beiden für zwei Greise halten, die in gleichem Maße zerrüttet waren: der eine durch die Zeit, der andere durch den Geist; dem einen stand sein Alter auf seine weißen Haare geschrieben, der jüngere hatte kein Alter mehr.
»Monsieur, ich habe nicht geschlafen!« sagte Raphael zu seinem Gegner.
Diese eisigen Worte und der fürchterliche Blick, der sie begleitete, ließen den wirklichen Herausforderer erzittern; sein Unrecht wurde ihm bewußt, und er schämte sich insgeheim seines Benehmens. Es lag in der Haltung, dem Klang der Stimme und den Bewegungen Raphaels etwas Seltsames. Der Marquis schwieg eine Weile, und jeder folgte seinem Schweigen. Unruhe und Spannung hatten ihren Höhepunkt erreicht.
»Es ist Zeit«, fuhr Raphael dann fort, »mir eine leichte Satisfaktion zu geben; gewähren Sie sie mir; sonst werden Sie sterben. Sie zählen in diesem Augenblick noch auf Ihre Geschicklichkeit und schrecken nicht vor einem Kampf zurück, der Ihnen jeden Vorteil zu bieten scheint. Nun, Monsieur, ich bin großzügig, ich warne Sie vor meiner Überlegenheit. Ich besitze eine schreckliche Macht. Um Ihre Geschicklichkeit zunichte zu machen, Ihre Blicke zu verschleiern, Ihre Hand zum Zittern zu bringen und Ihr Herz verzagt zu machen, ja selbst um Sie zu töten, brauche ich es nur zu wünschen. Ich will nicht genötigt sein, meine Macht zu gebrauchen, es kostet mich zuviel, sie auszuüben. Sie werden nicht der einzige sein, der sterben muß. Wenn Sie es also ablehnen, sich bei mir zu entschuldigen, wird Ihre Kugel trotz all Ihrer Übung im Morden in diesen Wasserfall fliegen, meine indessen, ohne daß ich ziele, mitten in Ihr Herz.«
Bei diesen Worten wurde Raphael von Stimmengewirr unterbrochen. Der Marquis hatte, während er diese Worte sprach, auf seinen Gegner beständig die unerträgliche Klarheit seines starren Blickes gerichtet, er stand aufgereckt mit undurchdringlichem Gesicht und sah aus wie ein zu allem entschlossener Wahnsinniger.
»Bring ihn zum Schweigen«, hatte der junge Mann zu einem seiner Sekundanten gesagt, »seine Stimme geht mir durch Mark und Bein!«
»Hören Sie auf, Monsieur. Ihre Reden sind unnütz!« riefen die Zeugen und der Wundarzt Raphael zu.
»Messieurs, ich erfülle eine Pflicht. Hat der junge Mann noch Verfügungen zu treffen?«
»Genug! Genug!«
Der Marquis blieb unbeweglich stehen, ohne seinen Gegner einen Augenblick aus den Augen zu lassen, der, von einer fast magischen Gewalt bezwungen, dastand wie ein Vogel vor einer Schlange: gezwungen, diesen mörderischen Blick zu ertragen, er floh ihn und wandte sich ihm doch immer wieder zu.
»Gib mir Wasser, ich habe Durst«, sagte er zu seinem Zeugen.
»Hast du Angst?«
»Ja«, antwortete er; »das Auge dieses Menschen ist brennend und macht mich verrückt.«
»Willst du dich bei ihm entschuldigen?«
»Es ist zu spät.«
Die beiden Gegner wurden einander auf 15 Schritt Entfernung gegenübergestellt. Sie hatten jeder ein Paar Pistolen bei sich, und nach dem vereinbarten Ablauf dieser Zeremonie sollten sie, nachdem die Zeugen das Zeichen gegeben hatten, nach Belieben jeder zwei Schüsse abfeuern.
»Was machst du, Charles?« rief der junge Mann, der Raphaels Gegner als Sekundant diente, »du schiebst die Kugel ein und hast noch kein Pulver drin!«
»Es ist mein Tod!« gab er zurück; »ihr habt mich so gestellt, daß mich die Sonne blendet.«
»Sie haben sie hinter sich«, sagte Valentin mit ernster, feierlicher Stimme. Er lud langsam seine Pistole und ließ sich weder durch das Zeichen, das schon gegeben war, noch durch die Sorgfalt, mit der sein Gegner auf ihn zielte, beirren.
Diese übernatürliche Sicherheit hatte etwas Furchterregendes, das selbst die beiden Postillione, die aus grausamer Neugier herbeigekommen waren, entsetzte. Ob er nun mit seiner Macht spielen oder sie erproben wollte, Raphael sprach mit Jonathas und sah ihn in dem Augenblick an, wo sein Gegner feuerte. Die Kugel zerriß einen Weidenzweig und klatschte ins Wasser. Raphael schoß aufs Geratewohl los, traf seinen Gegner ins Herz und zog schnell, ohne den zusammensinkenden jungen Mann weiter zu beachten, das Chagrinleder hervor, um zu sehen, was ihn ein Menschenleben kostete. Der Talisman war nur noch so groß wie ein kleines Eichenblatt.
»Nun, was habt ihr da zu glotzen, Postillione? Auf den Wagen! Vorwärts!« rief der Marquis.
Er langte noch am Abend in Frankreich an, reiste sofort in die Auvergne weiter und begab sich in die Bäder des Mont-Dore. Auf dieser Reise stieg aus seinem Herzen eine jener plötzlichen Eingebungen, die, wie ein Sonnenstrahl durch dicke Wolken auf ein dunkles Tal, unerwartet in unsere Seele fallen. Trauriges Licht, unerbittliche Erkenntnis! Sie erhellt, was geschehen ist, enthüllt uns unsere Fehler, und gnadenlos sehen wir uns selbst. Er begriff mit einem Mal, daß der Besitz einer Macht, mochte sie noch so gewaltig sein, nicht die Weisheit verlieh, sich ihrer zu bedienen. Das Zepter ist ein Spielzeug für ein Kind, eine Axt für Richelieu und für Napoleon ein Hebel, um die Welt aus den Angeln zu heben. Die Macht läßt uns, wie wir sind, nur die Großen macht sie noch größer. Raphael hätte alles tun können und hatte nichts getan.
In den Bädern des Mont-Dore traf er wieder die Gesellschaft, die sich stets eilig vor ihm zurückzog, wie die Tiere einen tot daliegenden Artgenossen fliehen, sobald sie ihn von weitem gewittert haben. Dieser Haß war gegenseitig. Sein letztes Abenteuer hatte ihn mit einer tiefen Abscheu vor der Gesellschaft erfüllt. So war es denn seine erste Sorge, eine von den Menschen weit abgelegene Bleibe in der Nähe der Bäder zu suchen. Er fühlte instinktiv das Bedürfnis, sich der Natur zu nähern und sich den wahren Empfindungen und einem gleichsam vegetativen Leben zu überlassen, wie wir es auf dem Land so gern tun. Am Tage nach seiner Ankunft erstieg er, nicht ohne Mühe, den Pic de Sancy und suchte die hochgelegenen Täler auf, die luftigen Höhen, die unbekannten Seen, die ländlichen Hütten auf diesem Gebirgszug, dessen herbe und wilde Schönheiten die Pinsel unserer Künstler zu locken beginnen. Manchmal finden sich da wunderbare Landschaften voller Anmut und Frische, die sich malerisch von dem düsteren Anblick der öden Berge abheben. Etwa eine halbe Meile von dem Dorf entfernt entdeckte Raphael eine Stelle, wo die Natur, schelmisch und mutwillig wie ein Kind, offenbar Vergnügen daran gefunden hatte, Schätze zu verbergen; als er diese zauberhaft schöne, unberührte Einsamkeit erblickte, beschloß er, hier zu leben. Hier mußte das Leben ruhig, ursprünglich und gedeihlich sein wie das einer Pflanze.
Man stelle sich einen umgedrehten Kegel vor, aber einen Kegel aus Granit, der, stark erweitert, eine Art Becken bildete, dessen Ränder durch bizarre Unebenheiten zerfetzt sind: hier flache, bläulich schimmernde Tafeln ohne Vegetation, auf denen die Sonnenstrahlen aufgleißen wie auf einem Spiegel; dort zerklüftete, von Schluchten zerrissene Felswände, von denen Lavablöcke herabhingen, deren Sturz die Regengüsse langsam vorbereiteten, zuweilen krönten sie ein paar verkrüppelte, von den Winden gepeitschte Bäume; hie und da ragte auf den düster schattigen kühlen Felsbänken ein Gehölz mit Kastanienbäumen empor, hoch wie Zedern; gelbliche Grotten öffneten einen schwarzen, tiefen Schlund, den Brombeersträucher und Blumen umrankten und eine grüne Zunge zierte. Auf dem Grund dieses Beckens, wahrscheinlich der erloschene Krater eines Vulkans, befand sich ein kleiner See, dessen klares Wasser wie ein Diamant erstrahlte. Um dieses tiefe, von Granit, Weiden, Schwertlilien, Eschen und tausenderlei duftenden, in voller Blüte prangenden Pflanzen gesäumte Becken dehnte sich eine grüne Wiese wie ein englischer Rasen; ihr zartes, schmiegsames Gras nahm das Wasser auf, das aus den Felsspalten sickerte, und wurde von den pflanzlichen Überresten gedüngt, die die Stürme von den hohen Gipfeln unablässig in die Tiefe trieben. Unregelmäßig gezackt wie der Spitzensaum eines Frauengewandes mochte der Weiher etwa drei Morgen groß sein; je nach dem Platz, den die hervortretenden Felswände oder die Krümmungen der Wasserfläche ihr ließen, war die Wiese einen oder zwei Morgen breit; an einigen Stellen allerdings war kaum so viel Platz, daß die Kühe hindurchgelangen konnten. In einer bestimmten Höhe hörte der Pflanzenwuchs auf. Der Granit ragte in den absonderlichsten Formen gen Himmel und zeigte die dunstigen Töne, welche die hohen Berge Wolken gleichen lassen. Dem lieblichen Anblick des kleinen Tales setzten diese kahlen, nackten Felsen das wilde, trostlose Bild der Öde entgegen, des Schreckens der Bergstürze und so phantastischer Formen, daß einer dieser Felsen »der Kapuziner« genannt wird, so sehr ähnelt er einem Mönch. Je nach dem Stand der Sonne oder den Launen der Atmosphäre leuchteten diese spitzen Nadeln, diese kühnen Pfeiler, diese luftigen Höhlen zuweilen auf und schimmerten golden, färbten sich purpurn, tief rosa, oder nahmen trübe oder graue Töne an. Diese Höhen boten ständig ein wechselndes Farbenspiel, wie das schillernde Gefieder auf dem Hals der Tauben. Oft drang zwischen zwei Lavablöcke, die aussahen, als hätte sie ein Beil auseinandergehauen, in der Morgenröte oder beim Sonnenuntergang ein froher Lichtstrahl in dieses lachende Schmuckkörbchen, wo er auf den Wassern des Teiches spielte, ähnlich dem goldenen Streifen, der durch den Spalt eines Fensterladens in ein spanisches Zimmer dringt, das man sorgfältig für die Siesta geschlossen hat. Wenn die Sonne über dem alten Krater stand, der von irgendeiner vorsintflutlichen Revolution her mit Wasser gefüllt war, erwärmten sich die schroffen Felswände, der alte Vulkan entbrannte, und seine plötzliche Glut erweckte in diesem unbekannten Fleckchen Erde die Keime, ließ einen üppigen Pflanzenwuchs gedeihen, färbte die Blumen und reifte die Früchte. Als Raphael dorthin kam, erblickte er einige Kühe, die auf der Wiese weideten; nachdem er ein paar Schritte zum See getan hatte, gewahrte er an der Stelle, wo das Tal am breitesten war, ein bescheidenes Haus, das aus Granit erbaut und mit Schindeln gedeckt war. Das Dach dieser Hütte fügte sich in die Landschaft ein: es war mit Moos, Efeu und Blumen bewachsen, die auf ein hohes Alter schließen ließen. Dünner Rauch, vor dem die Vögel keine Scheu mehr hatten, stieg aus dem verfallenen Schornstein. Vor der Tür stand zwischen zwei riesigen Geißblattsträuchern, die, mit roten Blüten übersät, einen wundervollen Duft ausströmten, eine große Bank. Kaum sah man die Mauern unter den Ranken der Weinreben und den Gewinden der Rosen und des Jasmins, die ungehindert emporwucherten. Die Bewohner kümmerten sich nicht um diesen ländlichen Schmuck und ließen der Natur ihre jungfräuliche und elementare Anmut. Auf einem Johannisbeerstrauch waren Windeln zum Trocknen aufgehängt. Eine Katze hockte auf einem Gerät zum Flachsbrechen, darunter stand in einem Haufen Kartoffelschalen ein frisch gescheuerter gelber Kochkessel. Auf der anderen Seite des Hauses erblickte Raphael ein Gehege aus dürren Dornsträuchern, das offenbar die Hühner davon abhalten sollte, die Obststräucher und Gemüsebeete zu plündern.
Die Welt schien hier zu Ende. Diese Kate glich jenen Vogelnestern, die sinnreich in eine Felshöhlung geklebt sind, kunstvoll und nachlässig zugleich. Hier war eine unberührte und gute Natur, eine echte, aber poetische Ländlichkeit, die gerade darum poetisch war, weil sie tausend Meilen von unseren gemalten Poesien entfernt blühte und keiner Idee, sondern – ein wahrer Triumph des Zufalls – nur sich selbst entsprang. Als Raphael dort anlangte, stand die Sonne zu seiner Rechten und ließ die bunten Farben der Pflanzen aufleuchten, die gelben und grauen Gründe der Felsen, das verschiedene Grün des Laubes, die roten, blauen und weißen Blütenmeere, die Schlingpflanzen mit ihren Glocken, den schimmernden Samt der Moose, die purpurnen Trauben des Heidekrauts, vor allem aber die klare Wasserfläche, in der sich die Granithäupter der Berge, die Bäume, das Haus und der Himmel getreulich spiegelten, scharf hervortreten oder schmückte das alles mit dem Zauber von Licht und Schatten. Auf diesem entzückenden Bild hatte alles seinen besonderen Glanz, von dem funkelnden Glimmer bis zu den gelben Grasbüscheln, die in einem sanften Helldunkel standen. Alles bot einen harmonischen Anblick: die gefleckte Kuh mit dem blanken Fell, die hauchzarten Wasserpflanzen, die aus einer Senke wie Fransen über dem Wasser hingen und von azurblau oder smaragdgrün schillernden Insekten umschwirrt wurden, und die Baumwurzeln, die kraus gewundenen sandigen Haarschöpfen glichen und ein unförmiges Steingesicht krönten. Der laue Duft des Wassers, der Blumen und der Grotten, der an diesem stillen Ort die Luft schwängerte, erregten in Raphael ein fast wollüstiges Gefühl. Das majestätische Schweigen, das in diesem Hain herrschte, der vielleicht sogar auf den Listen des Steuereinnehmers vergessen war, wurde plötzlich durch das Kläffen zweier Hunde unterbrochen. Die Kühe wandten den Kopf nach dem Eingang des Tales, streckten Raphael ihre feuchten Mäuler entgegen, und nachdem sie ihn stumpfsinnig angesehen hatten, grasten sie weiter. Eine Ziege und ihr Zicklein, die wie durch Zauberei Halt an den Felsen fanden, setzten in großen Sprüngen den Hang herab und hielten auf einer Granitplatte unweit von Raphael inne, als ob sie ihn ausfragen wollten. Das Bellen der Hunde lockte ein dickes Kind vor das Haus, wo es mit offenem Munde stehenblieb, dann erschien ein weißhaariger, untersetzter Greis. Diese beiden Gestalten standen mit der Landschaft, der Luft, den Blumen und dem Haus im Einklang. In dieser üppigen Natur strotzte alles von Gesundheit, Alter und Kindheit waren hier schön; kurz, alle Geschöpfe, die dort lebten, strahlten ein ursprüngliches Sichgehenlassen, eine Vertrautheit mit dem Glück aus, die unsere philosophischen Kapuzinerpredigten Lügen straften und das von seinen Leiden und Leidenschaften aufgeblähte Herz heilte. Der Greis schien eins von den Modellen, wie sie der männliche Pinsel von Schnetz39 liebt: ein wettergebräuntes Gesicht, dessen zahlreiche Falten hart und vertrocknet schienen, eine gerade Nase, hervorspringende Wangen, die wie ein herbstliches Weinblatt rot geädert waren, eckige Konturen, alle Anzeichen von Kraft, selbst da, wo die Kraft schon dahin war. Seine Hände waren schwielig, obwohl sie nicht mehr arbeiteten, und noch immer mit feinem weißen Haar bedeckt; seine wahrhaft freie, männliche Haltung ließ ahnen, daß er in Italien aus Liebe zu seiner kostbaren Freiheit vielleicht zum Räuber geworden wäre. Das Kind, ein wahres Kind der Berge, hatte schwarze Augen, die in die Sonne sehen konnten, ohne zu blinzeln, dunkle Haut und einen wirren braunen Haarschopf. Es war flink, entschieden und natürlich in seinen Bewegungen wie ein Vogel; durch die Löcher seiner armseligen Kleidung schimmerte eine weiße und frische Haut. Alle beide blieben schweigend nebeneinander stehen; das gleiche Gefühl bewegte sie, und der Ausdruck ihrer Züge zeugte von der vollkommenen Übereinstimmung in ihrer beider gleichermaßen müßigem Leben. Der Greis hatte sich die Spiele des Kindes zu eigen gemacht und das Kind die Launen des Alten angenommen; eine Art Pakt zwischen zwei Schwachen, zwischen einer Kraft, die dem Ende zuging, und einer Kraft, die vor der Entfaltung stand. Bald zeigte sich eine etwa dreißigjährige Frau auf der Schwelle. Sie strickte im Gehen. Es war eine echte Auvergnatin, von lebhafter Gesichtsfarbe, mit offener, heiterer Miene und weißen Zähnen; sie hatte das Gesicht der Auvergne, den Wuchs der Auvergne, Haube und Tracht der Auvergne, die vollen Brüste der Auvergne und die Mundart der Auvergne; ein vollkommenes Idealbild des Landes, seiner arbeitsamen Sitten, seiner Unwissenheit, Sparsamkeit und Herzlichkeit; es fehlte nichts.
Sie grüßte Raphael, und es entspann sich ein Gespräch. Die Hunde beruhigten sich; der Greis setzte sich auf eine Bank in die Sonne, und das Kind wich seiner Mutter nicht von der Seite; es schwieg, aber hörte aufmerksam zu und sah den Fremden forschend an.
»Ihr fürchtet Euch hier nicht, gute Frau?«
»Und weshalb sollten wir Furcht haben, Monsieur? Wenn wir den Eingang versperren, wer sollte dann wohl hereinkönnen? Oh, wir haben keine Furcht! Übrigens« – damit ließ sie den Marquis in das große Zimmer des Hauses treten – »was sollten die Diebe denn bei uns holen?«
Sie wies auf die rauchgeschwärzten Wände, an denen als einziger Schmuck die blau, rot und grün kolorierten Stiche hingen: »Der Tod des Kredits«, »Die Passion Jesu Christi« und »Die Grenadiere der kaiserlichen Garde«. Weiterhin gab es in dem Zimmer ein altes Säulenbett aus Nußbaum, einen Tisch mit gedrechselten Beinen, Holzschemel, den Backtrog, eine Speckseite, die von der Decke baumelte, einen Salztopf, eine Pfanne und auf dem Kamin vergilbte, bemalte Gipsfiguren. Als er das Haus wieder verließ, sah Raphael auf den Felsen einen Mann, der eine Hacke in der Hand hielt, sich neugierig vorbeugte und auf das Haus sah.
»Sehen Sie Monsieur, da ist der Mann«, sagte die Auvergnatin. Dabei lächelte sie, wie man es an Bäuerinnen oft sieht. »Er arbeitet da oben.«
»Und der Alte ist Euer Vater?«
»Sie müssen schon entschuldigen, Monsieur, das ist der Großvater vom Mann. So wie Sie ihn da sehen, ist er hundertzwei Jahre alt. Nun, kürzlich hat er unseren kleinen Kerl zu Fuß nach Clermont geführt! Er war einmal ein starker Mann; jetzt tut er nichts mehr als essen, trinken und schlafen. Er macht sich immer mit dem kleinen Kerl zu schaffen. Manchmal führt der Kleine ihn auf den Berg; es geht immer noch.«
Sofort entschloß sich Valentin, bei diesem alten Mann und dem Kind zu leben, in ihrer Luft zu atmen, von ihrem Brot zu essen, von ihrem Wasser zu trinken, ihren Schlaf zu schlafen, ihr Blut durch seine Adern fließen zu lassen. Die Laune eines Sterbenden! Eine der Austern dieses Felsens zu werden, seine Schale noch einige Tage länger zu retten, indem er den Tod blind und taub machte, das wurde für ihn das Leitbild der individuellen Moral, die wahrhafte Formel des menschlichen Daseins, das schöne Ideal des Lebens, das einzige Leben, das wahre Leben. Ein inbrünstiger Egoismus bemächtigte sich seines Herzens, in dem das Universum versank. In seinen Augen gab es kein Universum mehr, das Universum war in ihm. Für einen Kranken fängt die Welt am Kopfkissen an und endet am Fußende des Bettes. Diese Landschaft wurde Raphaels Bett.
Wer hat nicht schon einmal in seinem Leben den Lauf und das Verhalten einer Ameise eifrig beobachtet; in das einzige Atemloch einer weißen Schnecke Strohhalme gesteckt; den launischen Flug einer schlanken Libelle verfolgt oder die tausend Äderchen bewundert, die sich, bunt wie die Rosette einer gotischen Kathedrale, auf den rötlichen Blättern einer jungen Eiche abzeichnen? Wer hat nicht eine geraume Weile entzückt die Wirkung der Sonne und des Regens auf ein braunes Ziegeldach betrachtet oder die Tautropfen, die Blütenblätter, ihre mannigfaltig gezackten Kelche beschaut? Wer war nicht schon in diese sinnlichen, trägen und hingegebenen Träume versunken, die kein Ziel haben und doch zu einem Gedanken führen? Wer schließlich hat nicht schon einmal das Leben des Kindes, das faule Leben, das Leben des Wilden ohne dessen tägliche Verrichtung geführt? So lebte Raphael mehrere Tage lang, ohne Sorgen, ohne Wünsche. Er fühlte sich merklich besser, fühlte ein außergewöhnliches Behagen, das seine Unruhe besänftigte, seine Qualen linderte. Er stieg auf die Felsen und setzte sich auf eine Bergspitze, von der aus sein Auge bis in die weite Ferne schaute. Da verbrachte er ganze Tage wie eine Pflanze in der Sonne, wie ein Hase auf seinem Lager. Oder er machte sich mit den Erscheinungen der Vegetation, mit den Veränderungen des Himmels vertraut, er beobachtete aufmerksam die fortschreitende Entwicklung auf der Erde, im Wasser oder in der Luft. Er versuchte sich mit dem inneren Leben dieser Natur zu verbinden und mit ihrem duldenden Gehorsam so völlig zu verschmelzen, daß er dem unumschränkten, zwingenden und erhaltenden Gesetz verfiel, das über den Geschöpfen, die dem Instinkt folgen, waltet. Er wollte nicht länger die Last seiner selbst tragen. Gleich den Verbrechern vergangener Zeiten, die, von der Justiz verfolgt, gerettet waren, wenn sie sich in den Schatten eines Altars geflüchtet hatten, versuchte er sich in das Heiligtum des Lebens einzuschleichen. Es gelang ihm, ein Teil dieses weiten und mächtigen Reifeprozesses der Natur zu werden: er hatte alle Unbilden der Witterung erfahren, in allen Höhlen der Felsen gehaust, die Eigenarten und Gewohnheiten aller Pflanzen kennengelernt, die Herkunft und den Verlauf der Quellen erforscht und mit den Tieren Bekanntschaft geschlossen; kurz, er war mit dieser belebten Erde so völlig eins geworden, daß er gewissermaßen ihre Seele erfaßt hatte und in ihre Geheimnisse eingedrungen war. Für ihn waren die unendlichen Formen in allen Reichen der Natur die Entwicklungen ein und derselben Substanz, die Kombinationen ein und derselben Bewegung, der weitreichende Atem eines ungeheuren Wesens, das wirkte, dachte, voranschritt, wuchs und mit dem er wachsen, voranschreiten, denken und wirken wollte. Er hatte sein Leben in romantischer Art mit dem Leben dieses Felsens vereint, war mit ihm verwachsen. Dank diesem geheimnisvollen Aufflackern, dieser künstlichen Genesung, die den wohltätigen Zuständen des Deliriums zu vergleichen war, mit denen die Natur dem Schmerz Pausen der Erleichterung bewilligt, kostete Valentin in den ersten Tagen seines Aufenthalts in dieser lachenden Landschaft die Wonnen einer zweiten Kindheit. Er lebte so in den Tag hinein, ergründete Nichtigkeiten, unternahm tausend Dinge, ohne eins zu vollenden, vergaß heute, was er gestern vorgehabt hatte, und war sorglos, war glücklich und glaubte sich gerettet. Eines Tages war er zufällig bis Mittag im Bett geblieben; er lag in eine der Träumereien versunken, die aus Schlaf und Wachen gemischt sind, die der Wirklichkeit den Anschein der Phantasie, den Trugbildern die Gestalt der Wirklichkeit verleihen, als er plötzlich, ohne daß er gleich wußte, ob er nicht weiterträumte, zum erstenmal den Bericht über sein Befinden mit anhörte, den seine Wirtin Jonathas mitteilte, der wie jeden Tag heraufgekommen war, um sich danach zu erkundigen. Die Auvergnatin glaubte wahrscheinlich, Valentin schlafe noch, und hielt es nicht für nötig, ihre schallende Stimme zu dämpfen.
»Es geht nicht besser und nicht schlechter«, sagte sie. »Er hat heute nacht wieder gehustet, als ob er seine Seele von sich geben wollte. Er hustet, er spuckt, der gute Monsieur, daß es ein Jammer ist. Wir fragen uns, ich und mein Mann, wo er die Kraft hernimmt, so zu husten. Es zerreißt das Herz. Was für eine verdammte Krankheit hat er! Gar nicht, ganz und gar nicht gut geht es! Ich hab immer Angst, er liegt eines Morgens starr und stumm in seinem Bett. Er ist wahrhaftig blaß wie ein wächserner Jesus! Oh je, ich sehe es, wenn er aufsteht, sein armer Leib ist klapperdürr. Und er riecht schon nicht gut, nee, wahrhaftig nicht! Das ist ihm piepe, er läuft herum und verbraucht seine Kräfte, als ob er noch Gesundheit zu verkaufen hätte. Dabei behält er trotzdem den Kopf oben und jammert niemals! Aber wahrhaftig, unterm Boden wär ihm wohler, er leidet ja zum Steinerbarmen! Ich möcht’s nicht haben, unser Interesse wär’s nicht. Aber gäb er uns auch nicht, was er uns gibt, ich hätt ihn doch lieb: ’s ist nicht aus Berechnung, wahrhaftig nicht! Ach, großer Gott, so ’ne verfluchten Krankheiten kriegen doch nur die Pariser! Wo nehmen sie die nur her? Armer junger Mann! Es kann kein gutes Ende nehmen. Das Fieber, wissen Sie, das höhlt ihn aus, das schmeißt ihn um! Er hat keine Ahnung; er denkt gar nicht dran, Monsieur. Er merkt reinweg nichts. Na, nu flennen Sie mal nicht, Monsieur Jonathas! Das ist doch sicher, wenn er nichts mehr auszustehen hat, ist er glücklich. Spendieren Sie doch eine Andacht von neun Tagen für ihn! Ich habe schöne Heilungen dadurch gesehn, und ich tät selber ’ne Kerze zahlen, um so ’nen sanften Monsieur, so ’n friedliches Schaf zu retten.«
Raphaels Stimme war zu schwach geworden, um gehört zu werden: er mußte also dieses fürchterliche Geschwätz über sich ergehen lassen. Dann aber riß ihn die Ungeduld aus dem Bett. Er stand plötzlich an der Schwelle und rief Jonathas zu: »Alter Schurke, willst du unbedingt mein Henker sein?« Die Bäuerin glaubte ein Gespenst zu sehen und entfloh.
»Ich verbiete dir«, fuhr Raphael fort, »über meine Gesundheit irgend besorgt zu sein.«
»Ja, Monsieur le Marquis«, erwiderte der alte Diener und wischte sich die Tränen ab.
»Und du tätest sogar gut daran, von jetzt ab nicht ohne meinen ausdrücklichen Befehl hierherzukommen.«
Jonathas wollte gehorchen; aber bevor er ging, warf er dem Marquis einen treuen, mitleidvollen Blick zu. Raphael las sein Todesurteil darin. Mit einem Schlag wurde ihm seine wahre Lage bewußt; entmutigt setzte er sich auf die Schwelle, kreuzte die Arme über der Brust und ließ den Kopf hängen. Jonathas näherte sich erschreckt seinem Herrn.
»Monsieur?«
»Geh! geh fort!« schrie der Kranke.
Am Morgen des nächsten Tages war Raphael auf die Felsen geklettert und hatte sich in eine mit Moos gepolsterte Senke gesetzt, von wo aus er den schmalen Weg sehen konnte, auf dem man vom Bade aus zu seiner Behausung gelangte. Am Fuße des Felsens sah er Jonathas, der schon wieder mit der Auvergnatin sprach. Eine boshafte Macht ließ ihn das Achselzucken, die verzweifelten Gebärden, die erschreckende Einfalt dieser Frau verstehen und trug ihm durch den Wind und die Stille sogar ihre unseligen Worte zu. Von Entsetzen erfaßt, floh er auf die höchsten Gipfel der Berge und blieb dort bis zum Abend, ohne die düsteren Gedanken vertreiben zu können, die verhängnisvoll durch die grausame Teilnahme, deren Gegenstand er geworden, in seinem Herzen erwacht waren. Mit einem Mal stand die Auvergnatin selber vor ihm wie ein Schatten im abendlichen Dämmer; mit der wunderlichen Phantasie des Dichters wollten ihm die schwarzen und weißen Streifen ihres Rockes wie die dürren Rippen eines Gespenstes anmuten.
»Lieber Monsieur, jetzt kommt der Abendtau. Wenn Sie hier oben bleiben, geht es Ihnen wie der faulen Birne, die in den Dreck fiel. Kommen Sie mal nach Hause! Das ist nicht gesund, den Tau einzuatmen. Und dabei haben Sie seit dem Morgen noch nichts gegessen.«
»Zum Donnerwetter!« schrie er, »alte Hexe, laßt mich gefälligst leben, wie ich Lust habe, oder ich gehe von hier fort! Es ist gerade genug, daß Ihr mir jeden Morgen das Grab schaufelt, laßt mich wenigstens abends zufrieden!«
»Ihr Grab, lieber Monsieur! Ich sollte Ihr Grab schaufeln? I wo denn, wo ist denn Ihr Grab? Ich wollt, Sie würden so alt wie unser Vater! Wozu denn ins Grab? Wir kommen früh genug hinein.«
»Genug!« unterbrach Raphael sie.
»Nehmen Sie meinen Arm, Monsieur …«
»Nein.«
Nichts erträgt der Mensch so schwer wie das Mitleid, besonders wenn er es verdient. Der Haß ist ein Stärkungsmittel, er ruft zum Leben, zur Rache; aber das Mitleid tötet, es schwächt noch unsere Schwäche. Es ist das Übel, das sich nun schöntuerisch gibt, es ist die Verachtung, die sich in Fürsorge kleidet, es ist die Fürsorge, die wir als Kränkung empfinden. Raphael fand in dem Hundertjährigen ein triumphierendes, in dem Kinde ein neugieriges, in der Frau ein quälsüchtiges, in dem Mann ein eigennütziges Mitleid; aber in welcher Form es sich auch zeigte, es trug immer den Tod in sich. Ein Dichter macht aus allem ein Gedicht, mag es nun, je nach den Bildern, die ihn bewegen, ein schreckliches oder ein heiteres sein; seine erregte Seele verwirft die zarten Schattierungen und wählt stets die grellen und satten Farben. Dieses Mitleid zeugte in Raphaels Herzen ein grauenerregendes Gedicht der Trauer und Verdüsterung. Er hatte, als er der Natur nahe zu sein wünschte, wahrscheinlich nicht daran gedacht, wie unverhohlen sich natürliche Gefühle zeigen. Wenn er allein unter einem Baum zu sein glaubte und mit einem furchtbaren Hustenanfall rang, den er nie bezwang, ohne aus diesem gräßlichen Kampf völlig zerschlagen hervorzugehen, sah er die hellen glänzenden Augen des kleinen Jungen auf sich gerichtet, der wie ein Wilder im Grase auf Posten lag und ihn mit jener kindlichen Neugier belauerte, in der ebensoviel Spott wie Vergnügen und ein seltsames, gefühlloses Interesse lag. Ständig schien in den Augen der Bauern, bei denen Raphael lebte, der schreckliche Gruß der Trappisten40 zu stehen: ›Bruder, gedenke des Todes‹. Er wußte nicht, was er mehr fürchtete, ihre einfältigen Worte oder ihr Schweigen; alles an ihnen störte ihn. Eines Morgens sah er zwei schwarzgekleidete Männer, die um ihn herumschlichen, ihn umwitterten und ihn verstohlen belauerten; freilich taten sie, als wären sie nur als Spaziergänger hierher gekommen, und stellten ihm gleichgültige Fragen, auf die er kurz angebunden antwortete. Er erkannte sie als den Arzt und den Geistlichen des Badeorts, die ohne Zweifel von Jonathas geschickt oder von seinen Wirtsleuten zu Rate gezogen oder gar vom Geruch des nahen Todes angelockt worden waren. Nun sah er sein eigenes Leichenbegräbnis voraus, hörte den Gesang der Priester, zählte die Kerzen und sah die Schönheiten dieser reichen Natur, in deren Schoß er das Leben gefunden zu haben glaubte, nur noch wie durch einen Trauerschleier hindurch. Alles, was ihm vor kurzem noch ein langes Leben verkündet hatte, prophezeite ihm jetzt ein nahes Ende. Am nächsten Tag reiste er nach Paris ab, nachdem er die Flut schwermütiger Worte und herzlich bedauernder Wünsche seiner Wirtsleute über sich ergehen lassen mußte.
Er reiste die ganze Nacht durch und erwachte in einem der lieblichsten Täler des Bourbonnais,41 dessen Landschaften wie die Nebelbilder eines Traums an ihm vorbeiflogen. Die Natur breitete sich mit grausamem Liebreiz vor seinen Augen aus. Bald entrollte der Allier bis in weite Fernen sein strahlendes Silberband; dann wieder zeigten, bescheiden in einer gelbschimmernden Felsschlucht versteckt, Weiler die Spitzen ihrer Kirchtürme; bald tauchten in einem kleinen Tal hinter eintönigen Weinbergen plötzlich Mühlen auf, und überall erschienen strahlende Schlösser, an Abhängen erbaute Dörfer oder mit mächtigen Pappeln gesäumte Landstraßen; und endlich leuchtete die Loire mit ihrer weiten Wasserfläche wie ein Diamant aus goldenem Sand hervor. Verführungen ohne Ende! Die Natur, rege und lebhaft wie ein Kind, quoll schier über von der feurigen Glut des Juni und zog die erloschenen Blicke des Kranken unvermeidlich auf sich. Er ließ die Vorhänge im Wagen herunter und schlief wieder ein. Gegen Abend, als der Wagen Cosne hinter sich gelassen hatte, wurde er von fröhlicher Musik geweckt; er war mitten in ein ländliches Fest hineingeraten. Die Poststation lag nahe dem Platz. Während die Postillione die Pferde wechselten, sah er den Tänzen dieses heitren Völkchens zu, er sah hübsche, tändelnde Mädchen mit Blumen geschmückt, ausgelassene junge Männer und schließlich die runden weingeröteten Gesichter der angeheiterten alten Bauern. Kleine Kinder tollten übermütig umher, alte Frauen plauderten vergnügt; alles war einträchtig, und die Freude verschönte sogar die Kleider und die Tische, die man aufgestellt hatte. Der Platz und die Kirche boten ein Bild des Glücks; selbst die Dächer, die Fenster, die Türen des Dorfes schienen sich sonntäglich herausgeputzt zu haben. Gleich Sterbenden, denen das geringste Geräusch lästig ist, konnte Raphael weder einen Fluch noch den Wunsch unterdrücken, die Geigen möchten schweigen, all diese freudige Bewegung sich auflösen, der Lärm verstummen und dieses unverschämte Fest in alle Winde stieben. Verdrossen stieg er wieder in den Wagen. Als er noch einmal nach dem Platz zurücksah; gewahrte er, wie alle Freude verscheucht, die Bäuerinnen auf der Flucht und die Bänke verlassen waren. Auf dem Gerüst des Orchesters saß nur noch ein blinder Spielmann und entlockte seiner Klarinette ein schrilles Rondo. Diese Musik ohne Tänzer, dieser einsame Greis mit dem brummigen Gesicht, in Lumpen gehüllt, mir wirrem Haar, im Schatten einer Linde, das alles war wie ein grausiges Abbild des Wunsches, den Raphael geäußert hatte. In Strömen ging einer jener Wolkenbrüche nieder, der sich aus den Gewitterwolken im Juni häufig ebenso plötzlich ergießt, wie er aufhört. Das war etwas so Natürliches, daß Raphael, der ein paar weißliche Wolken am Himmel sah, die ein leichter Wind davontrieb, gar nicht daran dachte, sein Chagrinleder anzusehen. Er legte sich in die Ecke seines Wagens zurück, der bald auf der Straße weiterrollte.
Am nächsten Tage war er wieder zu Hause, in seinem Zimmer, an seinem Kamin. Er hatte sich ein großes Feuer machen lassen; es fror ihn. Jonathas brachte ihm Briefe. Sie waren alle von Pauline. Er öffnete den ersten ohne Eile und entfaltete ihn so gleichgültig, als handelte es sich um den grauen Bogen einer Zahlungsaufforderung, die sein Steuereinnehmer geschickt hatte. Er las den ersten Satz: »Abgereist! Aber das ist eine Flucht, liebster Raphael. Wie! niemand kann mir sagen, wo Du bist? Und wenn ich es nicht weiß, wer soll es dann wissen?« Mehr daraus zu erfahren, hatte er keine Lust; ungerührt nahm er die Briefe und warf sie ins Feuer. Mit stumpfem, unbeteiligten Blick sah er dem Spiel der Flammen zu, in denen das duftende Papier sich krümmte, zusammenschrumpfte, sich drehte und zerfiel.
Einige Papierfetzen flogen auf die Asche und ließen ihn Anfänge von Sätzen, einzelne Worte, halbverbrannte Gedanken erkennen, und er vergnügte sich ganz unbewußt damit, sie in den Flammen zu entziffern.
»An Deiner Tür gesessen … gewartet … Laune … ich gehorche … Nebenbuhlerinnen … ich nicht! … Deine Pauline … liebt … keine Pauline mehr? … Wenn Du mich hättest verstoßen wollen, hättest Du mich nicht verlassen … Ewige Liebe … Sterben …«
Diese Worte erregten in ihm eine Art Reue; er griff nach der Zange und rettete den letzten Fetzen eines Briefes aus den Flammen.
»… Ich habe gemurrt«, schrieb Pauline, »aber ich habe mich nicht beklagt, Raphael! Als Du mich von Dir entfernt hieltest, wolltest Du mir gewiß die Last eines Kummers ersparen. Vielleicht wirst Du mich eines Tages töten, aber Du bist zu gut, um mich leiden zu lassen. Oh, reise nie wieder so fort! Ich vermag den größten Qualen zu trotzen, aber nur, wenn ich bei Dir bin. Der Kummer, den Du mir antun könntest, wäre dann kein Kummer mehr; in meinem Herzen lebt eine viel größere Liebe, als ich Dir sie zeigen konnte. Ich kann alles ertragen, nur nicht, fern von Dir zu weinen und nicht zu wissen, was Du …«
Raphael legte dieses geschwärzte Bruchstück eines Briefes auf den Kamin; dann warf er es plötzlich in das Feuer zurück. Dieses Stück Papier war ein zu lebhaftes Bild seiner Liebe und seines unseligen Lebens.
»Hole Monsieur Bianchon!« befahl er Jonathas.
Als Horace kam, fand er Raphael im Bett.
»Lieber Freund, kannst du mir einen leicht opiumhaltigen Trank brauen, der mich in einem dauernden Halbschlaf hält, ohne daß der dauernde Gebrauch dieses Getränkes mir schadet?«
»Nichts leichter als das«, erwiderte der junge Arzt; »du müßtest jedoch schon ein paar Stunden am Tag wach sein, um zu essen.«
»Ein paar Stunden?« unterbrach Raphael; »nein, nein! Ich will höchstens eine Stunde auf sein.«
»Was hast du denn vor?« fragte Bianchon.
»Schlafen! Schlafen heißt doch leben!« antwortete der Kranke.
»Laß niemanden herein, wäre es auch Mademoiselle Pauline de Vitschnau!« wies er Jonathas an, während der Arzt sein Rezept schrieb.
»Ist noch eine Hoffnung, Monsieur Horace?« fragte der alte Diener den jungen Arzt, den er bis zur Freitreppe begleitet hatte.
»Es kann noch lange dauern, aber auch heute abend schon zu Ende sein. Bei ihm sind die Aussichten für Leben und Tod gleich. Ich verstehe den Fall nicht«, versetzte der Arzt und machte eine zweifelnde Gebärde. »Man muß ihn zerstreuen.«
»Ihn zerstreuen! Monsieur, Sie kennen ihn nicht. Er hat jüngst einen Menschen erschossen und hat nicht einmal Uff gesagt! Ihn zerstreut nichts.«
Raphael blieb einige Tage in das Nichts seines künstlichen Schlafes versenkt. Dank der Macht, die das Opium auf unsere Seele, das Materielle auf das Immaterielle, ausübt, sank dieser Mann von so gewaltiger, tätiger Phantasie auf die Stufe jener trägen Tiere, die in der Tiefe der Wälder in ihrem Bau aus Laubwerk hocken und keinen Schritt tun, um eine leichte Beute zu fassen.
Er hatte sogar das Licht des Himmels ausgelöscht; der Tag drang nicht mehr bis zu ihm herein. Gegen acht Uhr abends stand er auf; ohne sich seines Daseins klar bewußt zu sein, befriedigte er seinen Hunger und legte sich dann sofort wieder hin. Diese kalten, greisenhaften Stunden trugen ihm nur verschwommene Bilder, Erscheinungen, Schatten auf schwarzem Grund zu. Er hatte sich in tiefes Schweigen vergraben, in eine Verleugnung der Bewegung und des Denkens. Eines Abends erwachte er viel später als sonst und fand sein Essen nicht serviert. Er läutete Jonathas.
»Du kannst gehen«, sagte er zu ihm. »Ich habe dich reich gemacht, du wirst auf deine alten Tage glücklich sein; aber ich will dich nicht länger mit meinem Leben spielen lassen. Wie, du Elender! Ich spüre Hunger. Wo ist mein Essen? Antworte!«
Jonathas lächelte zufrieden, nahm eine Kerze, deren Flamme in der tiefen Dunkelheit der weitläufigen Räume des Hauses spukhaft flackerte, und führte seinen Herrn, der wieder zur bloßen Maschine geworden war, über einen langen Gang bis zu einer Tür, die er plötzlich öffnete. Raphael wurde von Licht überflutet; er war geblendet. Ein unerhörtes Schauspiel überraschte ihn. Seine Kronleuchter steckten voll brennender Kerzen, die seltensten Blumen seines Treibhauses waren harmonisch angeordnet, eine Tafel glänzte von Gold- und Silbergeschirr, Perlmutt und Porzellan; ein königliches Mahl dampfte darauf, dessen verlockende Gerichte den Gaumen reizten. Er sah seine Freunde versammelt und zwischen ihnen entzückende Frauen im schönsten Schmuck, mit tiefausgeschnittenen Kleidern, nackten Schultern, Blumen im Haar und funkelnden Augen; die verschiedenartigsten Schönheiten, verlockend in wollüstigen Verkleidungen: die eine brachte ihre reizenden Formen durch ein irisches Jäckchen zur Geltung, die andere trug die sinnverwirrende Basquina, den Reifrock der Andalusierinnen; diese erschien halbnackt als Diana, Göttin der Jagd, jene züchtig und lieblich als Mademoiselle de La Vallière,42 alle aber waren in gleicher Weise berauschend. Aus den Augen aller Gäste blickte Freude, Liebe, Lebenslust. Als Raphaels Totenantlitz sich in der Tür zeigte, brach jäher Beifallssturm los, der so hell aufbrandete wie die Strahlen dieses improvisierten Festes. Die Stimmen, der Duft, das Licht, die überwältigende Schönheit dieser Frauen erregten seine Sinne, erweckten sein Verlangen. Eine köstliche Musik aus einem benachbarten Salon übertönte mit einer Flut von Harmonien diesen berauschenden Tumult und machte die seltsame Vision vollständig. Raphael fühlte seine Hand von einer schmeichelnden Hand gedrückt, von der Hand einer Frau, deren frische weiße Arme sich nun hoben, um ihn an sich zu ziehen: Aquilina stand vor ihm. Nun begriff er, daß diese Szenerie nicht schattenhaftes Gaukelwerk war wie die flüchtigen Bilder seiner farblosen Träume; er stieß einen dumpfen Schrei aus, schloß hastig die Tür und schlug seinen alten Diener ins Gesicht.
»Ungeheuer!« tobte er, »du hast also geschworen, mich zu morden!« Dann fand er, obwohl er bei dem Gedanken an die Gefahr, der er ausgesetzt war, an allen Gliedern zitterte, die Kraft, sein Zimmer zu erreichen, trank eine starke Dosis seines Schlafmittels und legte sich zu Bett.
»Aber zum Teufel!« stöhnte Jonathas, als er sich wieder aufrichtete, »Monsieur Bianchon hatte mir doch ausdrücklich aufgetragen, ich sollte ihn zerstreuen.«
Es war gegen Mitternacht. Um diese Stunde strahlte Raphael – dank einer der Launen der Physiologie, die das Staunen und die Verzweiflung der medizinischen Wissenschaften sind – in seinem Schlaf vor Schönheit. Ein lebhaftes Rot färbte seine bleichen Wangen. Auf seiner Stirn, die liebreizend war wie die eines jungen Mädchens, lag das Siegel des Geistes. Das stille, gelöste Antlitz schien wie blühendes Leben. Er glich einem Kind, das unter der Obhut der Mutter eingeschlafen ist. Sein Schlaf war gut, aus seinem roten Mund strömte ein gleichmäßiger reiner Atem, er lächelte; gewiß hatte ihn ein Traum in ein schönes Leben versetzt. Vielleicht war er hundert Jahre alt, vielleicht wünschten ihm seine Enkelkinder ein langes Leben; vielleicht saß er auf seiner ländlichen Bank in der Sonne unter dem Blätterdach und schaute wie der Prophet auf dem Bergesgipfel das Gelobte Land in verheißungsvoller Ferne.
»Da bist du also!«
Diese Worte, mit silberheller Stimme gesprochen, verscheuchten die verschwommenen Gestalten seines Schlafes. Beim Schimmer der Lampe sah er Pauline auf seinem Bette sitzen, aber eine Pauline, die durch die Trennung und durch den Schmerz noch schöner geworden war. Raphael war betroffen beim Anblick dieses Gesichtes, das weiß war wie die Blumenblätter einer Seerose und das, von den langen schwarzen Haaren umflossen, im Dunkel des Zimmers noch bleicher schien. Tränen hatten ihre glitzernde Spur über ihre Wangen gezogen und hingen dort, bereit, bei der geringsten Bewegung herabzutropfen. Weiß gekleidet, den Kopf geneigt und das Bett kaum berührend, saß sie da, und so schien sie ein Engel zu sein, der vom Himmel herabgekommen war, eine Erscheinung, die ein Hauch verwehen konnte.
»Ah, ich habe alles vergessen!« rief sie in dem Augenblick, wo Raphael die Augen aufschlug. »Ich habe nur eine Stimme, um dir zu sagen: Ich bin dein! Ja, mein Herz ist nur Liebe. Ach, Engel meines Lebens, niemals warst du so schön. Wie deine Augen blitzen! Ach geh, ich ahne alles. Du hast deine Gesundheit gesucht, ohne mich, du hast mich gefürchtet … Nun …«
»Flieh! Flieh! Laß mich allein!« sprach Raphael endlich mit dumpfer Stimme. »So geh doch! Wenn du bleibst, sterbe ich. Willst du mich sterben sehen?«
»Sterben!« wiederholte sie. »Kannst du ohne mich sterben? Sterben, wo du so jung bist? Sterben, wo ich dich liebe? Sterben!« wiederholte sie immer wieder mit tiefer Stimme und griff wie rasend nach seinen Händen.
»Kalt!« sagte sie. »Träume ich?«
Raphael zog das Stückchen des Chagrinleders unter dem Kopfkissen hervor, das jetzt dünn und klein war wie das Blättchen des Immergrün, und zeigte es ihr. »Pauline, schönes Bild meines schönen Lebens, sagen wir uns Lebewohl!«
»Lebewohl?« wiederholte sie in tiefem Staunen.
»Ja. Das ist ein Talisman, der meine Wünsche erfüllt und mein Leben vorstellt. Sieh, was mir noch bleibt. Wenn du mich noch länger ansiehst, sterbe ich …«
Das junge Mädchen glaubte, Valentin sei wahnsinnig geworden, sie nahm den Talisman und holte die Lampe. In dem schwankenden Lichte, das Raphael und den Talisman in gleicher Weise aus dem Dunkel heraushob, sah sie gespannt auf das Gesicht ihres Geliebten und auf das letzte Stückchen des magischen Leders. Als er Pauline so sah, wie Angst und Liebe sie verschönte, war er nicht mehr Herr seiner Gedanken: die Erinnerung an die zärtlichen Stunden und die berauschenden Wonnen seiner Leidenschaft quoll übermächtig in seiner seit langem schlafenden Seele empor und loderte auf, gleich einem unzureichend gelöschten Brand.
»Pauline, komm! Pauline!«
Ein furchtbarer Schrei entrang sich dem jungen Mädchen; ihre Augen weiteten sich, ihre Augenbrauen, in unerhörtem Schmerz heftig zusammengezogen, teilten sich vor Grauen, sie las in Raphaels Augen ein rasendes Begehren, wie es einstmals ihr Stolz gewesen war; aber je größer dieses Verlangen wurde, um so mehr schrumpfte das Stückchen Leder kitzelnd in ihrer Hand. Außer sich, stürzte sie in das Nebenzimmer und schloß die Tür hinter sich.
»Pauline! Pauline!« rief der Sterbende und eilte ihr nach, »ich liebe dich, ich bete dich an, ich begehre dich! Ich verfluche dich, wenn du nicht öffnest. Laß mich bei dir sterben!«
Mit einer sonderbaren Kraft, dem letzten Ausbruch des Lebens, stieß er die Tür auf und sah, wie sich seine Geliebte halbnackt auf dem Sofa wand. Pauline hatte vergebens versucht, sich die Brust zu zerfleischen; und um sich einen schnellen Tod zu geben, wollte sie sich mit ihrem Schal erdrosseln. »Wenn ich sterbe, wird er leben!« rief sie und versuchte umsonst die Schlinge, die sie gemacht hatte, festzuziehen. Ihre Haare waren gelöst, ihre Schultern entblößt, ihre Kleider in Unordnung, und in diesem Ringen um den Tod, die Augen tränenüberströmt, das Antlitz flammend, in dieser fürchterlichen Verzweiflung enthüllte sie dem liebestrunkenen Raphael tausend Schönheiten, die seinen rasenden Taumel noch steigerten. Behend wie ein Raubvogel stürzte er sich auf sie, zerriß den Schal und wollte sie umfangen.
Der Sterbende suchte nach Worten, um das Verlangen auszudrücken, das all seine Kräfte verzehrte; aber nur ersticktes Röcheln entrang sich seiner Brust, immer tiefer bohrte sich jeder Atemzug in seinen Körper und schien schließlich aus den Eingeweiden aufzusteigen. Als er zuletzt fast keinen Ton mehr hervorbrachte, grub er seine Zähne in Paulines Busen. Entsetzt von den Schreien, die er vernahm, kam Jonathas herbeigeeilt und versuchte dem jungen Mädchen den Leichnam zu entreißen, auf dem sie in einem Winkel des Gemachs kauerte.
»Was wollen Sie?« sagte sie; »er gehört mir, ich habe ihn getötet. Hatte ich es nicht vorhergesagt?«
1 Rollin, Charles (1661-1741): französischer Altertumsforscher und Schriftsteller, Rektor der Pariser Universität <<<
2 carus alumnus: lat., teurer Zögling <<<
3 bei den Italienern: Gemeint ist das ›Théâtre-Italien‹, das, 1804 neugegründet, italienische Opern mit italienischen Sängern aufführte und in den letzten Jahren der Restauration seine Glanzzeit hatte <<<
4 Nargileh: orientalische Wasserpfeife. Der Rauch wird in einem Schlauch durch einen Wasserbehälter geleitet und gekühlt <<<
5 … vom strategischen Fehler seiner Feinde erfährt: 1815 rückten die preußischen Truppen unter Marschall Blücher, den englischen Verbündeten um zwei Tagesmärsche voraus, auf Paris zu <<<
6 Origenes (um 185 - um 254): griechischer Theologe, Begründer der christlichen Gnostik und Bibelauslegung <<<
7 Manfred, Childe Harold: Gestalten aus dem Versdrama ›Manfred‹ (1817) von Lord Byron (1788-1824) <<<
8 exegi monumentum: lat., Ich habe ein Denkmal errichtet (Horaz, Carmen III, 30) <<<
9 Ronsard, Pierre de (1524-1585): französischer Lyriker, Haupt der Pléiade, der bedeutendsten Dichterschule der französischen Renaissance <<<
10 Massillon, Jean-Baptiste (1663-1742): französischer Kanzelredner <<<
11 Racine, Jean-Baptiste (1639-1699): französischer klassischer Dramatiker <<<
12 Théâtre Favart: die 1781-1783 entstandene Opéra Comique, die 1838 durch einen Brand vernichtet wurde <<<
13 ›Semiramis‹: 1823 uraufgeführte Oper von Rossini <<<
14 Laudanum: Opiumtinktur <<<
15 … die jesuitischen Weglassungen der Äbtissin: Anspielung auf eine Episode aus Sternes Roman ›Tristram Shandy‹, in der die Äbtissin die Todsünde zu mildern sucht, indem sie die Flüche nur zur Hälfte ausspricht. <<<
16 Westall, Richard (1765-1836): englischer Zeichner und Aquarellist, Illustrator der Werke von Shakespeare und Milton <<<
17 Menetekel: Mene Tekel Upharsin; die im Buch Daniel von Geisterhand an die Wand geschriebenen Flammenworte, die dem König Belsazar seinen nahen Sturz verkündeten <<<
18 Salpêtrière, Hospice de la: 1656 gegründetes ehemaliges Pariser Armenhaus für alte Frauen mit einer Heilstätte für Geisteskranke <<<
19 Buffon, Georges-Louis Leclerc, Comte de (1707-1788): französischer Naturforscher und Schriftsteller <<<
20 Galuchat: musivartiges Chagrin aus der Haut des Hundshais oder Rochens, nach seinem Erfinder Galluchat genannt <<<
21 der Vater des gewissenhaften Dr. Niebuhr: Karsten Niebuhr (1733-1815) unternahm von 1761 bis 1767 im Auftrag der dänischen Regierung eine Forschungsreise in den Orient. Seine Reisebeschreibungen galten lange Zeit als Grundlagenwerk. Das Hauptwerk seines Sohnes Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), Staatsmann und Historiker, ist eine 1811 erschienene ›Römische Geschichte‹ <<<
22 7000 Feldmesserschritte entsprechen 11,340 km <<<
23 Pallas, Peter Simon (1741-1811): deutscher Naturforscher; unternahm im Dienst der Kaiserin Katharina II. Expeditionen in den östlichen und südlichen Teil des russischen Reiches. Seine Werke enthalten seine umfassenden wissenschaftlichen Beobachtungen <<<
24 Dom Calmet, Augustin (1672-1757): Lothringischer Gelehrter des Benediktinerordens, Verfasser eines Bibellexikons, von Bibelkommentaren und kirchenhistorischen Werken sowie einer Geschichte Lothringens <<<
25 Lalande, Joseph-Jérôme Lefrançois de (1732-1807): französischer Astronom. Seine ›Bibliographie astronomique‹ (1804) umfaßt das astronomische Wissen seiner Zeit <<<
26 Pascal, Blaise (1623-1662): französischer Schriftsteller, Philosoph, Mathematiker und Physiker. Als Parteigänger der Jansenisten veröffentlichte er 1656/57 seine berühmte Streitschrift gegen die Jesuiten <<<
27 Rue de la Santé: Straße der Gesundheit <<<
28 Organizisten: Vertreter einer medizinischen Doktrin, die jede Krankheit auf ein geschädigtes Organ zurückführt <<<
29 Cabanis, Georges (1757-1808): französischer Arzt u. Philosoph <<<
30 Vitalisten: Anhänger des Vitalismus, einer idealistischen philosophischen Lehre, die davon ausgeht, daß in den lebenden Organismen eine übernatürliche, nicht materielle ›Lebenskraft‹ wirke <<<
31 van Helmont, Johann Baptist (1577-1644): niederländischer Arzt, Chemiker und Philosoph, der die chemischen Prozesse im Organismus als Wesentlichstes betrachtete <<<
32 Dupuytren, Guillaume (1777-1835): französischer Chirurg <<<
33 Prinzen von Hohenlohe: Alexander Leopold, Prinz von Hohenlohe-Waldenburg (1794-1849), wurde bekannt durch seine ›Wunderkuren‹, die er im Glauben an die Macht seines Gebetes durchführte <<<
34 Cantal: höchster Gipfel in der Auvergne <<<
35 Methode, die den Selbstheilungsprozeß der Natur beobachtet und unterstützt. <<<
36 Whist: aus England stammendes Kartenspiel mit 52 Blättern und meist vier Spielern <<<
37 Tricktrack: beliebtes Brettspiel zwischen zwei Personen, das mit zwei Würfeln und je fünfzehn weißen und schwarzen Steinen gespielt wurde <<<
38 Maurienne: Alpenregion in Savoyen <<<
39 Schnet, Jean-Victor (1787-1870): französischer Maler, 1840-1858 Direktor der französischen Akademie in Rom. <<<
40 Trappisten: reformierte Zisterzienser mit einem strengen Schweigegelübde, von dem nur der tägliche Gruß ›memento mori‹ (Gedenke des Todes) ausgenommen war. <<<
41 Bourbonnais: Gebiet im Norden des Massif central <<<
42 La Vallière, Louise de la Baume le Blanc, Duchesse de (1644-1710): Mätresse Ludwigs XIV. <<<