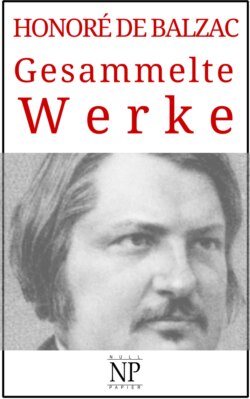Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Talisman
ОглавлениеGegen Ende Oktober 1829 trat ein junger Mann in das Palais-Royal,1 als die Spielhäuser, wie es das Gesetz vorschreibt, das eine hohen Steuern unterliegende Leidenschaft schützt, gerade öffneten. Ohne lange zu zögern, stieg er die Treppe zum Spielsaal hinauf, der die Nummer 36 trug.
»Ihren Hut bitte, Monsieur!« rief ihm mit trockener, mürrischer Stimme ein kleiner, alter Mann zu, der zusammengeduckt hinter einem Verschlag im Halbdunkel saß und, als er sich unvermittelt erhob, ein fahles, abstoßendes Gesicht zeigte.
Betritt man ein Spielhaus, dann nimmt einem das Gesetz zuerst einmal den Hut. Ist das ein symbolisches Vorzeichen, ein Akt der Vorsehung? Oder ist es nicht vielmehr eine Art Teufelspakt, der einen Pfand abfordert? Will man den Spieler vielleicht auf diese Weise nötigen, Ehrerbietung denjenigen gegenüber zu wahren, die ihm sein Geld abknöpfen wollen? Oder hat die Polizei, die ihre Nase in jeden schmutzigen Winkel der Gesellschaft steckt, gar ein Interesse daran, den Namen seines Hutmachers oder seinen eigenen zu erfahren, falls er ihn in sein Hutfutter geschrieben hat? Oder ob man etwa dem Schädel Maß nehmen will, um eine lehrreiche Statistik über die Größe der Spielerhirne aufzustellen? Über diesen Punkt hüllt sich die Verwaltung in tiefstes Schweigen. Aber eines muß der Spieler wissen: Sowie er den ersten Schritt zum grünen Tisch getan hat, gehört ihm sein Hut ebensowenig, als er sich selber gehört. Er ist dem Spiel verfallen, er, seine Habe, sein Hut, sein Stock und sein Mantel. Verläßt er schließlich den Saal, demonstriert das Spielhaus wie mit einem Zeichen beißenden Hohnes, daß es ihm wenigstens etwas läßt: den Hut. Sollte er jedoch einen neuen Hut besitzen, wird er aus seinem Schaden lernen, daß es ratsam ist, sich eine spezielle Kleidung fürs Spiel zuzulegen.
Das Erstaunen des jungen Mannes, als er für seinen Hut, dessen Ränder zum Glück schon leicht abgegriffen waren, eine numerierte Marke erhielt, zeugte deutlich genug von einer noch unverdorbenen Seele, daher sandte ihm auch der kleine Alte, den der Fieberrausch des Spielerlebens von Jugend an verzehrt zu haben schien, einen trüben teilnahmslosen Blick, aus dem ein Philosoph das Elend der Spitäler, das unstete Dasein der Gescheiterten, Protokolle unzähliger Selbstmorde, lebenslänglicher Zwangsarbeit oder Verbannungen an den Coatzacoalco2 hätte herauslesen können. Dieser Mann, dessen längliches weißes Gesicht nur noch von Darcets3 Gallertsuppen genährt schien, verkörperte das bleiche Bild der auf ihren einfachsten Ausdruck gebrachten Leidenschaft. In seinem runzeligen Gesicht hatten langjährige Qualen ihre Spuren hinterlassen; anscheinend verspielte er sein kärgliches Gehalt noch am Zahltag. Wie alte Schindmähren, die die Peitsche nicht mehr spüren, so vermochte ihn nichts mehr zu erschüttern. Das dumpfe Stöhnen der Spieler, die davongingen und alles verloren hatten, ihre stummen Flüche, ihre stumpfen Blicke machten auf ihn schon lange keinen Eindruck mehr. Er war das leibhaftig gewordene Spiel. Hätte der junge Mann diesen erbärmlichen Zerberus4 näher betrachtet, hätte er sich vielleicht gesagt: ›In diesem Herzen gibt es nur noch ein Kartenspiel!‹ Der Unbekannte indes achtete auf diese lebendige Warnung nicht, die zweifellos die Vorsehung vor jene Tür gestellt hatte, wie sie vor alle unheilvollen Stätten den Ekel setzt. Er trat entschlossen in den Saal, wo der Klang des Goldes auf die von Begehrlichkeit angestachelten Sinne eine magische Faszination ausübte. Wahrscheinlich wurde dieser junge Mann von dem logischsten aller bedeutsamen Sätze Jean-Jacques Rousseaus5 dort hingetrieben, dessen trauriger Sinn, wie ich glaube, folgendermaßen auszudrücken ist: ›Ja, ich begreife, daß ein Mann zum Spiel geht, aber nur dann, wenn er zwischen sich und dem Tode nichts als seinen letzten Taler sieht.‹
Am Abend atmen die Spielhäuser nur eine recht vulgäre Poesie, obgleich ihre Wirkung da unfehlbar ist wie die eines blutrünstigen Dramas. Die Säle sind voll von Schaulustigen und Spielern, von notleidenden Greisen, die sich hinschleppen, um sich aufzuwärmen, von erhitzten Gesichtern; Orgien, die im Wein begonnen und in der Seine enden werden. Wenn hier auch Leidenschaft im Übermaß vorhanden ist, so ist man wegen der allzu großen Anzahl der Akteure daran gehindert, den Dämon des Spiels von Angesicht zu Angesicht zu betrachten. Der Abend gleicht einem wahren Ensemblestück, wo die ganze Truppe grölt und jedes Instrument einen anderen Part spielt. Man kann da manch ehrbare Leute antreffen, die der Zerstreuung wegen kommen und dafür zahlen wie fürs Theater, für Tafelfreuden oder den Besuch in einer Dachstube, wo sie wohlfeil drei Monate schmerzhafte Reue einhandeln. Aber begreift man die wahnwitzige Leidenschaft in der Seele eines Mannes, der ungeduldig das Öffnen eines Spielkasinos erwartet? Der Spieler, der morgens kommt, unterscheidet sich von dem am Abend wie der gleichgültige Ehemann von dem Liebhaber, der unter den Fenstern seiner Angebeteten schmachtet. Nur morgens kommt die zitternde Leidenschaft und die Not in ihrem unverhüllten Grauen. Um diese Zeit kann man den wahren Spieler bewundern, einen Spieler, der nichts gegessen, nicht geschlafen, nicht gelebt, über nichts nachgedacht hat, so furchtbar ist er von der Geißel seines Spielfiebers durchglüht worden, so sehr juckt es ihm in den Fingern nach einem Trente-et-Quarante.6 Zu dieser verhängnisvollen Stunde begegnet man Augen, deren Ruhe schaudern macht, Gesichtern, von denen man nicht loskommt, Blicken, die die Karten förmlich durchbohren und verschlingen. Großartig sind die Spielhäuser deshalb nur, wenn die Karten gegeben sind und die Kugeln zu rollen beginnen. Wie Spanien seine Stierkämpfe, Rom einst seine Gladiatoren gehabt hat, so ist Paris stolz auf sein Palais-Royal, dessen nervenzehrende Roulettes das Vergnügen verschaffen, zuzusehen, wie das Blut in Strömen fließt, ohne daß das Publikum Gefahr läuft, darin auszugleiten. Wollen Sie einen flüchtigen Blick in diese Arena werfen? Treten Sie ein! … Wie kahl alles ringsum ist! An diesen Wänden, die bis in Mannshöhe von einer fettigen Papiertapete bedeckt sind, kein einziges Bild, das die Seele erfreuen könnte. Nicht einmal ein Nagel ist da, der den Selbstmord erleichtern könnte. Das Parkett ist ausgetreten und schmutzig. Ein länglicher Tisch nimmt die Mitte des Raumes ein. Die gewöhnlichen Rohrstühle, die eng um das vom Gold abgewetzte Tuch herumstehen, künden von einer erstaunlichen Gleichgültigkeit gegen den Luxus bei Männern, die doch hierherkommen, sich um des Geldes und des Luxus willen zugrunde zu richten. Dieser Widerspruch im Menschen wird dort sichtbar, wo die Seele übermächtig auf sich selbst zurückwirkt. Der Liebende möchte seine Geliebte in Seide, in die schmeichelnden Gewebe des Orients hüllen und besitzt sie die meiste Zeit auf einem armseligen Lager. Der Ehrgeizige träumt sich auf dem Gipfel der Macht, während er sich im Schmutz knechtischer Unterwürfigkeit erniedrigt. Der Kaufmann vegetiert in den hinteren Räumen eines ungesunden feuchten Ladens, derweil er ein prächtiges Haus bauen läßt, aus dem sein Sohn und vorzeitiger Erbe späterhin durch eine vom Bruder angeordnete Zwangsversteigerung hinausgejagt wird. Gibt es schließlich etwas Freudloseres als ein Freudenhaus? Seltsames Problem! Wie der Mensch, immer im Widerspruch mit sich selbst, seine Hoffnungen durch die Mißhelligkeiten der Gegenwart trügt, über seine Mißhelligkeiten mit einer Zukunft hinwegtäuschen will, die ihm nicht gehört, und dadurch allen seinen Handlungen den Stempel der Inkonsequenz und der Schwäche aufdrückt! Das Unglück allein ist auf Erden vollkommen.
Als der junge Mann den Saal betrat, waren schon einige Spieler versammelt. Drei alte Kahlköpfe saßen in ungezwungener Haltung am grünen Tisch; ihre bleichen, maskenhaft starren Gesichter, teilnahmslose Diplomatenmienen, ließen erkennen, daß ihre Seelen abgestumpft waren und ihre Herzen seit langem verlernt hatten, schneller zu schlagen, selbst wenn der letzte Notpfennig der Frau auf dem Spiel stand. Ein junger schwarzhaariger Italiener mit olivfarbenem Teint saß reglos am Ende des Tisches, hatte die Ellbogen aufgestützt und schien jenen inneren Stimmen zu lauschen, die einem Spieler verhängnisvoll zuraunen: ›Ja! – Nein!‹ Der südländische Kopf atmete Gold und Feuer. Sieben oder acht Zuschauer standen im Kreise herum und harrten der Szenen, die ihnen die Fügungen des Schicksals, die Mimik der Spieler, die Bewegung des Geldes und der Rechen bereiten sollten. Diese Müßiggänger standen schweigsam, starr und gespannt da, wie das Volk auf der Place de Grève,7 wenn der Henker einen Kopf abschlägt. Ein großer, hagerer Mann in fadenscheinigem Rock hielt in der Hand ein Register und in der andern eine Nadel, mit der er den Wechsel von Rot und Schwarz registrierte. Das war einer von jenen, die am Rande aller Genüsse ihrer Zeit leben, ein moderner Tantalus,8 einer jener Geizhälse, die keinen roten Heller ihr eigen nennen und um einen imaginären Einsatz spielen; eine Art vernünftiger Narr, der einer Schimäre nachhängt, um über sein Elend hinwegzutrösten, der mit dem Laster und der Gefahr umgeht wie junge Priester mit dem Abendmahl, wenn sie weiße Messen lesen. Ein oder zwei jener geriebenen Spekulanten, die die Chancen des Spiels genau einschätzen und alten Sträflingen gleichen, welche die Galeere nicht mehr schreckt, hatten ihren Platz gegenüber der Bank gewählt, um drei Einsätze zu wagen und mit dem erhofften Gewinn, von dem sie ihr Leben bestritten, sofort zu verschwinden. Zwei alte Saaldiener schlenderten mit verschränkten Armen auf und ab und blickten von Zeit zu Zeit durch die Fenster in den Park, wie um den Vorübergehenden ihre nichtssagenden Gesichter als Aushängeschild zu zeigen. Der Croupier und der Bankhalter hatten eben jenen unbewegten Blick über die Spieler gleiten lassen, der ihnen den Atem nimmt, und grell ihr: »Faites le jeu!« gerufen, als der junge Mann die Tür öffnete. Irgendwie wurde die Stille noch tiefer, und alle Köpfe wandten sich neugierig dem Neuankömmling zu. Etwas Unerhörtes ging vor: Die stumpfen Greise, die versteinerten Angestellten, die Schaulustigen, sogar der fanatische Italiener, alle empfanden beim Anblick des Unbekannten ein Gefühl des Entsetzens. Muß man nicht sehr unglücklich sein, sehr hinfällig und unheimlich aussehen, um in diesem Saale, wo der Schmerz stumm sein muß, das Elend Fröhlichkeit heuchelt und die Verzweiflung den Anstand wahrt, Mitleid zu erregen, Teilnahme zu erwecken, einen Schauder hervorzurufen? Nun denn, in dem ungewohnten Gefühl, das jene eisigen Herzen bewegte, als der junge Mann eintrat, war von alledem etwas enthalten. Aber haben nicht auch Henker manchmal über die Jungfrauen geweint, deren blonde Köpfe auf einen Wink der Revolution fallen mußten?
Beim ersten Blick lasen die Spieler in dem Gesicht des Neulings ein schreckliches Geheimnis; die Anmut seiner jugendlichen Züge war umschattet, sein Blick zeugte von vergeblichen Anstrengungen und von tausend gescheiterten Hoffnungen. Der düstere Gleichmut des zum Tode Entschlossenen verlieh seiner Stirn eine matte, krankhafte Blässe; ein bitteres Lächeln zog leise Falten in seine Mundwinkel, und der Anblick der tiefen Hoffnungslosigkeit, die seine Züge ausdrückten, war kaum zu ertragen. Ein verborgenes Genie flackerte im tiefsten Inneren seiner umflorten Augen, die vielleicht von Vergnügungen ermattet waren. Hatte die Ausschweifung ihr schmutziges Siegel auf dieses edle, ehemals reine und leuchtende, jetzt entwürdigte Antlitz gedrückt? Die Ärzte hätten die gelben Ringe um die Augen und die Röte auf den Wangen zweifellos einer Krankheit der Lunge oder des Herzens zugeschrieben, während die Dichter Zeichen Kräfte verschleißenden geistigen Ringens, die Spuren nächtlichen Studiums beim kärglichen Schein einer Lampe darin gesehen hätten. Aber eine Leidenschaft, tödlicher als Krankheit, eine Krankheit erbarmungsloser als Studium und Genie, verheerte dieses junge Gesicht, verkrampfte diese beweglichen Muskeln, preßte dieses Herz zusammen, das Wollust, Studium und Krankheit nur leicht gestreift hatten. So wie im Bagno9 ein berühmter Verbrecher bei seiner Einlieferung von allen Sträflingen respektvoll empfangen wird, so grüßten diese menschlichen Dämonen, diese in allen Folterqualen Erfahrenen einen unerhörten Schmerz, eine tiefe Wunde, die ihr Blick zu ergründen suchte, und erkannten in ihm an der Majestät seiner stummen Verachtung, der eleganten Kläglichkeit seiner Kleidung einen ihrer Fürsten. Der junge Mann trug wohl einen Frack von guter Fasson, aber die Verbindung seiner Weste mit der Krawatte war zu kunstvoll hergestellt, als daß man darunter ein Hemd vermuten konnte. Seine Hände, hübsch wie die einer Frau, waren von zweifelhafter Sauberkeit; seit zwei Tagen hatte er keine Handschuhe mehr getragen. Wenn selbst den Croupier und die Saaldiener ein Schauder überflog, so weil über den feingeschnittenen Zügen, den natürlich gewellten dünnen, blonden Haaren noch ein Hauch von Unschuld lag. Dies Gesicht war noch fünfundzwanzig Jahre jung, und das Laster schien darauf nur ein Zufall zu sein. Die Lebenskraft der Jugend kämpfte darin noch an gegen die Verheerungen unterdrückter Begierden. Licht und Finsternis, Sein und Nichts stritten gegeneinander und zeugten Anmut und Grauen zugleich. Der junge Mann erschien in dieser Runde wie ein Engel ohne Strahlenschein, der vom rechten Wege abgekommen war. Und wie ein altes zahnloses Weib vom Mitleid ergriffen wird, wenn es sieht, wie sich ein schönes junges Mädchen dem Verderben preisgibt, so waren alle diese Würdenträger des Lasters und der Schande nahe daran, dem Neuling zuzurufen: »Flieh von hier!« Jener aber schritt geradewegs auf den Tisch zu, blieb stehen und warf auf gut Glück ein Goldstück, das er in der Hand hielt, auf den Tisch. Es rollte auf Schwarz; zugleich richtete er, wie starke Naturen, die die quälende Ungewißheit verabscheuen, einen ungestümen, wiewohl gefaßten Blick auf den Croupier. Das Interesse an diesem Einsatz war so groß, daß keiner der Alten setzte; aber der Italiener folgte mit der Besessenheit der Leidenschaft einem Gedanken, der ihm gerade gelächelt hatte, und setzte sein ganzes Gold gegen das Spiel des Unbekannten. Der Bankhalter vergaß seine stereotypen Wendungen zu rufen, die mit der Zeit heiser und unverständlich geworden sind: »Faites le jeu! – Le jeu est fait! – Rien ne va plus.« Er breitete die Karten aus und schien dem Zuletztgekommenen Glück zu wünschen, gleichgültig, ob den Veranstaltern dieses finstern Vergnügens Gewinn oder Verlust daraus entstünde. Jeder der Zuschauer wollte in dem Schicksal dieses Goldstücks ein Drama, die Schlußszene eines edlen Lebens sehen; ihre Augen, auf die verhängnisvollen Karten geheftet, funkelten; aber trotz der Aufmerksamkeit, mit der sie abwechselnd den jungen Mann und die Karten betrachteten, konnten sie auf seinem kalten und gefaßten Antlitz kein Zeichen der Erregung wahrnehmen.
»Rouge, pair, passe«, verkündete der Croupier im Amtston.
Eine Art dumpfen Röchelns entrang sich der Brust des Italieners, als er die gefalteten Geldscheine, die ihm der Bankhalter zuwarf, einen nach dem anderen vor sich niederfallen sah. Der junge Mann indes begriff seinen Ruin erst in dem Augenblick, als der Rechen seinen letzten Napoleon10 hinwegraffte. Das Elfenbein entlockte dem Goldstück, das rasch wie ein Pfeil auf den vor der Kasse angesammelten Goldhaufen zuflog, einen trockenen Ton. Der Unbekannte schloß sacht die Augen; seine Lippen wurden bleich; aber bald hob er die Lider, sein Mund gewann korallene Röte, er nahm die Miene eines Engländers an, für den das Leben keine Geheimnisse mehr birgt, und entfernte sich, ohne mit einem jener herzzerreißenden Blicke um Trost zu flehen, die verzweifelte Spieler häufig genug den Anwesenden zuwerfen. Wieviel passiert im Zeitraum einer Sekunde und wieviel hängt von einem Wurf des Würfels ab!
»Das war gewiß seine letzte Patrone«, sagte lächelnd der Croupier nach einem Augenblick des Schweigens, in welchem er dieses Goldstück zwischen Daumen und Zeigefinger hochgehalten hatte, um es den Anwesenden zu zeigen. »Der ist so überspannt, daß er sich ins Wasser stürzen wird«, sagte ein Gewohnheitsspieler mit einem Blick auf die andern, die einander alle kannten.
»Ach was!« rief der Saaldiener und nahm eine Prise Tabak.
»Hätten wir es nur gemacht wie der Monsieur dort!« sagte einer von den Greisen zu seinen Kollegen und deutete auf den Italiener.
Alle sahen auf den glücklichen Gewinner, dessen Hände beim Zählen der Banknoten zitterten.
»Ich habe eine Stimme gehört, die mir ins Ohr rief, das Spiel werde gegen die Verzweiflung dieses jungen Mannes recht behalten«, sagte er.
»Das war kein Spieler«, meinte der Bankhalter, »sonst hätte er sein Geld in drei Teile geteilt, um bessere Gewinnchancen zu haben.«
Der junge Mann wollte hinausgehen, ohne seinen Hut zu verlangen; aber der alte Wachhund hatte den armseligen Zustand dieser Kopfbedeckung bemerkt und reichte sie ihm wortlos hin. Der Spieler gab mit mechanischer Bewegung die Garderobenmarke zurück und stieg die Treppe hinunter, indem er ›Di tanti palpiti‹11 pfiff, aber so leise, daß er die reizende Melodie kaum selbst vernahm.
Er befand sich bald unter den Bogengängen des Palais-Royal, ging bis zur Rue Saint-Honoré, schlug dann den Weg zu den Tuilerien12 ein und durchquerte unschlüssig den Park. Er lief, als wäre er mitten in einer Wüste; Menschen stießen ihn, die er nicht sah, er hörte durch das Geschrei der Menge hindurch nur eine Stimme: die des Todes. Er war in ein lähmendes Nachdenken verloren, wie es einst jene dem Schafott Bestimmten befiel, die ein Karren vom Justizpalast zur Place de Grève führte, zu jenem Richtplatz, der getränkt ist von all dem Blut, das seit 179313 dort vergossen wurde.
Etwas Großes und Entsetzliches liegt im Selbstmord. Bei den meisten Menschen ist ein Sturz so ungefährlich wie bei Kindern, die zu niedrig fallen, um sich ernstlich zu verletzen; aber wenn ein großer Mann zerschmettert, muß er aus großer Höhe gefallen sein, muß er sich bis zu den Himmeln erhoben und ein unerreichbares Paradies erschaut haben. Unerbittlich müssen die Gewalten sein, die ihn treiben, von der Mündung einer Pistole Frieden für seine Seele zu erlangen. Wieviel junge Talente verzehren sich und gehen, in einer Mansarde eingesperrt, zugrunde, weil ihnen ein Freund fehlt, eine Frau, die sie tröstet, und das inmitten von Millionen von Wesen, angesichts einer am Gold übersättigten, von Langeweile gepeinigten Menge! Wenn man dies bedenkt, erscheint der Selbstmord ungeheuerlich. Gott allein weiß, wieviel Entwürfe, unvollendete Dichtungen, wieviel Verzweiflung und erstickte Schmerzensschreie, wieviel mißlungene Versuche und verworfene Meisterwerke zwischen dem freiwilligen Tode und der keimenden Hoffnung liegen, deren Stimme den jungen Mann einst nach Paris gelockt hat. Jeder Selbstmord ist ein Poem von erhabener Melancholie. Wo fände man im Ozean der Literaturen ein die Zeiten überdauerndes Buch, das sich an Poesie mit dieser Zeitungsnotiz messen könnte: ›Gestern um vier Uhr stürzte sich eine junge Frau vom Pont-des-Arts in die Seine.‹
Vor diesem Pariser Lakonismus verblassen alle Dramen und Romane, selbst jenes alte Titelblatt: ›Die Klagen des ruhmreichen Königs von Kaërnavan, den seine Kinder in den Kerker warfen‹; der einzige Überrest eines verlorengegangenen Buches, das den harten Sterne, der doch selbst Frau und Kinder verlassen hatte, zum Weinen brachte.
Tausend ähnliche Gedanken stürmten auf den Unbekannten ein, jagten bruchstückhaft an seinem inneren Auge vorüber, zerfetzten Fahnen gleich, die mitten im Schlachtgetümmel aufflattern. Warf er einen kurzen Augenblick lang die Last seiner Gedanken und Erinnerungen ab, um vor einigen Blumen still zu stehen, deren Blüten sich auf der weiten Rasenfläche sacht im Wind wiegten, durchzuckte ihn dann das Leben, das sich noch bäumte unter dem lastenden Todesgedanken, hob er die Augen zum Himmel: doch dort rieten ihm die grauen Wolken, die trauerbeladenen Windstöße, die niederdrückende Atmosphäre zu sterben. Er nahm den Weg zum Pont Royal und sann über die letzten seltsamen Einfälle seiner Vorgänger nach. Er mußte lächeln, als ihm einfiel, daß Lord Castlereagh14 erst das bescheidenste menschliche Bedürfnis befriedigt hatte, bevor er sich die Kehle durchschnitt, und daß Auger,15 Mitglied der Akademie, seine Tabaksdose geholt hatte, um auf dem Weg zum Tode schnupfen zu können. Er durchdachte diese Absonderlichkeiten und befragte sich daraufhin selbst, wobei er sich dabei ertappte, wie er sorgsam den weißen Staub abschüttelte, mit dem ein Lastträger der Hallen, welchem er, dicht an das Brückengeländer gepreßt, ausgewichen war, seinen Rockärmel beschmutzt hatte. Als er auf dem höchsten Punkt der Brückenwölbung angelangt war, starrte er trübsinnig ins Wasser.
»Schlechtes Wetter, sich zu ertränken!« rief ihm ein altes, zerlumptes Weib lachend zu. »Die Seine ist kalt und schmutzig!«
Er antwortete mit einem knabenhaften Lächeln, das den ganzen Wahnwitz seines Entschlusses bewies; aber plötzlich schauderte er, als er in der Ferne am Hafen der Tuilerien über einer Baracke in fußhohen Lettern die Aufschrift erblickte: ›Rettungsstation‹. Monsieur Dacheux16 erschien ihm im Rüstzeug seiner Philanthropie, wie er jene tugendhaften Ruderstangen in Bewegung setzte, die den Ertrinkenden die Schädeldecke einschlagen, wenn sie unglückseligerweise noch einmal an die Wasseroberfläche gelangen. Er sah ihn die neugierigen Gaffer herbeilocken, einen Arzt auftreiben, Tabakrauch bereithalten;17 er las die Todesmeldungen der Journalisten, die sie zwischen der Ausgelassenheit eines Gelages und dem Lächeln einer Tänzerin niedergeschrieben hatten, hörte die Taler klingen, die der Polizeipräfekt den Bootsführern für seinen Kopf auszahlte. Tot war er 50 Francs wert, lebend war er nichts weiter als ein talentvoller junger Mann ohne Protektion, ohne Freunde, ohne Strohsack als Lager, ohne Bedeutung, eine wahre soziale Null, ohne Nutzen für den Staat, der sich um ihn nicht scherte. Ein Tod am hellichten Tag erschien ihm würdelos, er beschloß in der Nacht zu sterben, um dieser Gesellschaft, die die Größe seines Lebens nicht zu schätzen wußte, einen unkenntlichen Leichnam zu hinterlassen. Er setzte also seinen Weg fort und wandte sich, schlendernd wie ein Müßiggänger, der die Zeit totschlagen will, zum Quai Voltaire. Als er die Stufen, in die die Brücke ausläuft, hinabstieg, wurde seine Aufmerksamkeit an der Ecke des Quais von alten Büchern angezogen, die auf der Brüstung ausgebreitet waren; es hätte nicht viel gefehlt, und er hätte einige davon erhandelt. Er mußte wieder lächeln, steckte die Hände philosophierend in die Hosentaschen und nahm wieder die unbekümmerte, von kalter Verachtung durchdrungene Haltung an, als er zu seiner Überraschung in seiner Tasche einige Geldstücke auf eine wahrhaft phantastische Art klingen hörte. Ein Hoffnungsschimmer erhellte sein Gesicht, glitt von den Lippen über Wangen und Stirn und ließ seine Augen vor Freude strahlen. Doch dieser Funke Glück glich dem Aufglimmen eines Stück Papiers, das die Flamme bereits verzehrt hat; und so wie dieser in schwarzer Asche verlischt, verdüsterte sich das Antlitz des Unbekannten wieder, als er die Hand hastig aus der Tasche zog und drei große Sous erblickte.
»Ach, lieber Monsieur, la carità! La carità! Catarina! Nur einen kleinen Sou für Brot!«
Ein kleiner Schornsteinfeger mit aufgedunsenem schwarzen Gesicht, rußigbraunem Körper und zerlumpten Kleidern, streckte die Hand aus, um ihm das letzte Geld abzubetteln.
Zwei Schritte von dem kleinen Savoyarden entfernt, stand ein armer, demütiger Alter, hinfällig, bedürftig und elend, in eine zerschlissene Tapisserie gehüllt, der ihn mit dumpfer eindringlicher Stimme bat: »Monsieur, geben Sie mir, was Sie wollen, ich werde für Sie beten …« Aber als der junge Mann den Alten angeblickt hatte, verstummte dieser und verlangte nichts mehr. Es mochte ihm aus diesem düstern Gesicht wohl eine noch härtere Not als die seine entgegenstarren.
»La carità! La carità!«
Der Unbekannte warf dem Knaben und dem armen Alten sein Geld hin, verließ den Uferweg und ging zu den Häusern hinüber, da ihm der quälende Anblick der Seine unerträglich geworden war.
»Wir werden Gott um die Erhaltung Ihrer Tage bitten«, riefen ihm die beiden Bettler nach.
An der Auslage eines Kunsthändlers sah der junge Mann, der den Lebenden schon fast nicht mehr angehörte, eine junge Frau aus einer glänzenden Equipage steigen. Hingerissen blickte er auf die reizende Erscheinung, deren zartes Gesicht sich von dem Atlas ihres eleganten Hutes harmonisch abhob. Die schlanke Gestalt, die anmutigen Bewegungen entzückten ihn. Das Kleid wurde beim Aussteigen aus dem Wagen leicht zurückgeschlagen und ließ ein wohlgeformtes Bein sehen, das ein weißer Strumpf fein umspannte. Die junge Frau betrat den Laden und ließ sich Alben, Sammlungen von Lithographien vorlegen und kaufte für mehrere Goldstücke, die auf dem Ladentisch funkelten und klangen. Der junge Mann, der an der Türschwelle scheinbar damit beschäftigt war, die Gravüren in der Auslage zu betrachten, sandte der schönen Unbekannten die glühendsten Blicke, zu denen ein Mann fähig ist, sie hingegen blickte nur einmal unbekümmert zu ihm hin, wie man zufällig irgendeinen Passanten ansieht. Für ihn war es ein Abschied von der Liebe, von den Frauen! Aber dieser letzte, inbrünstige Hilferuf glitt unverstanden ab, rührte das Herz dieser leichtfertigen Frau nicht, ließ sie nicht erröten, nicht die Augen niederschlagen. Was war es für sie? Ein Zeichen der Bewunderung mehr, ein Verlangen, das sie eingeflößt hatte und das ihr am Abend die schmeichelnden Worte eingab: »Ich habe heute ›gut‹ ausgesehen.« Der junge Mann schritt rasch zu einem anderen Fenster und drehte sich nicht mehr um, als die Unbekannte ihren Wagen bestieg. Die Pferde zogen an, und diese letzte Vision des Luxus und der Schönheit schwand dahin, wie sein Leben dahinschwinden sollte. Melancholischen Schrittes ging er an den Geschäften vorbei und sah sich ohne großes Interesse die ausgelegten Waren an. Als die Läden aufhörten, betrachtete er den Louvre, das Institut, die Türme von Notre-Dame und vom Justizpalast und den Pont-des-Arts. Diese Bauwerke schienen traurig auszusehen unter dem grauen Widerschein des Himmels, durch den hie und da ein heller Strahl drang, der Paris bedrohlich wirken ließ, denn diese Stadt unterliegt wie eine hübsche Frau unerklärlichen Anwandlungen von Schönheit und Häßlichkeit. So schien sich die Natur selbst verschworen zu haben, den Todheischenden in schmerzliche Ekstase zu tauchen. Jener unheilvollen Macht ausgeliefert, deren zersetzende Wirkung mit dem Strom unserer Nerven den ganzen Organismus durchdringt, war es ihm, als ob sein Körper sich allmählich einem Schwebezustand näherte. Unter dem Ansturm dieser Todespein schwankte er gleich einer aufgepeitschten Welle und nahm Gebäude und Menschen wie durch einen Nebel wahr, in dem alles wogte und verschwamm. Er wollte sich dem Druck entziehen, den diese Auflehnung seiner physischen Natur auf seine Seele ausübte, und ging auf einen Antiquitätenladen zu, wo er seine Sinne abzulenken oder beim Handeln um Kunstgegenstände die Nacht zu erwarten beabsichtigte. Er tat dies sozusagen, um sich Mut zu machen und eine Herzstärkung zu sich zu nehmen, wie die Verbrecher, die auf ihrem Gang zum Schafott ihrer Kraft nicht trauen. Doch das Bewußtsein seines nahen Todes lieh dem jungen Mann für einen Augenblick die Sicherheit einer Herzogin, die zwei Liebhaber hat, und so trat er unbefangen, mit dem starren Lächeln eines Trunkenen, in den Laden des Antiquitätenhändlers. War er denn nicht trunken vom Leben oder vielmehr vom Tode? Bald befiel ihn wieder der Schwindel, und die Gegenstände erschienen ihm in seltsamen Farben oder verschoben sich leicht, als wären sie belebt, was höchstwahrscheinlich dem unregelmäßigen Kreisen seines Blutes zuzuschreiben war, das bald kaskadengleich brauste, bald matt und träg wie laues Wasser dahinfloß. Er erklärte einfach, die Lagerräume besichtigen zu wollen, um dort etwaige Kuriositäten ausfindig zu machen, die ihm zusagten. Ein frischer, pausbäckiger Bursche mit rotem Haarschopf, auf dem eine Ottermütze saß, übertrug die Aufsicht des Ladens einer alten Bäuerin, einer Art weiblichen Calibans,18 die gerade einen Ofen säuberte, ein Wunderwerk des genialen Bernard Palissy;19 dann sagte er mit sorgloser Miene zu dem Fremden: »Schauen Sie sich nur um, Monsieur! Hier unten sind nur ganz gewöhnliche Sachen. Wenn Sie sich aber die Mühe machen wollen, mit in die erste Etage hinaufzusteigen, kann ich Ihnen sehr schöne Mumien aus Kairo zeigen, mehrere inkrustierte Töpferarbeiten und ein paar Ebenholzschnitzereien, ›echte Renaissance‹ kürzlich erst eingetroffen und einfach wundervoll.«
In seiner entsetzlichen Lage empfand der Unbekannte dieses Ciceronengeschwätz,20 diese dummen Kaufmannsphrasen wie die albernen Scherze, mit denen beschränkte Geister einen Mann von Genie peinigen. Aber er trug sein Kreuz bis zum bitteren Ende, hörte seinem Führer mit halbem Ohre zu und antwortete mit Gesten und vereinzelten Worten. Doch nach und nach wußte er sich das Recht zu erobern, in Schweigen zu verharren, und konnte sich bedenkenlos seinen letzten grauenvollen Betrachtungen überlassen. Er war Poet, und unvermutet fand seine Seele hier Nahrung in Hülle und Fülle vor: er sollte die Gebeine aus zwanzig Welten im voraus zu sehen bekommen.
Auf den ersten Blick boten ihm die Lagerräume ein wirres Bild, auf dem sich Weltliches und Heiliges durcheinanderhäufte. Ausgestopfte Krokodile, Affen, Riesenschlangen grinsten Kirchenfenster an, es schien, als wollten sie ihre Zähne in Büsten schlagen, nach Lackarbeiten haschen oder an Kronleuchtern emporklettern. Eine Sèvresvase mit dem Bild Napoleons von Madame Jaquotot21 stand neben einer dem Sesostris22 geweihten Sphinx. Die Anfänge der Welt und die Begebenheiten von gestern fanden sich auf eine grotesk friedliche Art miteinander verbunden. Ein Bratenwender lag auf einer Monstranz, ein republikanischer Säbel auf einer mittelalterlichen Hakenbüchse. Madame Dubarry,23 von Latour24 in Pastell gemalt, nackt, in einer Wolke mit einem Stern auf dem Kopf, schien lüstern einen türkischen Tschibuk25 zu betrachten, als wollte sie den Zweck der sich ihr entgegenschlängelnden Spiralen ergründen. Werkzeuge des Todes, Dolche, seltsame Pistolen, Geheimwaffen, Rüstungen, lagen in buntem Durcheinander neben den Gerätschaften des Lebens: Porzellanschüsseln, Meißener Tellern, hauchdünnen chinesischen Tassen, antiken Salznäpfen, Konfektschalen aus adligem Familienbesitz. Ein Schiff aus Elfenbein wogte mit geschwellten Segeln auf dem Rücken einer reglosen Schildkröte. Eine Luftpumpe stieß dem Kaiser Augustus, der es erhaben kaltblütig hinzunehmen schien, ein Auge aus. Gefühllos wie zu ihren Lebzeiten schauten französische Schöffen und holländische Bürgermeister bleich und kalt von ihren Porträts auf dieses Chaos von antikem Kleinkram hernieder. Alle Länder der Erde schienen Überbleibsel ihrer Wissenschaften, eine Probe ihrer Kunst hierhergesandt zu haben. Es war eine Art philosophischen Kehrichthaufens, auf dem nichts fehlte, von der Friedenspfeife des Wilden bis zum grün-goldenen Pantoffel aus dem Serail, vom Krummschwert des Mauren bis zum Götzenbild der Tataren. Ja sogar der Tabaksbeutel des Soldaten, der Kelch des Priesters und die Federn von einem Thron waren da zu finden. Überdies wurde diese monströse Szenerie von tausendfach wechselnden bizarren Lichtreflexen beherrscht, die dem Wirrwarr der Farbtöne und dem schroffen Kontrast von Hell und Dunkel entsprangen. Das Ohr vermeinte, erstickte Schreie zu vernehmen, der Geist, unvollendete Dramen zu erfassen, das Auge, einen verborgenen Lichtschein zu erspähen. Hartnäckiger Staub hatte seinen leichten Schleier über alle Gegenstände gebreitet, deren zahlreiche Kanten und Rundungen die malerischsten Wirkungen hervorriefen.
Der Fremde verglich diese drei mit den Produkten der Zivilisation, den Zeugnissen der verschiedensten Kulte, mit Gottheiten, Meisterwerken, königlichen Insignien, mit Ausschweifung, Vernunft und Tollheit vollgepfropften Räume zunächst einem Spiegel aus zahlreichen Facetten, deren jede eine Welt zeigt. Nach dem ersten verworrenen Eindruck wollte er einzelne Gegenstände auswählen und genießerisch betrachten; doch nach dem vielen Sehen, Denken und Träumen befiel ihn ein heftiges Fieber, das wohl von dem in seinen Eingeweiden nagenden Hunger herrühren mochte. Der Anblick so vieler Pfänder, die von versunkenen Nationen und dahingegangenen Leben der Menschen zeugten, betäubte vollends die Sinne des jungen Mannes; der Wunsch, der ihn in den Laden getrieben hatte, war erhört worden: er verließ die Wirklichkeit, stieg allmählich zu einer Traumwelt empor, gelangte in den Zauberpalast der Ekstase, wo ihm das Universum bruchstückhaft und in Feuer getaucht erschien, so wie einst vor den Augen des heiligen Johannes auf Patmos die Zukunft flammend vorüberzog.
Unzählige Gestalten, schmerzbewegte, liebliche und schreckliche, finstere und leuchtende, ferne und nahe, erhoben sich in Scharen, in Myriaden, in Generationen. Vor einer von schwarzen Bändern umwickelten Mumie wuchs starr und geheimnisumwoben Ägypten aus dem Sand; dann die Pharaonen, die um ihrer Grabmäler willen ganze Völker in den Tod trieben; dann Moses, die Hebräer und die Wüste, eine feierliche, uralte Welt. Eine Marmorstatue, auf einem Säulentorso sitzend, frisch, anmutig und von strahlender Weiße, ließ die wollüstigen Mythen Griechenlands und Ioniens vor ihm erstehen. Und wen hätte es nicht gleich ihm entzückt, auf dem feinen roten Ton einer etruskischen Vase ein junges braunhäutiges Mädchen vor dem Gott Priapus tanzen zu sehen, den es mit heiterer Miene grüßte? Gegenüber liebkoste zärtlich eine römische Königin ihre Chimära.26 Dort lebten all die Launen des kaiserlichen Roms wieder auf, das Bad, das Lager, die Toilette einer träumerisch trägen Julia, die ihren Tibull erwartet. Mit der Macht arabischer Talismane weckte der Kopf Ciceros die Erinnerung an das freie Rom in ihm und ließ die Seiten des Titus Livius27 vor ihm abrollen. Der junge Mann las ›Senatus Populusque Romanus‹;28 wie nebelhafte Traumgestalten zogen der Konsul, die Liktoren, die purpurgesäumten Togen, die Kämpfe des Forums, das erzürnte Volk langsam an ihm vorbei. Schließlich übertönte das christliche Rom diese Bilder. Ein Gemälde öffnete die himmlischen Gefilde, er erblickte die Jungfrau Maria inmitten von Engeln auf einer goldenen Wolke, den Glanz der Sonne überstrahlend, wie sie, die wiedererstandene Eva, gütig lächelnd die Klagen der Unglücklichen anhört. Wie er ein Mosaikbild berührte, das aus der verschiedenfarbigen Lava des Vesuv und des Ätna zusammengesetzt war, flog seine Seele in das warme, heißblütige Italien. Er wohnte den Orgien der Borgia29 bei, durchstreifte die Abruzzen, warb um die Liebe italienischer Frauen, entbrannte in Leidenschaft für ihr weißes Antlitz mit den schwarzen Mandelaugen. Er schauderte, nächtliche Erfüllung wurde von der kalten Klinge des Ehemanns jäh unterbrochen, als er einen mittelalterlichen Dolch gewahrte, dessen Griff fein ziseliert war und auf dem Rostflecke an Blut gemahnten. Indien und seine Religionen wurden lebendig in einem chinesischen Götzen, angetan mit Gold und Seide, einem spitzen Hut, mit geschwungenen Rauten, rundum mit Glöckchen behängt. Daneben strömte eine Binsenmatte, hübsch wie die Bajadere, die sich einstmals darauf zusammengerollt haben mochte, noch den herben Duft des Sandel aus. Ein chinesisches Ungeheuer mit verdrehten Augen, verzerrtem Mund, verrenkten Gliedern bot der Seele neuen Reiz in der Findigkeit eines Volkes, das, des einförmig Schönen überdrüssig, unerschöpfliche Freuden in der Fruchtbarkeit des Häßlichen findet. Ein Salznapf aus den Werkstätten des Benvenuto Cellini30 versetzte ihn mitten in die Renaissance, in die Zeit, da Kunst und Handwerk blühten, da Fürsten sich an Folterungen ergötzten und Konzile in den Armen von Kurtisanen liegend den einfachen Priestern Keuschheit vorschrieben. Auf einer Kamee sah er die Siege Alexanders; die Massaker Pizarros auf einer Luntenschloßmuskete; auf einem Helm die wilden, hitzigen, grausamen Religionskriege. Dann tauchten aus einer prächtig damaszierten, blankgeputzten mailändischen Rüstung, unter deren Visier noch die Augen eines Paladins zu funkeln schienen, die heitern Bilder der Ritterzeit empor.
Dieses Meer von Hausrat, Erfindungen, Moden, Kunstwerken und Bruchstücken bildete für ihn ein endloses Poem. Formen, Farben, Gedanken, alles lebte wieder auf, doch kein Ganzes bot sich der Seele dar. Der Dichter mußte die Skizzen des großen Malers ergänzen, auf dessen ungeheurer Palette die zahllosen Erzeugnisse menschlichen Lebens in verschwenderischer Fülle achtlos zusammengeworfen waren. Nachdem der junge Mann die Welt geschaut, Länder, Zeitalter, Herrscherepochen an sich hatte vorüberziehen lassen, wandte er sich einzelnen Schicksalen zu. Er versetzte sich in neue Gestalten, wobei er sich an Einzelheiten orientierte und das Leben der Völker, als zu niederdrückend für einen einzelnen Menschen, beiseite ließ.
Dort schlief ein Kind aus Wachs, aus dem Kabinett von Ruysch31 gerettet, und dieses liebliche Geschöpf rief die Freuden seiner eigenen Kindheit in ihm wach. Bei dem zauberhaften Anblick des Bastschurzes eines jungen Mädchens aus Tahiti malte seine glühende Phantasie ihm das einfache Leben in der Natur aus, die keusche Nacktheit echter Scham, die Wonnen des dem Menschen eigenen Müßigganges, ein ganzes Leben der Ruhe am Rande eines klaren verträumten Baches, unter einem Bananenbaum, der auch ohne Pflege sein wohlschmeckendes Manna spendet. Doch dann plötzlich wurde er Korsar und hüllte sich in die schreckliche Poesie des Lara,32 die ihm aus dem perlmuttfarbenen Glanz tausenderlei Muscheln und Sternkorallen entgegenströmte, die ihm den Duft von Tang, Algen und atlantischen Stürmen zutrugen. Doch gleich vergaß er die tosenden Fluten, da ein kostbares handgeschriebenes Meßbuch mit zarten Miniaturen, azurnen und goldenen Arabesken seine Bewunderung erregte. Von friedlichen Gedanken sanft gewiegt, gab er sich aufs neue dem Studium und den Wissenschaften hin, wünschte sich das fette Leben der Mönche, frei von Leid und frei von Lust, legte sich in einer Zelle schlafen und blickte von seinem Spitzbogenfenster aus über die Wiesen, Wälder und Weinberge seines Klosters hin. Vor einigen Teniers33 zog er den Soldatenrock an oder teilte das harte Leben des Handwerksmannes; wünschte die schmierige, rauchgeschwärzte Mütze der Flamen aufzusetzen, spielte Karten mit ihnen, soff Bier und schäkerte mit einer drallen Bäuerin. Er zitterte vor Kälte beim Anblick eines Schneefalls von Mieris34 und kämpfte in einer Schlacht von Salvator Rosa.35 Er strich mit der Hand über einen Tomahawk aus Illinois und fühlte das Skalpiermesser eines Cherokee auf seinem Schädel. Eine Rubebe,36 die ihn entzückte, legte er in die Hand eines Burgfräuleins, lauschte der melodischen Romanze und abends am gotischen Kamin, im Halbdunkel, das ihm ihre gewährenden Blicke entzog, gestand er ihr seine Liebe. In vollen Zügen leerte er den Kelch der Freuden und der Schmerzen, versuchte sich in allen Daseinsformen und verausgabte sein Leben und seine Gefühle so verschwenderisch in den Trugbildern dieser plastischen und doch öden Welt, daß er den Hall seiner Schritte in sich wahrnahm wie den fernen Klang aus einer anderen Welt, wie das Brausen von Paris auf den Türmen von Notre-Dame.
Als er die Treppe zu den Räumen im ersten Stockwerk hinaufstieg, sah er Votivschilde, Rüstungen, geschnitzte Tabernakel, Holzfiguren, die auf den Stufen standen oder an die Wände gehängt waren. Verfolgt von den seltsamsten Formen, umgaukelt von wunderbaren Schöpfungen aus dem Grenzbereich von Tod und Leben, schritt er im Zauberbann eines Traums dahin. Zuletzt schien ihm seine eigene Existenz fraglich; er war wie diese Kuriositäten weder ganz tot noch ganz lebendig. Als er die neuen Lager betrat, fing es an zu dunkeln; doch Licht schien für die dort angehäuften gold- und silberfunkelnden Schätze überflüssig. Die kostspieligsten Liebhaberstücke von Verschwendern, die in Dachstuben geendet hatten, nachdem Millionen durch ihre Finger geglitten waren, befanden sich in diesem ungeheuren Bazar menschlicher Torheiten. Ein Schreibzeug, einst mit 100 000 Francs bezahlt und für 100 Sous aufgekauft, lag neben einem Geheimschloß, dessen Preis dazumal genügt hätte, einen König loszukaufen. Hier zeigte sich der menschliche Geist im ganzen Gepränge seiner Jämmerlichkeit, im vollen Glanz seiner gigantischen Beschränktheit. Ein Tisch aus Ebenholz, ein vollendetes Kunstwerk, nach Zeichnungen von Jean Goujon37 geschnitzt, das jahrelange Arbeit gekostet hatte, war vielleicht zum Brennholzpreis gekauft worden. Kostbare Kästchen, Geräte, die von Feenhänden gefertigt schienen, waren gleichgültig übereinandergehäuft.
»Sie haben hier Millionen!« rief der junge Mann, als er im letzten Raum einer ungeheuren Zimmerflucht angelangt war, die von Künstlern des vorigen Jahrhunderts vergoldet und mit reicher Schnitzarbeit versehen waren.
»Sagen Sie lieber Milliarden«, erwiderte der pausbäckige junge Mann. »Aber dies hier ist noch gar nichts; kommen Sie erst in das dritte Stockwerk, dann werden Sie sehen.«
Der Unbekannte folgte seinem Führer und gelangte in eine vierte Galerie, wo an seinen ermüdeten Augen in gedrängter Folge Gemälde von Poussin vorüberzogen, eine herrliche Statue von Michelangelo, einige entzückende Landschaften von Claude Lorrain,38 ein Gérard Dou,39 der wie eine Szene von Sterne anmutete, Rembrandts, Murillos,40 Velasquez’,41 düster und farbenreich wie ein Poem von Lord Byron,42 überdies antike Basreliefs, Achatkelche, seltene Onyxe! … Kurzum, es waren Arbeiten, die einem die Arbeit verleiden konnten, Kunstwerke in solcher Unzahl, daß sie einem Widerwillen gegen die Kunst einflößen und die Begeisterung töten mußten. Er stand vor einer Madonna von Raffael, aber er war Raffaels überdrüssig. Selbst für eine Figur von Correggio43 hatte er nicht einmal mehr den Blick, den sie erheischte. Eine antike Porphyrvase von unschätzbarem Wert, deren rundumlaufendes Relief die grotesk-unzüchtigste aller römischen Priapeen darstellte und einstmals irgendeine Corinna höchlichst ergötzte, entlockte ihm kaum ein Lächeln. Er erstickte unter den Trümmern fünfzig entschwundener Jahrhunderte, er war krank von all diesem menschlichen Gedankengut, erschlagen von Pracht und Kunstwerken, erdrückt von diesen ständig neu erwachsenden Formen, die, wie die Ausgeburten eines boshaften Geistes, unablässig aus dem Boden schossen und ihn in einen schier endlosen Kampf verstrickten.
Braut die Seele, die in ihrer Veränderlichkeit der modernen Chemie gleicht, welche die Schöpfung von einem Gas ableitet, durch die rasche Konzentration ihrer Genüsse, ihrer Kräfte oder ihrer Ideen nicht schreckliche Gifte? Sterben viele Menschen nicht an einer moralischen Säure, die sich plötzlich über ihr Inneres ergießt?
»Was ist denn in diesem Kasten?« fragte er, als er in ein großes Kabinett trat, eine letzte Schatzkammer, die Herrlichkeit, Meisterwerke aus Menschenhand, Kuriositäten und Reichtümer, in Fülle enthielt, und deutete auf einen großen viereckigen Mahagonischrein, der mit einer silbernen Kette an einem Nagel hing.
»Oh, Monsieur allein hat den Schlüssel dazu«, sagte der dicke Bursche geheimnisvoll. »Wenn Sie das Porträt zu sehen wünschen, werde ich es wagen, Monsieur davon in Kenntnis zu setzen.«
»Es wagen!« sagte der junge Mann. »Ist Ihr Herr ein Fürst?«
»Schon möglich«, antwortete der Bursche.
Sie sahen sich einen Augenblick an, der eine so erstaunt wie der andere. Der Lehrling deutete das Schweigen des Unbekannten als unausgesprochenen Wunsch und ließ ihn in dem Kabinett allein.
Hast du dich jemals bei der Lektüre der geologischen Werke von Cuvier44 in die Unendlichkeit von Raum und Zeit geschwungen? Hast du, getragen von seinem Genie, wie von der Hand eines Zauberers, über dem grenzenlosen Abgrund der Vergangenheit geschwebt? Wenn wir die Erde Scholle für Scholle und Schicht für Schicht abtragen und unter den Steinbrüchen des Montmartre oder in den Schiefergebirgen des Ural die fossilen Reste von Tieren entdecken, die vorsintflutlichen Zivilisationen angehören, wie muß die Seele da erschrecken, wenn sie sich vorstellt, daß Milliarden Jahre vergangen sind, Millionen Völker gelebt haben, die von dem schwachen menschlichen Gedächtnis und der starren religiösen Tradition vergessen worden sind und deren Asche die Oberfläche unseres Erdballs bildet, die zwei Fuß Boden, woraus uns Brot und Blumen wachsen? Ist nicht Cuvier der größte Dichter unseres Jahrhunderts? Lord Byron hat wohl ein paar seelische Erschütterungen vortrefflich in Worte gebannt; aber unser unsterblicher Forscher hat aus gebleichten Knochen Welten wiedererstehen lassen, hat, wie Kadmos,45 mit Zähnen Städte neu erbaut, hat mit einigen Brocken Kohle tausend Wälder mit allen Geheimnissen der Tierwelt wieder lebendig werden lassen, hat am Fuß eines Mammuts erkannt, daß Völker von Riesen gelebt haben. Diese Gestalten ragen auf, wachsen und füllen Regionen, die ihrer kolossalen Größe entsprechen. Er ist Dichter mit Zahlen, er ist erhaben, wenn er eine Null neben eine Sieben setzt. Er erweckt das Nichts, ohne magische Worte zu drechseln. Er untersucht ein Stück Kalk, bemerkt einen Abdruck und ruft: ›Seht her!‹ Alsbald wandelt sich der Stein zum Tier, der Tod zum Leben, die Welt entrollt sich. Nach unzähligen Geschlechtern gigantischer Kreaturen, nach Reihen von Fisch- und Molluskenarten kommt endlich die Gattung Mensch, degenerierter Nachkömmling eines grandiosen Typus, der vielleicht vom Schöpfer zertrümmert worden ist. Von dem rückwärtsschauenden Blick des Forschers angefeuert, können diese kümmerlichen, gestern geborenen Menschen das Chaos überschreiten, einen endlosen Hymnus anstimmen und sich die Ursprünge des Weltalls in einer Art rückläufiger Apokalypse vergegenwärtigen. Angesichts dieser ungeheuren Auferstehung, von der Stimme eines einzigen Menschen beschworen, muß uns das Quentchen, das uns in dem namenlosen, allen Sphären gemeinsamen Unendlichen, das wir ›die Zeit‹ benannt haben, zur Nutzung gewährt ist, muß diese Minute Leben uns zum Erbarmen gering erscheinen. Von so vielen verfallenen Welten niedergedrückt, fragen wir uns, wozu unser Ruhm, unser Haß, unsere Liebe nütze sind; ob wir die Mühe, zu leben, auf uns nehmen müssen, um ein nicht faßbarer Punkt in der Zukunft zu werden? Losgelöst von der Gegenwart, sind wir tot bis zu dem Augenblick, da unser Kammerdiener eintritt und meldet: ›Madame la Comtesse läßt ausrichten, daß sie Monsieur erwartet.‹
Die Wunder, die dem jungen Mann die ganze bekannte Schöpfung vor Augen geführt hatten, versetzten ihn in die tiefe Niedergeschlagenheit, die den Philosophen bei der wissenschaftlichen Sichtung unbekannter Schöpfungen befällt. Lebhafter denn je wünschte er zu sterben. Er sank auf einen kurulischen Stuhl und ließ seine Blicke über das Blendwerk dieses Panoramas der Vergangenheit schweifen. Die Gemälde leuchteten auf, die Köpfe der Madonnen lächelten ihn an, und die Statuen färbten sich mit einem trügerischen Schein des Lebens. Im Schutz des Dunkels, vom gärenden Fieber seines gepeinigten Hirns in Tanz gesetzt, regte sich alles und umwirbelte ihn; jeder Porzellanaffe schnitt ihm eine Grimasse, die Gestalten auf den Bildern schlossen die Lider, um die Augen auszuruhen. Jedes dieser Geschöpfe taumelte, hüpfte, löste sich von seinem Platz, schwerfällig oder leichtfüßig, anmutig oder ungestüm, je nach seinen Sitten, seinem Charakter oder seinem Umfeld. Es war ein geheimnisvoller Sabbat, würdig der phantastischen Erscheinungen, die Doktor Faust auf dem Brocken sah. Aber diese optischen Täuschungen, die von Erschöpfung, Überanstrengung der Sehnerven und dem verwirrenden Dämmerlicht herrührten, konnten dem Unbekannten keine Angst einjagen. Die Schrecken des Lebens vermochten nichts über eine mit den Schrecken des Todes vertraute Seele. Mit einer gewissen spöttischen Komplizenschaft unterstützte er sogar die Trugbilder dieses von seinem Geist eingehauchten Lebens, dessen Seltsamkeiten sich zu den letzten Gedanken gesellten, die ihm noch das Gefühl des Daseins gewährten. Es herrschte so vollkommene Stille um ihn, daß er sich einer sanften Träumerei überließ, deren Stimmungen sich wie durch Zauber Ton für Ton in dem Grade verfinsterten, wie das Licht entschwand. Bevor der Tag sank, ließ er im Widerstreit mit der Nacht ein letztes Mal den Himmel rot erglühen; der junge Mann blickte auf und sah ein kaum wahrnehmbares Skelett, das zweifelnd mit dem Schädel wackelte, als wollte es sagen: ›Die Toten wollen noch nichts von dir wissen!‹ Als er, um den Schlaf zu vertreiben, mit der Hand über die Stirn fuhr, spürte er deutlich einen frischen Luftzug von irgend etwas Haarigem, das über seine Wangen streifte, und er schauderte. Da die Fensterscheiben dumpf aufklangen, dachte er, daß diese kalte Liebkosung, die ihn wie aus dem Grabe angeweht hatte, von einer Fledermaus rühre. Noch einen Augenblick lang konnte er im ungewissen Schein der untergehenden Sonne die Phantome, von denen er umgeben war, undeutlich wahrnehmen; dann versank diese ganze tote Natur in einförmiges Dunkel. Die Nacht, die Zeit zu sterben war plötzlich gekommen. Es verging von da an noch ein gewisser Zeitraum, währenddessen er keine klare Vorstellung mehr von den irdischen Dingen hatte, sei es, daß er in tiefe Träumerei versunken war oder daß der Schlaf ihn nach seiner Erschöpfung, nach so vielen herzzerreißenden Gedanken übermannt hatte. Plötzlich glaubte er, von einer schrecklichen Stimme gerufen worden zu sein; er fuhr zusammen, wie wenn wir, von einem Alptraum gequält, mit einem Mal in bodenlose Tiefen stürzen. Er schloß die Augen, ein grelles Licht blendete ihn; in der Finsternis sah er einen rötlichen Kreis, in dessen Mitte sich ein kleiner alter Mann befand, der das Licht einer Lampe auf ihn gerichtet hielt. Er hatte ihn weder kommen noch sprechen, noch sich bewegen hören. Seine Erscheinung hatte etwas von Zauberei. Auch der Unerschrockenste hätte, derart aus seinem Schlaf gerissen, vor diesem Menschen gezittert, der aus einem der nebenstehenden Sarkophage geschlüpft zu sein schien. Die eigentümliche Jugendlichkeit, die aus den starren Augen dieses gespenstischen Greises blitzte, hinderte den Unbekannten, an übernatürliche Wirkungen zu glauben; gleichwohl verharrte er während der flüchtigen Spanne, die seinen somnambulen Zustand von seiner wachen Existenz trennte, in dem von Descartes46 empfohlenen philosophischen Zweifel, und geriet so wider Willen in den Bann der unerklärlichen Halluzinationen, deren geheimnisvolles Dasein unser Stolz ableugnet oder die unser ohnmächtiges Wissen vergeblich zu erklären sucht.
Man stelle sich einen kleinen, hageren, dürren Alten vor, mit einem schwarzen Samtrock bekleidet, der um seine Hüften mit einer dicken Seidenschnur zusammengehalten wurde. Ein gleichfalls schwarzes Samtkäppchen rahmte streng seine Stirn und ließ zu beiden Seiten des Gesichts lange weiße Haarsträhnen herabfließen. Das Gewand umhüllte den Körper wie ein großes Leichentuch und ließ von der menschlichen Gestalt nichts sehen als das schmale blasse Antlitz. Ohne den fleischlosen Arm, der einem mit Stoff bekleideten Stock ähnelte und den der Greis emporhielt, um den vollen Strahl seiner Lampe auf den jungen Mann zu richten, hätte man meinen können, das Gesicht hinge in der Luft. Ein grauer Spitzbart verbarg das Kinn jenes eigenartigen Wesens und ließ es jenen jüdischen Köpfen gleichen, die den Künstlern als Modell für die Darstellung des Moses dienen. Die Lippen waren so farblos, so schmal, daß man genau hinsehen mußte, um in dem gleichen Gesicht die Linie des Mundes zu entdecken. Die hohe, gefurchte Stirn, die hohlen, fahlen Wangen, die unerbittliche Strenge seiner kleinen grünen Augen ohne Wimpern und Augenbrauen konnten den Unbekannten glauben machen, daß der ›Goldwäger‹ von Gérard Dou aus seinem Rahmen gestiegen sei. Der Scharfsinn eines Inquisitors prägte sich in den Krümmungen seiner Runzeln, den kreisförmigen Falten seiner Schläfen aus und ließ auf ein tiefes Wissen um die Dinge des Lebens schließen. Es war unmöglich, diesen Menschen zu betrügen, der die Gabe zu besitzen schien, die verborgensten Gedanken in den Herzen der Menschen zu lesen. Auf seinem kalten Gesicht waren die Sitten aller Nationen des Erdballs und ihre Weisheit vereinigt, so wie in seinem staubigen Laden die Produkte der ganzen Welt angehäuft waren. Man konnte darin die klare Ruhe eines Gottes lesen, der alles sieht, oder die stolze Kraft eines Menschen, der alles gesehen hat. Ein Maler hätte mit zwei Pinselstrichen zwei grundverschiedene Ausdrücke treffen und aus diesem Antlitz ein schönes Bild des Ewigen Vaters oder die grinsende Maske des Mephistopheles schaffen können, denn eng beieinander fanden sich erhabene Hoheit auf der Stirn und schneidender Hohn um den Mund. Dieser Mann mußte, indem er mit einer gewaltigen Kraft alles menschliche Leiden unterdrückte, auch alle irdischen Freuden getötet haben. Der zum Sterben Entschlossene schauderte, da er ahnte, daß dieser bejahrte Greis in einer der Welt fremden Sphäre daheim war, wo er allein lebte, ohne Freuden, weil er keine Illusionen mehr hatte, ohne Kummer, weil er keine Freude mehr kannte. Der Alte stand unbeweglich, unerschütterlich wie ein Stern in einer lichten Wolke. Seine grünen Augen voll einer sonderbaren sanften Bosheit schienen die geistige Welt zu erhellen wie seine Lampe dieses geheimnisvolle Kabinett.
Dies war das eigenartige Schauspiel, das den jungen Mann überraschte, als er die Augen aufschlug, nachdem er von phantastischen Bildern und Todesgedanken eingeschläfert worden war. Wenn er wie betäubt verharrte, wenn er sich einen Augenblick lang von einem Glauben beherrschen ließ wie Kinder von Ammenmärchen, so muß man dies der durch seine Meditationen hervorgerufenen Umnebelung seiner Sinne und seines ansonsten klaren Urteilsvermögens, der Überreiztheit seiner Nerven und der Heftigkeit der inneren Vorgänge zuschreiben, die ihn wie in einem Opiumrausch in gräßliche Wonnen getaucht hatten. Diese Vision fand statt in Paris, auf dem Quai Voltaire, im 19. Jahrhundert, zu einer Zeit und an einem Ort, wo Hexerei unmöglich war. Als Nachbar des Hauses, wo der Gott des französischen Unglaubens sein Leben ausgehaucht hatte, als Schüler von Gay-Lussac47 und Arago,48 als Verächter der Taschenspielerkünste, deren sich die Mächtigen bedienen, erlag der Unbekannte wohl nur jenen poetischen Faszinationen, denen wir uns oft hingeben, wie um einer trostlosen Wirklichkeit zu entfliehen oder um Gott zu versuchen. So war es das unerklärliche Ahnen einer fremdartigen Macht, das ihn vor diesem Licht und diesem Greis erzittern ließ; aber dieses Gefühl glich jenem, das wir alle vor Napoleon oder in Gegenwart eines großen, geistvollen und berühmten Mannes empfunden haben.
»Sie wünschen das Bild Jesu von Raffael zu sehen, Monsieur?« fragte der Greis ihn höflich mit einer Stimme, deren heller, knapper Klang etwas Metallisches hatte.
Und er stellte die Lampe auf den Schaft einer abgebrochenen Säule, so daß der braune Kasten im hellen Licht stand.
Bei den heiligen Namen Jesus Christus und Raffael entfuhr dem jungen Manne eine Bewegung der Neugierde, die der Kaufmann, der eine Feder in Gang setzte, erwartet zu haben schien. Sofort glitt die Mahagoniplatte in einer Nut lautlos abwärts und bot die Leinwand der Bewunderung des Unbekannten dar. Beim Anblick dieses unsterblichen Werkes vergaß er die Phantasiegebilde im Laden und die Ausgeburten seines Schlummers, wurde wieder Mensch, erkannte in dem Alten ein Geschöpf aus Fleisch und Blut, das recht lebendig und keineswegs ein Trugbild war, und lebte wieder in der wirklichen Welt. Die liebevolle Sorge, die milde Heiterkeit des göttlichen Angesichts teilten sich ihm mit. Ein dem Himmel entströmter Hauch löste die Höllenqualen, die ihm das Mark verzehrten. Der Kopf des Erlösers tauchte aus der Finsternis, die der schwarze Hintergrund vorstellte; ein Strahlenkranz umgab sein Haar, aus dem dieses Leuchten hervorzubrechen schien; von der Stirn, von den Wangen, aus allen Zügen strömte eine beredte eindringliche Überzeugung. Die tief roten Lippen hatten das Wort des Lebens verkündet, und der Betrachter lauschte auf dessen heiligen Widerhall in den Lüften, befragte die Stille nach seinen wundervollen Gleichnissen, hörte es in der Zukunft, fand es in den Lehren der Vergangenheit wieder. In der ruhigen Klarheit dieser anbetungswürdigen Augen, zu denen bekümmerte Herzen sich flüchteten, lag das ganze Evangelium. Aus seinem holden erhabenen Lächeln schließlich, das das Grundgebot: ›Liebet einander!‹ auszudrücken schien, konnte man die ganze katholische Religion herauslesen. Dieses Gemälde stimmte zur Andacht, rief zur Versöhnung auf, tötete die Selbstsucht, weckte alle schlummernden Tugenden. Gleich der Zauberkraft der Musik beschwor Raffaels Schöpfung köstliche Erinnerungen, und der Sieg des Bildes war so vollkommen, daß man den Maler vergaß. Das trügerische Licht vervollständigte das Wunder: für Augenblicke schien es, als ob der Kopf weit entfernt in einer Wolke sich bewegte.
»Ich habe für dieses Bild ein Vermögen hingegeben«, sagte der Händler kühl.
»Nun denn, jetzt heißt es sterben!« rief der junge Mann, der aus seiner Versunkenheit auffuhr; sein letzter Gedanke hatte ihn über eine Kette ihm kaum bewußter Überlegungen von einer letzten Hoffnung, an die er sich geklammert hatte, zu seinem unseligen Geschick zurückgeführt.
»Aha! Also hatte ich doch recht, dir zu mißtrauen!« stieß der Alte hervor, packte die Hände des jungen Mannes und preßte sie mit einer Hand an den Handgelenken zusammen wie mit einem Schraubstock.
Der Unbekannte lächelte traurig über dieses Mißverständnis und sagte sanft: »Fürchten Sie nichts, Monsieur, es handelt sich um mein Leben, nicht um das Ihre. Warum soll ich eine harmlose List nicht eingestehen?« fuhr er fort, da er die Unruhe des Alten bemerkte. »Ich wollte die Nacht abwarten, um mich, ohne Aufsehen, ertränken zu können, und bin hierhergekommen, Ihre Schätze zu besichtigen. Wer wird einem Mann der Wissenschaft und Poesie dieses letzte Vergnügen verargen?«
Der mißtrauische Händler durchforschte, während er ihm zuhörte, mit scharfen Blicken das düstere Antlitz seines angeblichen Kunden. Der schmerzliche Klang der Stimme indes beruhigte ihn bald, vielleicht las er auch in den fahlen Zügen das düstere Schicksal, vor dem vorher die Spieler zurückgebebt waren, und er ließ die Hände los. Doch streckte er mit einem Rest von Argwohn, der eine mindestens hundertjährige Erfahrung verriet, den Arm nach einem Buffet aus, wie um sich aufzustützen, und langte nach einem Stilett, wobei er fragte: »Sind Sie seit drei Jahren Beamtenanwärter beim Schatzamt und haben keine Sonderzulage erhalten?«
Der Unbekannte konnte sich nicht enthalten zu lächeln, während er mit einer Gebärde verneinte.
»Hat Ihnen Ihr Vater Ihre Geburt zu heftig vorgeworfen? Oder haben Sie Ihre Ehre eingebüßt?«
»Wenn ich sie einbüßen wollte, würde ich am Leben bleiben.«
»Sind Sie in den Funambules49 ausgepfiffen worden? Oder sind Sie genötigt, Gassenhauer zu komponieren, um das Begräbnis Ihrer Geliebten zu bezahlen? Hat Sie nicht vielmehr die Sucht nach Gold gepackt? Wollen Sie die Langeweile totschlagen? Nun, welch ein Wahn treibt Sie in den Tod?«
»Suchen Sie den Grund meines Todes nicht in den Ursachen, welche gemeinhin zu Selbstmorden führen. Um mir zu ersparen, Ihnen die unerhörten Leiden, die sich mit menschlicher Sprache ohnehin schwer ausdrücken lassen, zu enthüllen, will ich Ihnen nur sagen, daß ich mich in der tiefsten, schmählichsten, qualvollsten Not befinde. Und«, fügte er mit einem Ton hinzu, dessen wilder Stolz seine vorhergehenden Worte Lügen strafte, »ich will weder um Hilfe noch um Trost betteln.«
»He, he!« Die beiden Silben, die der Alte zunächst statt einer Antwort hören ließ, klangen wie das Kreischen einer Knarre. Dann fuhr er fort: »Ohne Sie zu nötigen, mich anzubetteln, ohne Sie zu beschämen, ohne Ihnen einen französischen Centime, einen Para aus der Levante, eine sizilianische Tari, einen deutschen Heller, eine russische Kopeke, einen schottischen Farthing, eine einzige Sesterze oder einen Obolus der alten Welt noch einen Piaster der neuen zu geben, ohne Ihnen irgend etwas von Gold, Silber, Münzen, Banknoten oder Wertpapieren anzubieten, will ich Sie reicher, mächtiger und angesehener machen, als es ein konstitutioneller König sein kann.«
Der junge Mann glaubte, der Alte sei kindisch geworden, er war wie betäubt und wagte nicht zu antworten.
»Drehen Sie sich um«, sagte der Händler und griff plötzlich zur Lampe, um ihr Licht auf die dem Bildnis gegenüberliegende Wand fallen zu lassen – »und betrachten Sie dieses Chagrinleder«, fügte er hinzu.
Der junge Mann erhob sich hastig und zeigte sich einigermaßen erstaunt, als er über dem Sessel, auf dem er gesessen hatte, ein Stück Chagrin an der Wand hängen sah, das nicht größer als eine Fuchshaut war; doch, einem auf den ersten Blick unerklärlichen Phänomen zufolge, warf dieses Leder in das tiefe Dunkel des Ladens so leuchtende Strahlen, daß man hätte denken können, sie gingen von einem kleinen Kometen aus. Der ungläubige junge Mann näherte sich dem angeblichen Talisman, der ihn vor Unglück bewahren sollte, und machte sich innerlich darüber lustig. Als er sich jedoch, von einer berechtigten Neugierde getrieben, vorbeugte, um die Haut von allen Seiten zu betrachten, entdeckte er bald einen natürlichen Grund für diese sonderbare Leuchtkraft. Die schwarzen Narben des Chagrins waren so sorgfältig geglättet und so vortrefflich poliert, die verschlungenen Rillen so klar und scharf, daß die Unebenheiten dieses orientalischen Leders, gleich den Facetten eines Granats, ebenso viele kleine Brennpunkte bildeten, die das Licht funkelnd zurückwarfen. Er erklärte dem Alten wissenschaftlich den Grund dieser Erscheinung, jener indes, statt zu antworten, lächelte nur vielsagend. Dieses überlegene Lächeln ließ den jungen Gelehrten vermuten, er werde mit irgendeinem Hokuspokus zum besten gehalten. Er wollte kein weiteres Rätsel mit in das Grab nehmen und drehte die Haut schnell um, wie ein Kind, das begierig ist, die Geheimnisse seines neuen Spielzeugs kennenzulernen.
»Aha!« rief er, »hier ist der Abdruck des Siegels, das die Orientalen das Siegel Salomons50 nennen.«
»Sie kennen es also?« fragte der Händler und stieß zwei- oder dreimal die Luft durch die Nase, was mehr besagte als die kräftigsten Worte.
»Ob es auf der Welt wohl einen Menschen gibt, der so einfältig wäre, an dieses Hirngespinst zu glauben?« rief der junge Mann, gereizt von diesem stummen Lachen voll bitteren Hohns.
»Wissen Sie denn nicht, daß der Aberglaube des Orients die mystische Form und die lügnerischen Schriftzeichen dieses Symbols geschaffen hat, das eine fabelhafte Macht vorstellen soll? Ich glaube, daß man mich diesbezüglich nicht minder der Albernheit bezichtigen müßte, als spräche ich von Sphinxen oder Greifen, deren Existenz ja auch mythologisch gewissermaßen beglaubigt ist.«
»Da Sie Orientalist sind, können Sie vielleicht diese Inschrift lesen?«
Er hob die Lampe dicht an den Talisman, den der junge Mann verkehrt herum hielt, und machte ihn auf die Schriftzeichen aufmerksam, die in das Zellgewebe dieser Wunderhaut eingekerbt waren, als ob sie das Tier, dem sie vormals angehört hatte, selbst hervorgebracht hätte.
»Ich gestehe«, rief der Unbekannte, »daß mir das Verfahren, dessen man sich bediente, um diese Buchstaben so tief in die Haut eines wilden Esels einzugravieren, unbekannt ist.«
Er kehrte sich lebhaft den mit Kuriositäten beladenen Tischen zu, und seine Augen schienen dort etwas zu suchen.
»Was wünschen Sie?« fragte der Alte.
»Ein Instrument, um das Chagrin anzuschneiden, damit ich sehen kann, ob die Buchstaben eingeprägt oder eingelegt sind.«
Der Alte reichte dem Unbekannten sein Stilett; der nahm es und begann das Leder an der Stelle, wo die Worte geschrieben standen, einzuschneiden; als er aber eine dünne Schicht Leder abgehoben hatte, traten die Buchstaben darunter wieder so deutlich und denen, die auf die Oberfläche eingekerbt waren, so völlig gleich, hervor, daß er einen Augenblick lang wähnte, nichts weggenommen zu haben.
»Die Kunst des Morgenlandes kennt Geheimnisse, um die tatsächlich nur sie allein weiß«, sagte er und betrachtete den orientalischen Spruch mit einer gewissen Unruhe.
»Ja«, erwiderte der Greis, »man tut besser daran, sich an die Menschen zu halten als an Gott.«
Die mysteriösen Worte waren folgendermaßen angeordnet:
Was in der Übersetzung heißt:
Wenn du mich besitzest, wirst du alles besitzen.
Aber dein Leben wird mir gehören.
Gott hat es so gewollt.
Wünsche, und deine Wünsche werden erfüllt werden.
Aber richte deine Wünsche nach deinem Leben.
Es ist in mir.
Bei jedem Wunsch werde ich abnehmen wie deine Tage.
Willst du mich? Nimm.
Gott wird dich erhören.
Sei es!
»Ah! wie fließend Sie das Sanskrit lesen!« sagte der Alte. »Haben Sie vielleicht Persien oder Bengalen bereist?«
»Nein, Monsieur«, erwiderte der junge Mann und betastete neugierig das symbolträchtige Leder, das sich wegen seiner geringen Geschmeidigkeit wie ein Metallblatt anfühlte.
Der alte Händler setzte die Lampe wieder auf die Säule, von der er sie genommen hatte, und warf dem jungen Mann einen Blick kalter Ironie zu, der zu sagen schien: ›Er denkt schon nicht mehr ans Sterben.‹
»Ist es ein Scherz? Ist es ein Geheimnis?« fragte der junge Unbekannte.
Der Alte schüttelte den Kopf und sagte ernst: »Ich kann Ihnen darauf nicht antworten. Ich habe die schreckliche Macht, die dieser Talisman verleiht, Männern angeboten, die mehr Energie hatten, als Sie zu besitzen scheinen; aber wenngleich sich auch alle über den zweifelhaften Einfluß, den er auf ihr künftiges Geschick ausüben sollte, lustig machten, hat doch noch keiner gewagt, diesen von einer unbekannten Macht so verhängnisvoll vorgeschlagenen Pakt einzugehen. Ich denke wie sie, ich habe gezweifelt, habe mich enthalten, und …«
»Und Sie haben es nicht einmal probiert?« unterbrach ihn der junge Mann.
»Probieren!« rief der Alte. »Wenn Sie auf der Vendôme-Säule ständen, würden Sie dann wohl probieren, in die Luft zu springen? Kann man den Lauf des Lebens aufhalten? Hat der Mensch je vermocht, stückchenweise zu sterben? Bevor Sie in dieses Kabinett traten, waren Sie entschlossen, sich das Leben zu nehmen; aber plötzlich beschäftigt Sie ein Geheimnis und bringt Sie vom Sterben ab. Kind! Wird Ihnen nicht jeder Ihrer Tage ein noch spannenderes Rätsel aufgeben, als es dieses ist? Hören Sie mich an. Ich habe noch den lasterhaften Hof des Regenten gesehen. Wie Sie steckte ich damals im Elend, ich habe mein Brot erbettelt. Trotzdem bin ich einhundertzwei Jahre alt und Millionär geworden: das Unglück machte mich reich, die Unwissenheit machte mich klug. Ich will Ihnen in wenigen Worten ein großes Geheimnis des menschlichen Lebens offenbaren: Der Mensch erschöpft sich durch zwei Akte, die er instinktiv vollzieht und die seine Lebensquellen zum Versiegen bringen. Zwei Verben drücken alle Formen aus, die diese beiden Todesursachen annehmen: Wollen und Können. Zwischen diesen beiden Grenzbegriffen menschlichen Handelns liegt ein anderer, dessen sich die Weisen bemächtigen, und ihm verdanke ich das Glück und mein langes Leben. Das Wollen verzehrt uns, und das Können zerstört uns; aber das Wissen läßt unsern schwachen Organismus in einem immerwährenden Zustand der Ruhe. So ist das Verlangen oder das Wollen in mir tot, vom Denken vernichtet. Die Bewegung oder das Können ist durch das natürliche Spiel meiner Organe aufgehoben. Kurz, ich habe mein Leben nicht in das Herz, das bricht, nicht in die Sinne, die abstumpfen, sondern in das Gehirn verlegt, das sich nicht abnutzt und alles überlebt. Kein Übermaß hat meiner Seele oder meinem Leib je geschadet. Dennoch habe ich die ganze Welt gesehen. Ich habe meine Füße auf die höchsten Berge Asiens und Amerikas gesetzt, habe alle Sprachen der Welt gelernt und unter allen Herrschaftsformen gelebt. Ich habe einem Chinesen mein Geld geborgt, der mir den Leichnam seines Vaters verpfändete, ich habe im Zelt des Arabers geschlafen, nur seinem Wort vertrauend; ich habe in allen Hauptstädten Europas Verträge unterzeichnet und habe mein Gold bedenkenlos im Wigwam der Wilden gelassen; kurz, ich habe alles erreicht, weil ich alles zu verachten verstand. Mein einziger Ehrgeiz war: zu sehen. Sehen, heißt das nicht wissen? Oh, junger Mann, heißt wissen nicht intuitiv genießen? Heißt dies nicht das Wesen der Dinge entdecken und sich dessen zu bemächtigen? Was bleibt uns vom materiellen Besitz? Eine Vorstellung. Urteilen Sie nun selbst, wie schön das Leben eines Mannes sein muß, der alle Wirklichkeit in sein Denken aufzunehmen vermag, den Ursprung des Glücks in seine Seele verlegt und so tausend vollkommene Freuden genießt, die von irdischem Makel befreit sind. Das Denken ist der Schlüssel zu allen Schätzen, es verschafft die Freuden des Geizigen, ohne dessen Sorgen. So habe ich mich über die Welt erhoben, und meine Genüsse sind geistiger Art gewesen. Meine Ausschweifungen waren die Betrachtung der Meere, der Völker, der Wälder, der Gebirge. Ich habe alles gesehen, aber in Ruhe, ohne Anstrengung; ich habe nie etwas herbeigewünscht, ich habe alles abgewartet. Ich habe das Universum durchwandelt wie den Garten eines Hauses, das mir gehörte. Was die Menschen Kummer, Liebe, Ehrgeiz, Mißgeschick, Traurigkeit nennen, das sind für mich Begriffe, die ich in Träumereien verwandle. Statt sie zu empfinden, verarbeite ich sie und verdeutliche sie; anstatt von ihnen mein Leben verzehren zu lassen, dramatisiere und entwickle ich sie und ergötze mich daran wie an Romanen, die ich mit meinem inneren Auge lese. Da ich meine Organe niemals überanstrengt habe, erfreue ich mich noch einer guten Gesundheit. Da meiner Seele die ganze Kraft, die ich nicht verbraucht habe, zugute gekommen ist, so ist mein Kopf noch besser ausgestattet als diese Lagerräume. Hier«, sagte er und klopfte sich an die Stirn, »hier sind die wahren Millionen. Ich verbringe köstliche Tage, wenn ich in Gedanken den Blick in die Vergangenheit schweifen lasse; ganze Länder, Landschaften, Bilder des Meeres, Gestalten von historischer Schönheit beschwöre ich herauf. Ich habe ein imaginäres Serail, wo ich alle Frauen besitze, die mir nie gehört haben. Oft lasse ich eure Kriege, eure Revolutionen an mir vorüberziehen und urteile über sie. Oh! wie kann man die flüchtige, hitzige Lust an mehr oder weniger rosigem Fleisch, an mehr oder weniger üppigen Formen, wie kann man das Unheil, das von eurem betrogenen Willen kommt, der erhabenen Fähigkeit vorziehen, das Universum an sich zu reproduzieren, das ungehemmte Glück, sich frei zu bewegen, ohne an die Fesseln von Zeit und Raum gekettet zu sein, der Seligkeit teilhaftig zu werden, alles zu umfassen, alles zu sehen, sich über den Rand der Welt zu neigen, um die andern Sphären zu befragen, um Gott zu lauschen! Darin«, sagte er mit erhobener Stimme und deutete auf das Chagrinleder, »darin sind ›Können‹ und ›Wollen‹ gleich. Da sind eure sozialen Ideen, eure ausschweifenden Begierden, eure maßlosen Genüsse, eure tödlichen Lüste, eure lebenszehrenden Schmerzen vereint; denn der Schmerz ist vielleicht nur eine allzu heftige Lust. Wer vermag wohl den Punkt zu bestimmen, wo die Lust Schmerz wird und wo der Schmerz noch Lust ist! Tun nicht die lichtesten Strahlen der idealen Welt dem Auge noch wohl, während jede noch so gelinde Finsternis der physischen Welt ihm weh tut? Kommt das Wort Weisheit nicht von Wissen? Und was ist die Torheit, wenn nicht das Übermaß eines Wollens oder Könnens?«
»Wohlan denn, ich will leben im Übermaß!« sprach der Unbekannte und ergriff das Chagrinleder.
»Junger Mann, hüten Sie sich!« rief der Alte mit unglaublicher Heftigkeit.
»Ich hatte mein Leben dem Studium und dem Denken geweiht, aber es hat mir nicht einmal Brot gegeben«, erwiderte der Unbekannte. »Ich will mich weder von einer Predigt zum Narren halten lassen, die eines Swedenborg51 würdig wäre, noch von Ihrem orientalischen Amulett, noch von Ihren barmherzigen Bemühungen, Monsieur, mich an eine Welt zu binden, wo meine Existenz künftighin unmöglich ist. Laß sehen!« rief er und drückte krampfhaft den Talisman, wobei er den Alten ansah. »Ich will ein glanzvolles, wahrhaft königliches Mahl, ein Bacchanal, wie es des Jahrhunderts würdig ist, in dem alles, wie man sagt, vollkommen sein soll. Meine Gäste sollen jung sein, geistreich und ohne Vorurteile, ausgelassen bis zur Tollheit! Und Weine sollen gereicht werden, die immer prickelnder, immer süffiger, immer stärker uns drei Tage lang berauschen! Die Nacht soll von feurigen Frauen verschönt sein! Ich will, daß die rasende ungezügelte Lust uns in ihrem Viergespann davontrage, über die Grenzen der Welt hinaus, uns an unbekannte Küsten verschlage, daß die Seelen sich in himmlische Gefilde schwingen oder in den Kot sinken, ob sie sich damit erheben oder erniedrigen, ich weiß es nicht, und es schert mich auch wenig! So befehle ich denn der finstern Macht, mir alle Freuden zu einer zu verschmelzen. Ja, alle himmlischen und irdischen Wonnen will ich in einer letzten Umarmung umfassen, um daran zu sterben. Dem Trinken sollen antike Liebesfeste folgen, Gesänge, die Toten zu erwecken, und dreifache Küsse, endlose flammende Küsse, die wie eine Feuersbrunst über Paris auflodern, so daß die Gatten aus dem Schlaf fahren und in eine rasende Glut geraten, die sie alle verjüngt, selbst die Siebzigjährigen!«
Gellendes Gelächter aus dem Munde des kleinen Alten tönte dem Wahnwitzigen in die Ohren wie ein Tosen der Hölle und unterbrach ihn so gebieterisch, daß er verstummte.
»Glauben Sie«, sagte der Händler, »daß mein Fußboden sich plötzlich öffnen wird, um prächtig beladene Tische und Gäste aus der andern Welt heraufzulassen? Nein, nein, junger Hitzkopf. Sie haben den Pakt geschlossen, alles ist gesagt. Von jetzt ab werden Ihre Wünsche peinlich genau erfüllt, aber auf Kosten Ihres Lebens. Der Kreis ihrer Tage, den dieses Leder verkörpert, wird je nach Ausmaß und Zahl Ihrer Wünsche, vom kleinsten bis zum ungeheuerlichsten, immer enger werden. Der Brahmane, dem ich diesen Talisman verdanke, hat mir seinerzeit erklärt, daß eine geheimnisvolle Übereinstimmung zwischen dem Schicksal und den Wünschen des Besitzers eintreten wird. Ihr erster Wunsch ist vulgärer Natur, ich könnte ihn erfüllen, aber ich überlasse dies den Ereignissen Ihrer neuen Existenz. Schließlich und endlich wollten Sie doch sterben? Je nun, Ihr Selbstmord ist nur aufgeschoben.«
Der Unbekannte, überrascht und nahezu gereizt, von dem sonderbaren Alten, dessen halb menschenfreundliche Absicht ihm mit dieser letzten Spottrede klar erwiesen schien, ständig aufgezogen zu werden, rief:
»Ich werde ja sehen, Monsieur, ob sich mein Schicksal in der Zeit, in der ich den Quai überschreite, wandeln wird. Aber wenn Sie nicht bloß eines Unglücklichen spotten, wünsche ich, um mich für einen so verhängnisvollen Dienst zu rächen, daß Sie sich in eine Tänzerin verlieben! Sie werden dann das Glück einer Ausschweifung begreifen und vielleicht all die Schätze vergeuden, die Sie so philosophisch angehäuft haben.«
Er ging hinaus, ohne den tiefen Seufzer zu hören, den der Greis ausstieß, durcheilte die Säle und lief die Treppen hinunter, während der pausbäckige Bursche ihm folgte und ihm vergeblich leuchten wollte. Er jagte jedoch davon wie ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wurde. Von einer Art Wahn wie geblendet, merkte er nicht einmal, wie unglaublich biegsam das Chagrinleder geworden war, das sich geschmeidig wie ein Handschuh in seinen fieberhaft bebenden Händen zusammenrollte, so daß es in seine Rocktasche paßte, wohin er es fast mechanisch steckte. Als er zur Ladentür hinaus auf die Straße stürzte, rannte er gegen drei junge Leute, die Arm in Arm vorübergingen.
»Rindvieh!«
»Schwachkopf!«
Das waren die liebenswürdigen Redensarten, die sie austauschten.
»Ah, du bist es, Raphael!«
»Nun, wir suchten dich!«
»Was, ihr seid es?«
Diese drei Freundschaftsbekundungen folgten unmittelbar auf die Schimpfwörter, als nämlich das Licht einer Laterne, vom Wind aufflackernd, die Gesichter der erstaunten Gruppe beleuchtete.
»Lieber Freund«, sagte der junge Mann, den er beinahe über den Haufen gerannt hätte, zu Raphael, »du kommst gleich mit uns.«
»Um was handelt es sich denn?«’
»Komm nur, ich erzähle dir die Geschichte unterwegs.«
Raphael mochte wollen oder nicht, seine Freunde umringten ihn, faßten seine Arme, reihten ihn in ihre lustige Schar ein und zogen ihn in Richtung zum Pont-des-Arts mit sich fort.
»Höre, Lieber«, fuhr der Redner fort, »wir stellen dir seit etwa einer Woche nach. In deinem ehrbaren Hotel Saint-Quentin, auf dessen unveränderlichem Schild, nebenbei gesagt, noch immer wie zu Rousseaus Zeiten die roten und schwarzen Buchstaben prangen, hat uns deine Leonarda52 gesagt, du seist aufs Land gereist. Und wir sehen doch wahrhaftig nicht nach Geldleuten, Gerichtsboten, Gläubigern, Häschern des Handelsgerichts und dergleichen aus. Gleichviel! Rastignac hatte dich am Abend vorher in den Bouffons53 gesehen, wir faßten wieder Mut und setzten unsern Stolz darein, zu entdecken, ob du in den Bäumen der Champs-Elysées dein Nest aufgeschlagen hast oder ob du dich für zwei Sous in jenen menschenfreundlichen Häusern einlogiert hast, wo die Bettler auf ausgespannten Gurten schlafen, oder ob du, im glücklicheren Fall, dein Lager vielleicht in irgendeinem Boudoir aufgeschlagen hast. Wir haben dich nirgends gefunden, weder auf den Häftlingslisten von Sainte-Pélagie54 noch auf denen von La Force.55 Nachdem die Ministerien, die Oper, die Klöster, Cafés, Bibliotheken, Präfektenlisten, Zeitungsredaktionen, Restaurants, Theaterfoyers, kurz alles, was es in Paris an guten und üblen Orten gibt, auf kundige Art durchforscht worden waren, beklagten wir den Verlust eines Mannes, der genial genug ist, sich sowohl bei Hofe als in den Gefängnissen suchen zu lassen. Schon redeten wir davon, dich wie einen Julihelden heiligsprechen zu lassen. Und meiner Treu, wir trauerten um dich!«
In diesem Augenblick schritt Raphael mit seinen Freunden über den Pont-des-Arts,56 und ohne ihre Worte weiter zu beachten, starrte er auf die brausenden Wasser der Seine hinunter, in der die Lichter von Paris widerstrahlten. Über diesem Flusse, in den er sich vor kurzem noch hatte stürzen wollen, wurde die Voraussagung des Alten erfüllt: die Stunde seines Todes war schon vom Schicksal aufgeschoben.
»Wir betrauerten dich wahrhaftig!« fing sein Freund, der sich nicht beirren ließ, wieder an. »Es handelt sich um ein Unternehmen, in das wir dich als Mann von hervorragenden Fähigkeiten, das heißt als Mann, der sich über alles hinwegzusetzen weiß, einbeziehen. Das Taschenspielerkunststück, den Konstitutionalismus unter dem royalistischen Hute verschwinden zu lassen, wird heute ernsthafter denn je betrieben, mein Lieber. Die vom Heldenmut des Volkes gestürzte schändliche Monarchie war eine Frau von schlechtem Lebenswandel, mit der man scherzen und prassen konnte: aber das Vaterland ist eine tugendhafte, mürrische Gattin: wir müssen wohl oder übel ihre kühlen Zärtlichkeiten hinnehmen. Nun ist aber, wie du weißt, die Macht von den Tuilerien auf die Journalisten übergegangen, wie der Staatshaushalt57 seinen Sitz vom Faubourg Saint-Germain zur Chaussée-d’Antin verlegt hat. Aber folgendes weißt du vielleicht nicht: Die Regierung, das heißt die Aristokratie der Bankiers und Advokaten, die heutzutage mit dem Vaterlande machen, was ehemals die Priester mit der Monarchie machten, hat es für nötig befunden, das gute Volk der Franzosen mit neuen Worten und alten Ideen, nach Art der Philosophen aller Schulen und der Mächtigen aller Zeiten, hinters Licht zu führen. Es gilt also, uns eine eminent nationale Idee einzutrichtern, indem man uns klarmacht, daß es viel vorteilhafter ist, 1200 Millionen 33 Centimes dem Vaterland in der Person der Messieurs Soundso zu zahlen als 1100 Millionen 9 Centimes einem Könige, der Ich sagte statt Wir. Kurzum, es ist eine Zeitung mit soliden 2-300 000 Francs gegründet worden, um eine Opposition zu bilden, die die Unzufriedenen zufriedenstellt, ohne der nationalen Regierung des Bürgerkönigs58 zu schaden. Und da wir uns aus der Freiheit ebensowenig machen wie aus der Despotie, aus der Religion so wenig wie aus dem Unglauben; da das Vaterland für uns eine Hauptstadt ist, wo man die Gedanken für soundsoviel pro Zeile eintauscht und verkauft, wo jeder Tag üppige Diners, sehenswerte Schauspiele bringt, wo es von liederlichen Dirnen wimmelt, wo die Soupers bis zum nächsten Tage dauern und die Liebe nach der Stunde bezahlt wird wie die Droschken; da Paris immer das anbetungswürdigste aller Vaterländer sein wird, das Vaterland der Freude, der Freiheit, des Geistes, der hübschen Frauen, der schlechten Kerle, des guten Weins, das Vaterland, wo die Zuchtrute der Macht nie allzu fühlbar wird, weil man denen zu nahe ist, die sie schwingen … so haben wir, die wahren Anhänger des Gottes Mephistopheles, es unternommen, den öffentlichen Geist zurechtzuschminken, die Akteure neu zu kostümieren, an der Regierungsbaracke neue Bretter anzuschlagen, den Doktrinären Arznei einzuflößen, die alten Republikaner wieder aufzubacken, die Bonapartisten aufzufrischen und dem Zentrum Proviant zuzuführen, vorausgesetzt, daß es uns erlaubt sei, uns über Könige und Völker ins Fäustchen zu lachen, am Abend anderer Meinung zu sein als am Morgen und ein lustiges Leben à la Panurge59 zu führen oder more orientali60 auf weichen Kissen zu liegen. Dir bestimmten wir die Zügel dieses makkaronischen und burlesken Reiches, und so führen wir dich denn geradeswegs zu einem Diner, das der Gründer besagten Journals, ein ehemaliger Bankier, veranstaltet, der nicht weiß, was er mit seinem Golde anfangen soll und es in Geist umwandeln will. Man wird dich dort wie einen Bruder aufnehmen, wir werden dich als den König der mißvergnügten Geister willkommen heißen, die nichts erschreckt, deren Scharfsinn die Absichten Österreichs, Englands oder Rußlands enthüllt, bevor Österreich, England oder Rußland Absichten haben! Ja, dich krönen wir zum Souverän dieser Verstandesriesen, die die Welt mit Mirabeaus,61 Talleyrands,62 Pitts,63 Metternichs,64 mit allen jenen dreisten Crispins65 beliefern, die unter sich um Geschicke eines Reiches spielen, wie die gewöhnlichen Leute beim Domino um ihr Kirschwasser. Wir haben dich als den unerschrockensten Kämpen ausgegeben, der es je mit der Ausschweifung aufgenommen hat, jenem herrlichen Ungeheuer, das alle starken Geister zum Kampf herausfordert; ja, wir haben sogar behauptet, daß es dich noch nicht besiegt habe. Ich hoffe, du wirst unsere Lobreden nicht Lügen strafen. Taillefer, unser Amphitryon,66 hat uns versprochen, die knausrigen Saturnalien67 unserer kleinen modernen Lukullusse zu überbieten. Er ist reich genug, um Niedrigkeit mit Größe, Laster mit Eleganz und Grazie zu umgeben. Hörst du zu, Raphael?« fragte der Redner und unterbrach sich.
»Ja«, antwortete der junge Mann, der weniger erstaunt war über die Erfüllung seiner Wünsche als über die Natürlichkeit, mit der die Ereignisse sich verketteten.
Obgleich es ihm unmöglich war, an einen magischen Einfluß zu glauben, bewunderte er die Zufälle des menschlichen Lebens.
»Du sagst ›ja‹ zu uns in einer Weise, als ob du an den Tod deines Großvaters dächtest«, sagte einer seiner Kameraden.
»Ach«, sagte Raphael in einem so naiven Ton, daß die Schriftsteller, die Hoffnung des jungen Frankreich, in Gelächter ausbrachen, »ach, meine Freunde, ich dachte eben daran, daß wir auf dem Weg sind, rechte Schurken zu werden. Bisher haben wir nur zwischen zwei Weinen ruchlose Reden geschwungen, haben im Rausch das Leben und beim Verdauen Menschen und Dinge beurteilt. Jungfräulich im Tun, waren wir nur in Worten vermessen; jetzt aber vom glühenden Eisen der Politik gebrandmarkt, werden wir in dieses große Bagno eintreten und unsere Illusionen verlieren. Wenn man nur mehr an den Teufel glaubt, ist es erlaubt, um das Paradies der Jugend zu trauern, die Zeit der Unschuld, da wir einem guten Priester gläubig die Zunge hinstreckten, um den heiligen Leib unseres Herrn Jesu Christi zu empfangen. Ach, liebe Freunde, wenn uns ehemals unsere ersten Sünden so viel Vergnügen machten, dann weil wir noch Gewissensbisse hatten, die sie verschönten, ihnen einen pikanten Reiz verliehen; jetzt hingegen …«
»Oh, jetzt«, warf der erste Redner ein, »bleibt uns …«
»Was?« fragte ein anderer.
»Das Verbrechen …«
»Das ist ein Wort, das die Höhe eines Galgens und die Tiefe der Seine hat«, versetzte Raphael.
»Oh, du verstehst mich nicht … ich rede von politischen Verbrechen. Seit heute morgen trachte ich nur noch nach einem: nach der Existenz eines Verschwörers. Ob ich morgen noch immer Lust dazu habe, weiß ich nicht; aber heute abend erfüllt das schale Leben unserer Zivilisation, das so einförmig ist wie ein Schienenstrang, mein Herz mit Ekel. Die Schrecken des Rückzugs von Moskau, die Abenteuer des roten Korsaren68 und das Leben der Schmuggler begeistern mich leidenschaftlich. Da es in Frankreich kein Kartäuserkloster mehr gibt, so wünschte ich, daß es wenigstens ein Botany Bay,69 eine Art Heilanstalt für die kleinen Lord Byrons gäbe, die, nachdem sie das Leben wie eine Serviette nach Tisch weggeworfen haben, nichts Besseres wissen, als ihr Land in Brand zu stecken, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen, für die Republik zu konspirieren oder zum Krieg zu hetzen …«
»Émile«, unterbrach Raphaels Nachbar feurig den Redner, »auf Manneswort, ohne die Julirevolution wäre ich Priester geworden, um irgendwo auf dem Land ein stumpfsinniges Leben zu führen und …«
»Und du hättest alle Tage das Brevier gelesen?«
»Ja.«
»Du bist ein Tor.«
»Wir lesen doch auch Zeitungen!«
»Nicht übel, für einen Journalisten! Aber sei still, wir sind von lauter Abonnenten umgeben. Der Journalismus, siehst du, ist die Religion der modernen Gesellschaft, und darin liegt ein Fortschritt.«
»Wie das?«
»Die Pontifexe müssen nicht glauben und das Volk auch nicht …«
Indem sie so wie ehrbare Leute, die das ›De Viris illustribus‹70 seit vielen Jahren kannten, plauderten, gelangten sie zu einem der vornehmen Häuser der Rue Joubert.
*
Émile war ein Journalist, der durch Nichtstun mehr Berühmtheit erlangt hatte als andere durch ihre Erfolge. Ein scharfer Kritiker, voll Schwung und beißender Ironie, besaß er alle Vorzüge, die seine Fehler mit sich brachten. Unverhohlen und lachend sagte er einem Freund tausend Bosheiten ins Gesicht, den er in dessen Abwesenheit mutig und aufrichtig verteidigte. Er spottete über alles, selbst über seine Zukunft. Stets in Geldnöten, verharrte er wie alle Menschen von einiger Bedeutung in unsagbarer Faulheit und warf nur manchmal solchen Leuten mit einem Wort ein ganzes Buch an den Kopf, die in einem ganzen Buch noch nicht einmal ein einziges Wort zu sagen hatten. Mit Versprechungen ging er sehr verschwenderisch um, doch hielt er sie nie, und Vermögen und Ruhm machten ihm so wenig Sorgen, daß er Gefahr lief, seine Tage im Spital zu beschließen. Ein Freund übrigens bis zum bitteren Ende, ein großmäuliger Zyniker und doch harmlos wie ein Kind, arbeitete er nur, wenn ihm der Sinn danach stand oder die Not ihn zwang.
»Wir werden eine famose Mahlzeit halten, wie Meister Alcofribas71 zu sagen beliebte«, sprach er zu Raphael und wies auf die Kästen mit Blumen, die das Treppenhaus schmückten und mit Wohlgeruch erfüllten.
»Ich liebe warme, mit Teppichen ausgelegte Vorhallen«, sagte Raphael. »Luxus schon im Treppenhaus ist in Frankreich selten. Hier lebe ich auf.«
»Und da oben wollen wir wieder einmal trinken und lustig sein, mein armer Raphael. Wohlan denn! Ich hoffe, wir werden die Sieger sein und diese Köpfe da zu unseren Füßen sehen.«
Dann zeigte er spöttisch auf die Gäste, als sie in einen hell erleuchteten Salon mit reicher Vergoldung traten, wo sie sogleich von den bemerkenswertesten jungen Leuten von Paris begrüßt wurden. Einer von ihnen hatte soeben ein neues Talent offenbart und mit seinem ersten Gemälde den glorreichen Malern der Kaiserzeit den Rang streitig gemacht. Ein anderer hatte tags zuvor ein Buch veröffentlicht, voll Kraft und Frische und einer gewissen Geringschätzung des literarisch Althergebrachten, das der modernen Schule neue Wege zeigte. Ein Stück weiter unterhielt sich ein Bildhauer, dessen ungeschlachte Züge ein kraftvolles Genie verrieten, mit einem jener kalten Spötter, die, je nachdem, Überlegenheit entweder gar nicht oder überall feststellen wollen. Da lauerte der geistreichste unserer Karikaturisten mit boshaftem Blick und spitzer Zunge, die beißenden Witzreden in Bleistiftstriche umzusetzen. Dort plauderte jener junge verwegene Schriftsteller, der wie kein anderer die Quintessenz der politischen Ideen herauszudestillieren verstand oder spielend den Gedankengehalt eines Vielschreibers resümierte, mit jenem Poeten, vor dessen Werken alle zeitgenössischen Dichtungen verblassen würden, wäre sein Talent so mächtig wie sein Haß. Beide versuchten sie, die Wahrheit und die Lüge zu umgehen, und tauschten also sanfte Schmeichelreden miteinander aus. Ein berühmter Musiker tröstete einen jungen Politiker, der vor kurzem von der Tribüne gefallen war, ohne sich ein Leids zu tun, im sentimentalen Moll mit einem spöttischen Unterton. Junge Dichter ohne Stil standen neben jungen Dichtern ohne Einfälle, poetische Prosaiker neben prosaischen Poeten. Ein junger Saint-Simonist,72 der so naiv war, an seine Lehre zu glauben, wollte voller Mitgefühl diese unvollkommenen Wesen einen, wahrscheinlich um sie zu Bekennern seines Ordens zu machen. Ferner waren zwei oder drei Männer der Wissenschaft anwesend, die ihrer Bestimmung nach immer Stickstoff in die Konversation bringen, und mehrere Vaudeville-Autoren, bereit, ihre rasch verflackernden Geistesblitze beizusteuern, welche wie das Funkeln von Diamanten weder erleuchten noch erwärmen. Einige vom Widerspruchsgeist Besessene, die sich insgeheim über jene Menschen lustig machen, die ihre Bewunderung oder Verachtung für Menschen und Dinge unverhohlen kundtun, trieben schon jene doppelzüngige Politik, mit der sie alle Systeme in Mißkredit zu bringen suchen, ohne für ein einziges Partei zu ergreifen. Der Nörgler, den nichts erstaunt, der sich in den Bouffons mitten in einer Kavatine schneuzt und dann als erster ›Bravo‹ schreit und denen widerspricht, die seiner Meinung zuvorkommen, war auch da und suchte sich den Wortschatz der geistreichen Leute anzueignen. Unter diesen Gästen waren fünf, die eine Zukunft hatten, etwa zehn, die eine flüchtige Berühmtheit erlangen sollten; was die anderen anbelangt, so galt für sie, wie für alles Mittelmäßige, die berühmte Lüge73 Ludwigs XVIII.: Eintracht und Vergessen. Der Gastgeber zeigte die besorgte Heiterkeit eines Mannes, der zweitausend Taler aufgewendet hat. Von Zeit zu Zeit blickte er ungeduldig nach der Tür des Salons, als halte er nach einem Gast Ausschau, der auf sich warten ließ. Alsbald erschien ein untersetzter kleiner Mann, der mit einer schmeichelhaften allgemeinen Bewegung begrüßt wurde; es war der Notar, der am Morgen dieses Tages die Gründung der Zeitung vollzogen hatte. Ein Kammerdiener in Schwarz schlug die Türflügel eines großen Speisesaals zurück, wo jeder ohne weitere Umstände seinen Platz an der riesigen Tafel fand. Ehe Raphael die Salons verließ, warf er einen letzten Blick darauf. Sein Wunsch war ohne Frage vollständig in Erfüllung gegangen. Seide und Gold prangte in den Gemächern. Die unzähligen Kerzen der prächtigen Kandelaber ließen die geringsten Einzelheiten der vergoldeten Friese, die feinen Ziselierungen der Bronze und die satten Farben der Möbel in hellem Lichte erstrahlen. Seltene Blumen auf Gestellen, die kunstreich aus Bambus hergestellt waren, verbreiteten liebliche Wohlgerüche. Alles, bis hin zu den Vorhängen, war von einer unaufdringlichen Eleganz; über allem lag ein gewisser poetischer Zauber, der eine starke Wirkung auf die Phantasie eines jungen mittellosen Mannes ausüben mußte.
»100 000 Livres Rente sind kein schlechter Kommentar des Katechismus und helfen uns wunderbar, die Moral in Handlungen umzusetzen!« sagte er seufzend. »Wahr und wahrhaftig, meine Tugend mag nicht zu Fuß gehen. Für mich besteht das Laster in einer Dachstube, einem abgeschabten Rock, einem grauen Hut im Winter und Schulden beim Portier. Ah! ich will in diesem Luxus ein Jahr, sechs Monate nur leben, gleichviel! Und dann – sterben! Wenigstens werde ich dann tausend Leben gekannt, erschöpft, genossen haben!«
»Oh!« sagte Émile, der ihm zugehört hatte, »du hältst das Coupé eines Wechselmaklers für Glück. Ach! du wärest des Goldes bald überdrüssig, wenn du sähest, daß es dir die Möglichkeit raubt, ein überragender Mensch zu sein. Hat der Künstler zwischen der Armut des Reichtums und den Reichtümern der Armut je geschwankt? Braucht unsereins denn nicht immer Kämpfe? Übrigens, rüste deinen Magen zum Angriff!« fügte er hinzu und wies ihm mit einer heroischen Gebärde den majestätischen, dreimal gebenedeiten und verheißungsvollen Anblick, den der Speisesaal des gesegneten Kapitalisten darbot. »Dieser Mensch da«, fuhr er fort, »hat sich doch wahrhaftig Mühe gegeben, sein Geld nur um unsretwillen zusammenzuscharren. Ist er nicht eine Art Schwamm von der Gattung der Polypen, einer, der von den Naturforschern übersehen worden ist und den es mit Raffinesse auszuquetschen gilt, bevor ihn die Erben aussaugen? Findest du nicht, daß die Basreliefs an den Wänden Stil haben? Und die Lüster, die Gemälde, welch geschmackvoller Luxus! Wenn man den Neidern und denjenigen, die hinter die Kulissen gucken, Glauben schenken darf, so hätte dieser Mann während der Revolution einen Deutschen und noch einige andere Personen, seinen besten Freund – so sagt man – und die Mutter dieses Freundes, umgebracht. Kannst du solchen Verbrechen unter den ergrauenden Haaren dieses ehrwürdigen Taillefer Platz einräumen? Er sieht wie ein sehr gutmütiger Mensch aus. Sieh nur, wie das Silbergeschirr funkelt; und jeder glänzende Strahl sollte für ihn ein Dolchstoß sein? … Nicht doch! Ebensogut könnte man an Mohammed glauben. Wenn jene Leute recht hätten, so würden sich hier dreißig edelgeartete Männer anschicken, die Eingeweide einer Familie zu verspeisen und ihr Blut zu trinken. Und wir beiden jungen treuherzigen Enthusiasten sollten an diesem Greuel teilhaben! Ich habe große Lust, unsern Kapitalisten zu fragen, ob er ein anständiger Mensch ist.«
»Nein, nicht jetzt!« rief Raphael, »erst wenn er volltrunken ist; dann werden wir zumindest schon gespeist haben.«
Die beiden Freunde nahmen lachend Platz. Mit einem Blick, der dem Wort zuvorkam, entrichtete zuerst jeder Gast dem prächtigen Anblick seinen Tribut an Bewunderung; die lange Tafel war mit einem schneeweißen Tuch bedeckt, auf dem die Gedecke symmetrisch angeordnet und von goldbraunen Brötchen gekrönt waren. Die Kristallgläser spiegelten mit ihren glitzernden Reflexen die Farben des Regenbogens, die Kerzen zeichneten ein Kreuzfeuer bis ins Unendliche, die unter Silberdeckeln aufgetragenen Speisen reizten den Appetit und die Neugierde. Es wurde wenig gesprochen. Die Tischnachbarn sahen sich gegenseitig an. Der Madeira kreiste. Dann erschien der erste Gang in seiner ganzen Glorie; er hätte dem seligen Cambacérès74 zur Ehre gereicht, und Brillat-Savarin75 hätte ihn höchlich gepriesen. Bordeaux und Burgunder, weißer und roter, wurden mit königlicher Verschwendung ausgeschenkt. Der erste Teil dieses Festmahls war in jedem Punkt der Exposition einer klassischen Tragödie vergleichbar. Der zweite Akt wurde etwas geschwätzig. Die Gäste hatten gehörig getrunken, wobei sie die Weine je nach Laune wechselten, so daß sich in dem Augenblick, als man die Reste dieses lukullischen Mahles abtrug, bereits die lebhaftesten Auseinandersetzungen entsponnen hatten. Blasse Stirnen röteten sich, Nasen färbten sich purpurn, die Gesichter flammten, die Augen funkelten. Während dieser Morgenröte der Trunkenheit überschritt die Unterhaltung noch nicht die Grenzen des Anstands, aber Neckereien und Witzeleien entfuhren nach und nach jedem Munde; dann hob die Verleumdung ganz leise ihren kleinen Schlangenkopf und sprach mit flötender Stimme; ein paar Duckmäuser horchten gespannt auf und hofften, ihre Nüchternheit wahren zu können. Der zweite Gang fand die Geister also schon ganz erhitzt. Jeder aß beim Sprechen, sprach beim Essen, jeder trank, ohne der Menge zu achten, die ihm da durch die Kehle floß, so wohlschmeckend und aromatisch war der Wein, so ansteckend wirkte das Beispiel. Taillefer setzte seinen Stolz darein, die Gäste anzufeuern, und ließ nun die schweren Rhôneweine, den feurigen Tokaier, den berauschenden alten Roussillon auftragen. Wie frisch eingespannte Postpferde ließen dann alle diese Männer, von der prickelnden Glut des ungeduldig erwarteten, nun überreichlich genossenen Champagners aufgepeitscht, ihren Geist in leeres Gerede hineingaloppieren, auf das niemand hört; sie fingen an, jene Geschichten zu erzählen, die keine Zuhörer finden; wiederholten hundertmal jene Fragen, die unerwidert bleiben. Das Gelage allein entfaltete seine laute Stimme, eine Stimme aus hundertfältigem verworrenen Geschrei, die ins Grandiose anschwillt wie ein Crescendo von Rossini.76 Dann kamen die verfänglichen Tischreden, die Prahlereien, die Herausforderungen. Alle begaben sich ihrer geistigen Fähigkeiten, um dafür die von Fässern, Tonnen und Zubern anzunehmen. Scheinbar hatte jeder zwei Stimmen. Es kam ein Moment, wo die Herren alle auf einmal redeten und die Diener lächelten. Aber in diesem Wirrwarr von Worten, wo paradoxe Meinungen und grotesk kostümierte Wahrheiten durch das Geschrei, durch die unbewiesenen Behauptungen und selbstherrlichen Urteile hindurch aufeinanderprallten, wie im Schlachtgetümmel Kanonen-, Gewehr- und Kartätschenkugeln sich kreuzen, hätte sicherlich einen Philosophen der ausgefallenen Gedanken wegen interessiert, hätte einen Politiker durch die bizarren Ansichten überrascht. Das war ein Buch und ein Bild zugleich. Philosophien, Religionen, Moral, so verschieden von einem Breitengrad zum anderen, Regierungen, kurz, alle großen Betätigungen der menschlichen Vernunft fielen unter einer Sense, die so scharf hieb wie die der Zeit, und es wäre schwer zu entscheiden gewesen, ob sie von trunkener Weisheit oder von weise und hellsichtig gewordener Trunkenheit geschwungen wurde. Von einem Sturm fortgerissen, schienen diese Geister, gleich dem Meer, das gegen seine felsige Küste antobt, alle Gesetze, zwischen denen die Zivilisationen wogen, erschüttern zu wollen und entsprachen so unwissentlich dem Willen Gottes, der das Gute und Böse in der Natur geschehen läßt und das Geheimnis ihres immerwährenden Kampfes für sich behält. Der Streit, so grimmig und burlesk er war, wurde zu einer Art Hexensabbat der Geister. Die ganze Kluft, die das 19. Jahrhundert vom 16. trennt, klaffte zwischen den trübseligen Späßen dieser Kinder der Revolution bei der Entstehung einer Zeitung und den Reden der lustigen Zecher bei der Geburt des Gargantua. Jenes schickte sich lachend zu einer Zerstörung an, das unsere lacht inmitten eines Trümmerhaufens.
»Wie heißt der junge Mann, den ich da unten sehe?« fragte der Notar und deutete auf Raphael. »Ich glaubte ihn Valentin nennen zu hören?« »Was reden Sie da kurzweg von Valentin?« rief Émile lachend. »Raphael de Valentin, wenn ich bitten darf! Wir tragen einen goldenen Adler im schwarzen Feld, mit einer silbernen Krone, Schnabel und Krallen rot, mit der schönen Devise: Non cecidit animus!77 Wir sind kein Findelkind, sondern der Abkömmling des Kaisers Valens, des Stammvaters der Valentinois, des Gründers der Städte Valencia in Spanien und Valence in Frankreich, rechtmäßiger Erbe des Oströmischen Reiches. Wenn wir Mahmud in Konstantinopel herrschen lassen, so aus reiner Gutmütigkeit und aus Mangel an Geld und Soldaten.«
Émile beschrieb mit seiner Gabel in der Luft eine Krone über dem Kopf Raphaels. Der Notar besann sich eine Weile und machte sich dann wieder ans Trinken, indem er durch eine bezeichnende Gebärde andeutete, daß es ihm unmöglich sei, die Städte Valence und Valencia, Konstantinopel, Mahmud, Kaiser Valens und die Familie der Valentinois unter seine Klientel zu bringen.
»Ist die Zerstörung dieser Ameisenhaufen, namens Babylon, Tyrus, Karthago oder Venedig, die unter den Füßen eines darüber hinwegschreitenden Riesen zertreten worden sind, nicht eine dem Menschen von einer spottliebenden Macht erteilte Mahnung?« fragte Claude Vignon, eine Art gekaufter Sklave, der für zehn Sous die Zeile Weisheiten à la Bossuet78 verzapfte.
»Moses, Sulla, Ludwig XI., Richelieu, Robespierre und Napoleon sind vielleicht ein und derselbe Mann, der in verschiedenen Epochen wie ein Komet am Himmel wieder erscheint«, antwortete ein Anhänger von Ballanche.79
»Wozu die Vorsehung ergründen wollen?« versetzte Canalis, ein Balladenfabrikant.
»Oh, was die Vorsehung angeht!« unterbrach ihn der Nörgler; »ich kenne in der Welt keinen Begriff, der dehnbarer ist.«
»Was wollen Sie, Monsieur! Ludwig XIV. hat, um die Wasserleitungen80 von Maintenon graben zu lassen, mehr Menschen ums Leben gebracht als der Konvent,81 um die Steuern gerecht zu verteilen, die Vereinheitlichung der Gesetze herzustellen, Frankreich zu nationalisieren und die Erbschaften gleichmäßig zu verteilen«, sagte Massol, der Republikaner geworden war, weil ihm ein Wörtchen vor seinem Namen fehlte.
»Monsieur«, wandte sich Moreau de l’Oise, ein Großgrundbesitzer, an ihn, »da Sie Blut für Wein halten, werden Sie denn diesmal jedem seinen Kopf auf den Schultern lassen?«
»Wozu denn, mein Bester? Sind die Grundsätze der sozialen Ordnung nicht ein paar Opfer wert?«
»Bixiou, he! Der Dingsda, der Republikaner, behauptet, daß der Kopf dieses Grundbesitzers ein Opfer wäre«, sagte ein junger Mann zu seinem Nachbarn.
»Menschen und Ereignisse sind nichts«, setzte der Republikaner, von Schluckauf unterbrochen, seine Theorie fort; »in der Politik und der Philosophie gibt es nur Prinzipien und Ideen.«
»Wie grauenhaft! So hätten Sie kein Bedenken, Ihre Freunde für ein ›wenn‹ zu töten? …«
»Ach was, Monsieur! Der Mensch, der Gewissensbisse hat, ist der wahre Bösewicht, denn er hat einen Begriff von der Tugend; während Peter der Große und der Herzog Alba Systeme waren, und der Korsar Monbard82 eine Organisation.«
»Aber kann die Gesellschaft nicht auch ohne eure Systeme und Organisationen bestehen?« fragte Canalis.
»Oh, selbstverständlich!« rief der Republikaner.
»Mir wird ganz übel von eurer stumpfsinnigen Republik! Man kann nicht in Ruhe einen Kapaun zerlegen, ohne an das Agrargesetz zu denken.«
»Deine Prinzipien sind vortrefflich, mein kleiner trüffelgespickter Brutus! Aber du bist genau wie mein Kammerdiener: der Kerl ist so grausam vom Reinlichkeitsfimmel besessen, daß ich, wenn ich ihn meine Kleider nach seinem Gutdünken bürsten ließe, nackt gehen müßte.«
»Ihr seid unvernünftige Tröpfe! Ihr wollt eine Nation mit Zahnstochern säubern«, erwiderte der Republikaner. »Wenn man euch so hört, wäre die Justiz gefährlicher als die Räuber.«
»Holla!« rief der Advokat Desroches.
»Sind die langweilig mit ihrer Politik!« sagte Cardot, der Notar. »Hört mir auf davon! Keine Wissenschaft noch Tugend ist einen Tropfen Blut wert. Wenn wir der Wahrheit die Rechnung aufstellen wollten, fänden wir sie vielleicht bankrott.«
»Ach! Es hätte sicher weniger gekostet, uns im schlimmen zu amüsieren, als uns im guten herumzustreiten. Ich gäbe alle Reden, die seit 40 Jahren auf der Tribüne gehalten worden sind, für eine Forelle, eine Erzählung von Perrault83 oder eine Skizze von Charlet.«84
»Sie haben vollkommen recht! Reichen Sie mir die Spargel. Denn schließlich und endlich zeugt die Freiheit Anarchie, die Anarchie führt zum Despotismus und der Despotismus wieder zur Freiheit. Millionen Menschen sind ums Leben gekommen, ohne einem einzigen dieser Systeme Dauer zu verschaffen. Ist das nicht der Circulus vitiosus,85 in welchem sich die moralische Welt von jeher bewegt? Wenn der Mensch glaubt, etwas vervollkommnet zu haben, hat er die Dinge nur an eine andere Stelle gerückt.«
»Oha!« rief Cursy, der Vaudevilledichter, »dann, Messieurs, trinke ich auf Karl X.,86 den Vater der Freiheit!«
»Warum nicht?« sagte Émile. »Wenn der Despotismus in den Gesetzen ist, findet sich die Freiheit in den Sitten, und vice versa.«87
»Trinken wir also auf die Dummheit der Macht, die uns so viel Macht über die Dummköpfe gibt!« sagte der Bankier.
»Nun, mein Lieber, Napoleon hat uns wenigstens Ruhm gebracht!« meinte ein Marineoffizier, der niemals aus Brest herausgekommen war.
»Ach, der Ruhm! Eine traurige Ware. Er kostet viel und hält sich nicht. Ob der Ruhm nicht das egoistische Ziel der großen Männer ist, wie Glück das der Dummen?«
»Monsieur, Sie sind sehr glücklich.«
»Der erste, der Trennungsgräben zog, war gewißlich ein schwacher Mensch, denn die Gesellschaft profitiert nur von den Elenden. Die beiden äußersten Pole der moralischen Welt, der Denker und der Wilde, verachten gleicherweise den Besitz.«
»Nett das!« rief Cardot; »wenn es kein Eigentum gäbe, wie könnten wir Protokolle machen?«
»Das sind unglaublich köstliche Erbsen!«
»Und der Pfarrer wurde am Tag darauf tot in seinem Bett gefunden …«
»Wer spricht vom Tod? Machen Sie keine Scherze! Ich habe einen Onkel.«
»Sie würden es sicher ertragen, ihn zu verlieren.«
»Keine Frage.«
»Hören Sie, Messieurs! ›Die rechte Art, seinen Onkel umzubringen.‹ Ruhe! (Hört, hört!) Man habe einen dicken fetten Onkel, mindestens siebzigjährig, das sind die besten Onkel. (Bewegung.) Man gebe ihm unter irgendeinem Vorwand eine fette Gänseleberpastete zu essen . .«
»Ach, mein Onkel ist leider zäh, dürr, geizig und sehr mäßig.«
»Ja, solche Onkel sind Ungeheuer, die das Leben mißbrauchen.«
»Und während er verdaut«, fuhr der Mann mit den Onkeln fort, »melden Sie ihm den Konkurs seines Bankiers.«
»Und wenn er das übersteht?«
»So hetzen Sie ein hübsches Mädchen auf ihn!«
»Wenn er aber …?« meinte der andere mit einer verneinenden Gebärde.
»Dann ist es kein Onkel. Die Onkel sind in der Regel lebenslustig.«
»Die Stimme der Malibran88 hat zwei Töne eingebüßt.«
»Ach, bewahre.«
»Aber gewiß doch, Monsieur.«
»Oh, oh! Ja und nein, ist das nicht die Geschichte aller religiösen, politischen und literarischen Abhandlungen? Der Mensch ist ein Schalksnarr, der über Abgründen tanzt!«
»Nach Ihrer Meinung wäre ich also ein Dummkopf?«
»Im Gegenteil, Sie verstehen mich bloß nicht.«
»Bildung, schöner Unsinn! Monsieur Heineffettermach gibt die Zahl der gedruckten Bücher mit mehr als einer Milliarde an, und das Leben eines Menschen erlaubt ihm nicht, 150 000 davon zu lesen. Erklären Sie mir also, was das Wort ›Bildung‹ bedeutet? Für die einen besteht die Bildung darin, die Namen des Pferdes von Alexander, der Dogge Berecillo, des Seigneur des Accords zu kennen, und von dem Manne nichts zu wissen, dem wir das Flößen des Holzes oder das Porzellan verdanken. Für die anderen ist ›gebildet sein‹ ein Testament verbrennen und als geachtete, angesehene Leute zu leben, anstatt rückfällig zu werden, eine Uhr zu stehlen und mit den fünf erschwerenden Umständen entehrt und gehaßt auf der Place de Grève zu enden.«
»Wird Nathan überdauern?«
»Nun, seine Mitarbeiter haben sehr viel Geist.«
»Und Canalis?«
»Das ist ein großer Mann, reden wir nicht mehr von ihm.«
»Ihr seid betrunken!«
»Die unmittelbare Folge einer Konstitution ist die Verflachung der Geister. Künste, Wissenschaften, Bauwerke, alles wird von einem entsetzlichen Egoismus, der Lepra unserer Zeit, zerfressen. Eure 300 Bürger, die auf Bänken hocken, werden nur daran denken, Pappeln zu pflanzen. Der Despotismus verrichtet illegal große Dinge, die Freiheit macht sich nicht einmal die Mühe, sehr kleine auf legale Weise zu tun.«
»Eure allgemeine Bildung fabriziert 100-Sous-Stücke aus Menschenfleisch«, unterbrach sie ein Anhänger des Absolutismus. »Die Individualitäten verschwinden bei einem Volk, das durch Bildung nivelliert ist.«
»Ist es denn aber nicht der Zweck der Gesellschaft, einem jeden den Wohlstand zu verschaffen?« fragte der Saint-Simonist.
»Wenn Sie 50 000 Livres Rente hätten, würden Sie nicht ans Volk denken. Wenn Sie von einer so edlen Leidenschaft für die Menschheit ergriffen sind, gehen Sie nach Madagaskar: dort finden Sie ein ganz neues nettes kleines Volk, was Sie noch saint-simonisieren, klassifizieren, in Glasgefäße sperren können; aber hier hat jeder seine Hülle, in die er ganz natürlich hineinpaßt wie ein Pfropf ins Spundloch. Die Portiers sind Portiers, und die Tröpfe sind Tröpfe, ohne erst von einem Bischofskollegium dazu ernannt zu werden. Haha!«
»Sie Sind Karlist!«
»Warum nicht? Ich liebe den Despotismus. Er zeugt von einer gewissen Verachtung der menschlichen Rasse. Ich hasse die Könige nicht. Sie sind so spaßig. In einer Kammer auf dem Thron zu sitzen, dreißig Millionen Meilen von der Sonne entfernt, ist das gar nichts?«
»Fassen wir nun diese große Übersicht über die Zivilisation zusammen«, sagte der Gelehrte, der zur Belehrung des unaufmerksamen Bildhauers ein Gespräch über den Anfang der Gesellschaften und die autochthonen Völker geführt hatte. »Als die Völker sich herausbildeten, war die Macht gewissermaßen materiell, unteilbar und roh; mit der ständig wachsenden Zahl der Menschen haben die Regierungen dann allmählich eine mehr oder weniger geschickte Teilung der ursprünglichen Macht vorgenommen. Im frühen Altertum herrschte die Theokratie; der Priester führte das Schwert und das Weihrauchfaß. Später gab es zwei heilige Ämter: den Pontifex und den König. Heute, am Endpunkt der Zivilisation, hat unsere Gesellschaft die Macht den Einflußbereichen gemäß aufgeteilt, und wir haben nun Machtgruppen, die da heißen: Industrie, Gedanke, Geld, Wort. Die Macht, die keine Einheit mehr hat, schreitet unaufhörlich einer sozialen Auflösung entgegen, der nur noch vom Eigennutz eine Schranke gesetzt wird. Demnach stützen wir uns weder mehr auf die Religion noch auf die materielle Gewalt, sondern auf den Verstand. Wiegt das Buch das Schwert auf, das Wort die Tat? Das ist das Problem.«
»Der Verstand hat alles getötet!« rief der Karlist. »Hören Sie auf, die unbeschränkte Freiheit führt die Völker zum Selbstmord, sie langweilen sich in ihrem Triumph wie ein englischer Millionär.«
»Was sagen Sie uns Neues? Heutzutage findet man jegliche Macht lächerlich, und das ist ebenso üblich geworden, wie Gott zu leugnen. Man hat keinen Glauben mehr. Darum ist auch das Jahrhundert wie ein alter Sultan der Ausschweifung erlegen. Schließlich hat euer Lord Byron in letzter poetischer Verzweiflung die Leidenschaft des Verbrechens besungen.«
»Wissen Sie«, antwortete ihm der volltrunkene Bianchon, »daß uns ein Gran Phosphor mehr oder weniger zum Genie oder Bösewicht, zum Mann von Geist oder zum Idioten, zum tugendhaften Menschen oder zum Verbrecher macht?«
»Kann man so von Tugend reden?« rief Cursy; »der Tugend, dem Gegenstand aller Theaterstücke, der Lösung aller Dramen, dem Fundament aller Gerichtshöfe.«
»Ach! schweig doch, du Esel! Deine Tugend ist Achilles ohne Ferse!« sagte Bixiou.
»Wein her!«
»Willst du wetten, daß ich eine Flasche Champagner in einem Zug austrinke?«
»Welch ein Zug von Geist!« rief Bixiou.
»Sie sind blau wie Fuhrknechte«, sagte ein junger Mann, der mit ernster Miene seiner Weste zu trinken gab.
»Ja, Verehrter, die gegenwärtige Regierung repräsentiert die Kunst, die öffentliche Meinung herrschen zu lassen.«
»Die öffentliche Meinung? Das ist doch eine ganz lasterhafte käufliche Dirne. Wenn man euch Männern der Moral und Politik zuhört, so müßte man stets eure Gesetze der Natur, die öffentliche Meinung dem Gewissen vorziehen. Geht mir, alles ist wahr, alles ist falsch! Wenn uns die Gesellschaft die Daunen zu Kopfkissen gab, so hat sie diese Wohltat sicherlich durch die Gicht quitt gemacht, so wie sie uns die Prozeßordnung zur Einschränkung der Gerechtigkeit und den Schnupfen als Folgeerscheinung des Kaschmirschals gebracht hat.«
»Ungeheuer!« rief Émile und unterbrach den Menschenfeind, »wie kannst du die Zivilisation angesichts dieser Weine, dieser köstlichen Speisen, mit denen du dich vollgeschlagen hast, schmähen? Friß dieses Reh samt den vergoldeten Läufen und Hörnern, nicht aber deine Mutter.«
»Ist es meine Schuld, wenn der Katholizismus schließlich dahin kommt, eine Million Götter in einen Mehlsack zu stecken, wenn die Republik immer auf einen Napoleon hinausläuft, wenn das Königtum zwischen der Ermordung Heinrichs IV.89 und der Hinrichtung Ludwigs XVI. sitzt, wenn der Liberalismus zu La Fayette90 wird? Haben Sie sich ihm im Juli angeschlossen?«
»Nein.«
»Dann schweigen Sie, Skeptiker!«
»Die Skeptiker sind die gewissenhaftesten Menschen.«
»Sie haben kein Gewissen.«
»Was sagen Sie da? Sie haben mindestens zwei.«
»Den Himmel diskontieren! Sehen Sie, das ist eine wahrhaft kaufmännische Idee. Die antiken Religionen waren nur eine glückliche Entwicklung der physischen Lust; aber wir, wir haben die Seele und die Hoffnung entwickelt; das ist Fortschritt.«
»Ach, meine lieben Freunde, was können Sie von einem mit Politik gemästeten Jahrhundert erwarten?« sagte Nathan; »was war das Schicksal der ›Geschichte des Königs von Böhmen und seiner sieben Schlösser‹,91 dieses reizenden Entwurfs …«
»Was?« rief der Krittler vom andern Ende der Tafel »das sind hohle Phrasen, auf gut Glück aus dem Hutfutter herausgezogen, ein Machwerk für die Irren in Charenton.«92
»Sie sind ein Hohlkopf!«
»Sie sind ein Narr!«
»Oh, oh!«
»Ah, ah!«
»Sie werden sich schlagen.«
»Nein.«
»Auf morgen, Monsieur.«
»Nein, sofort«, erwiderte Nathan.
»Los doch! Ihr seid zwei mutige Streiter.«
»Sie sind auch einer«, sagte der Herausforderer.
»Sie können sich nur nicht mehr gerade halten.«
»Wie, halte ich mich etwa nicht gerade?« rief der kampfeslustige Nathan, indem er sich schwankend wie ein Papierdrache erhob.
Er warf einen stumpfsinnigen Blick auf den Tisch; dann fiel er, wie entkräftet von dieser Anstrengung, in seinen Stuhl zurück, ließ den Kopf hängen und verstummte ganz.
»Wäre es nicht spaßhaft«, sagte der Nörgler zu seinem Nachbarn, »mich wegen eines Buches zu schlagen, das ich weder gesehen noch gelesen habe?«
»Émile, nimm deinen Rock in acht, dein Nachbar wird ganz blaß.«
»Kant, Monsieur? Auch so ein Ballon, den man aufsteigen ließ, um die Flachköpfe zu amüsieren. Materialismus und Spiritualismus, das sind zwei hübsche Rackets, mit denen Scharlatane in Roben denselben Ball schlagen. Ob Gott in allem sei, wie Spinoza sagt, oder ob alles von Gott kommt, wie Sankt Paulus sagt … Dummköpfe! Eine Tür öffnen oder schließen, ist das nicht dieselbe Bewegung? Kommt das Ei von der Henne oder die Henne vom Ei? (Reichen Sie mir mal den Entenbraten!) Das ist die ganze Wissenschaft.«
»Einfaltspinsel! rief ihm der Gelehrte zu, »die Frage, die du stellst, ist durch ein Faktum entschieden.«
»Welches?«
»Sind die Lehrstühle der Professoren für die Philosophie da oder aber die Philosophie für die Lehrstühle? Setz deine Brille auf und lies das Budget.«
»Spitzbuben!«
»Schafsköpfe!«
»Gauner!«
»Narren!«
»Wo anders als in Paris fände man einen so lebhaften und zügigen Gedankenaustausch«, rief Bixiou mit feierlichem Baß.
»Komm, Bixiou, führe uns mal eine klassische Posse vor. Los, improvisiere etwas!«
»Soll ich euch das 19. Jahrhundert vorführen?«
»Hört zu!«
»Ruhe!«
»Legt euren Mäulern Dämpfer an!«
»Wirst du den Mund halten, du komischer Kauz!«
»Gebt ihm Wein, damit das Kind Ruhe gibt!«
»Also los, Bixiou!«
Der Künstler knöpfte seinen schwarzen Rock bis zum Kragen zu, zog seine gelben Handschuhe an und fing an, mit schielenden Augen die ›Revue des Deux Mondes‹93 zu parodieren. Aber der Lärm übertönte seine Stimme, und es war unmöglich, ein einziges Wort seiner Spötterei zu vernehmen. Wenn er auch nicht das Jahrhundert darstellte, so veranschaulichte er doch die ›Revue‹, denn er verstand sich selbst nicht.
Das Dessert war wie durch Hexerei aufgetragen worden. Auf dem Tisch prunkte ein riesenhafter Tafelaufsatz aus vergoldeter Bronze, aus den Werkstätten Thomires. Hohe Figuren, denen von einem berühmten Künstler die in Europa anerkannten Formen des Schönheitsideals verliehen worden waren, stützten und hielten Büschel von Erdbeeren, von Ananas, frischen Datteln, gelben Trauben, rosigen Pfirsichen, Orangen, die mit dem Schiff aus Setubal gekommen waren, mit Granatäpfeln, Früchten aus China, kurz, allen Überraschungen des Luxus, Wundern an Konfekt, den leckersten Delikatessen, den verlockendsten Leckerbissen. Die Farben dieser kulinarischen Gemälde wurden noch gehoben durch den Glanz des Porzellans, mit seinen funkelnden goldenen Ornamenten und schön geschwungenen Rändern. Anmutig wie die Schaumkämme des Ozeans, grün und leicht, krönte süße Creme Landschaften von Poussin, die in Sèvres kopiert worden waren. Ein deutsches Fürstentum hätte nicht hingereicht, diesen vermessenen Aufwand zu bezahlen. Silber, Perlmutter, Gold, Kristall waren noch einmal in neuen Formen verschwendet; aber die benebelten Blicke und der fiebrige Wortschwall des Rausches gestatteten den Gästen kaum, diese eines orientalischen Märchens würdige Feenpracht auch nur vage wahrzunehmen. Die Dessertweine verbreiteten ihren Duft und ihre Glut, die starken Liebestränken, magischen Dämpfen gleich im Hirn eine Art sinnverwirrende Wahnbilder erzeugen, die Beine lähmen und die Hände schwer wie Blei werden lassen. Die Früchte-Pyramiden wurden geplündert, die Stimmen schwollen an, der Tumult nahm zu. Man konnte kein Wort mehr unterscheiden, Gläser zersprangen, Gelächter barst los wie Raketen; Cursy ergriff ein Horn und schmetterte einen Tusch. Das war, als hätte der Teufel der tobenden Menge ein Zeichen gegeben; man johlte, pfiff, sang, schrie, heulte, grunzte. Es war lachhaft, wie Leute, die von Natur heiter waren, finster wurden wie der Schluß eines Dramas von Crébillon94 oder träumerisch wie Matrosen in einem Reisewagen. Die Durchtriebenen verrieten ihre Geheimnisse den Neugierigen, die gar nicht zuhörten. Die Melancholischen lächelten wie Tänzerinnen am Schluß ihrer Pirouetten. Claude Vignon wiegte sich täppisch wie ein Bär im Käfig. Enge Freunde prügelten sich. Die in menschlichen Gesichtern auftretenden Ähnlichkeiten mit Tieren, von den Physiologen eifrig bewiesen, kamen in den Gebärden, in den Haltungen der Körper zum Vorschein. Ein Bichat,95 der kühl und nüchtern das mit angesehen hätte, hätte hier treffliche Studien machen können. Der Hausherr, der sich berauscht fühlte und nicht aufzustehen wagte, bemühte sich, eine anständige und gastfreundliche Miene zu wahren, und billigte mit einer starren Grimasse alle Übergriffe seiner Gäste. Sein breites, inzwischen rot und blau, ja beinahe violett gewordenes Gesicht, das fürchterlich anzusehen war, nahm in krampfhaften Anstrengungen, die dem Schlingern und Schwanken einer Brigg vergleichbar waren, an dem allgemeinen Trubel teil.
»Haben Sie sie umgebracht?« fragte ihn Émile.
»Es heißt, die Todesstrafe soll infolge der Julirevolution abgeschafft werden«, antwortete Taillefer, der seine Brauen mit einer verschlagenen und zugleich einfältigen Miene hochzog.
»Sehen Sie sie denn nicht manchmal im Traum?« fragte Raphael.
»Es ist ja längst verjährt«, erwiderte der im Golde schwimmende Mörder.
»Und auf sein Grab«, rief Émile hämisch, »wird der Friedhofswärter die Inschrift setzen lassen: ›Die ihr vorübergeht, weiht seinem Andenken eine Träne!‹ Oh!« fuhr er fort, »ich gäbe dem Mathematiker, der mir die Existenz der Hölle durch eine algebraische Gleichung beweisen kann, gut und gern 100 Sous.«
Er warf ein Geldstück in die Höhe und rief: »Kopf für Gott!«
»Sieh nicht hin!« sagte Raphael und fing die Münze auf.
»Was weiß man schon? Der Zufall ist ein Spaßvogel.«
»Leider!« seufzte Émile mit komisch bekümmerter Miene. »Ich sehe nicht, wohin ich zwischen der Geometrie des Ungläubigen und dem Paternoster des Papstes die Füße setzen soll. Pah! laß uns trinken! Trinken ist, glaube ich, das Orakel der göttlichen Flasche und das Schlußwort des Pantagruel.«96
»Wir verdanken dem Paternoster«, antwortete Raphael, »unsere Künste, unsere Denkmäler, vielleicht sogar unsere Wissenschaften, und eine noch größere Wohltat: unsere modernen Regierungen, in welchen eine große und fruchtbare Gesellschaft vortrefflich von fünfhundert aufgeklärten Geistern repräsentiert wird, unter denen die opponierenden Kräfte einander aufheben und alle Macht der Zivilisation überlassen, der gigantischen Königin, die den König ersetzt, jenes alte Schreckgespenst, das Schicksal spielte und das die Menschen zwischen sich und den Himmel gesetzt hatten. Angesichts so vieler vollendeter Werke erscheint der Atheismus wie ein zeugungsunfähiges Gerippe. Was meinst du dazu?«
»Ich denke an die Ströme von Blut, die der Katholizismus vergossen hat«, sagte Émile kalt. »Aus unseren Herzen und unseren Adern hat er eine zweite Sintflut über die Welt gebracht. Aber gleichviel! Jeder denkende Mensch soll unter dem Banner Christi marschieren. Er allein hat den Triumph des Geistes über die Materie geheiligt, er allein hat uns mit poetischer Kraft die Welt enthüllt, die uns von Gott trennt.«
»Glaubst du?« antwortete Raphael mit einem seltsamen trunkenen Lächeln. »Nun denn, um uns nicht zu kompromittieren, bringen wir den berühmten Toast aus: Diis ignotis!«97
Und sie leerten ihre Becher voll Wissen, Kohlensäure, Wohlgerüche, Poesie und Ungläubigkeit.
»Wenn Messieurs sich in den Salon begeben wollen, der Kaffee erwartet sie dort«, sagte der Haushofmeister.
In diesem Augenblick schwebten fast alle Gäste in jenen Regionen der Seligkeit, wo das Licht des Geistes erlischt und der Körper, seines Tyrannen entledigt, sich dem Freudentaumel der Freiheit überläßt. Die einen blieben auf dem Höhepunkt der Trunkenheit trübsinnig und quälten sich, einen Gedanken zu fassen, der ihnen ihre eigene Existenz verbürgte; die anderen, in die Stumpfheit einer trägen Verdauung versunken, scheuten jede Bewegung. Beharrliche Redner stammelten noch undeutliche Worte, deren Sinn ihnen selbst entging. Ein paar Refrains wurden abgeleiert wie ein Uhrwerk, das seine künstliche seelenlose Stimme austönen lassen muß. Schweigen und Lärm hatten sich absonderlich gepaart. Trotzdem erhoben sich die Gäste, als sie die helle Stimme des Dieners vernahmen, der ihnen anstelle des Hausherrn neue Genüsse ankündigte, und schleppten, stützten, trugen sich gegenseitig fort. Die ganze Schar blieb einen Augenblick lang gebannt und entzückt auf der Türschwelle stehen. Die außergewöhnlichen Genüsse des Festmahls verblaßten vor dem berückenden Schauspiel, das der Gastgeber dem wollüstigsten ihrer Sinne bot. Unter den strahlenden Kerzen eines goldenen Kronleuchters, um eine mit vergoldetem Silber gedeckte Tafel sahen die abgestumpften Gäste, deren Augen sich bald lüstern entzündeten, eine Gruppe Frauen. Blendend war der Schmuck, doch blendender noch all diese Schönheiten, vor denen alle Wunder dieses Palastes dahinschwanden. Die glühenden Blicke dieser Mädchen, so wunderschön wie Feen, funkelten lebhafter als die Ströme des Lichts, in welchem die seidigen Reflexe der Stoffe, das leuchtende Weiß des Marmors und die feinen Rundungen der Bronzen schimmerten. Das Herz entflammte, die Kontraste ihres wogenden Kopfputzes und ihre Haltungen zu sehen, die in ihrem Reiz und ihrer Eigenart so verschieden waren. Es war eine Blumenhecke, in die Rubine, Saphire und Korallen gewunden waren; man sah schwarze Halsbänder auf schneeigen Hälsen, lose Schärpen, die wie ein Leuchtturmfeuer aufflatterten, stolze Turbane, schlichte, herausfordernde Tuniken. Dieses Serail bot Verführungen für alle Augen, reizte jede Phantasie. Eine Tänzerin in entzückender Haltung schien hüllenlos unter den fließenden Falten eines Kaschmirgewandes. Mal durchscheinende Gaze, mal schillernde Seide verbarg oder verriet geheimnisreiche Vollkommenheiten. Kleine schmale Füße sprachen von Liebe, frische rote Lippen waren stumm. Zarte, sittsame junge Mädchen von täuschender Unschuld mit sanften Madonnenscheiteln boten sich den Augen wie Erscheinungen, die ein Hauch hinwegwehen konnte. Aristokratische Schönheiten mit hochmütigem Blick und lässiger Haltung, aber schlank, zart gebaut und anmutig, neigten den Kopf, als hätten sie noch königliche Gunst zu vergeben. Eine Engländerin, eine keusche ätherische Gestalt, wie aus Ossians98 Wolken herabgestiegen, glich einem Engel der Melancholie, dem Gewissen, das das Verbrechen flieht. Die Pariserin, deren ganze Schönheit in einer unbeschreiblichen Grazie liegt, eitel auf ihre Toilette und auf ihren Geist, gewappnet mit ihrer allmächtigen Schwäche, schmiegsam und hart, eine herzlose, leidenschaftslose Sirene, die die Gluten der Leidenschaft und die Sprache des Herzens kunstvoll vorzutäuschen versteht, fehlte nicht in dieser gefährlichen Versammlung, in der auch Italienerinnen, ruhig von Anschein und aufrichtig in ihrem Glück, üppige Normanninen mit prachtvollen Formen, südländische Frauen mit schwarzen Haaren und schön geschnittenen Augen zu finden waren. Es war, als hätte Lebel99 alle Schönheiten von Versailles zusammengetrommelt, die seit dem frühen Morgen ihre Fallstricke bereithielten und nun wie eine Schar orientalischer Sklavinnen auf Befehl des Händlers herbeigekommen waren, um mit dem Tagesgrauen wieder zu verschwinden. Sie blieben wortlos, verschämt und drängten sich dicht um den Tisch, wie Bienen in einem Bienenkorb. Diese scheue Verlegenheit, Vorwurf und Koketterie zugleich, war entweder berechnete Verführung oder unwillkürliche Scham. Vielleicht riet ihnen ein Gefühl, das die Frau niemals ganz abstreift, sich in den Mantel der Tugend zu hüllen, um das verschwenderische Laster noch reizvoller, noch verlockender zu machen. Es schien zunächst, als ob die vom alten Taillefer angestiftete Verschwörung scheitern sollte. Diese zügellosen Männer wurden anfangs von der majestätischen Macht bezwungen, die der Frau eigen ist. Bewunderndes Murmeln ertönte wie sanfte Musik. Die Liebe hatte mit der Trunkenheit nicht mithalten können; anstatt einem Orkan der Leidenschaft überließen sich die Gäste, die in einem Moment der Schwäche überrascht worden waren, den Wonnen wollüstiger Verzückung. Beim Anruf der Poesie, dem Künstler immer gehorchen, studierten sie genießerisch die zarten Abstufungen, die diese erlesenen Schönheiten unterschieden. Einem Gedanken nachgehend, der vielleicht von der dem Champagner entsteigenden Kohlensäure herrührte, sann ein Philosoph schaudernd über das Unglück nach, das diese Frauen hier zusammengebracht haben mochte, die vielleicht ehemals reinster Huldigungen würdig waren. Gewiß hatte jede von ihnen ein blutiges Drama zu erzählen. Fast alle schleppten sie höllische Qualen mit sich und hatten treulose Männer, gebrochene Schwüre, mit Elend erkaufte Freuden hinter sich. Die Gäste näherten sich ihnen höflich, und Unterhaltungen, ebenso verschiedenartig wie die Charaktere, entspannen sich. Gruppen bildeten sich. Man hätte gemeint, einen Salon der guten Gesellschaft vor sich zu haben, in welchem Mädchen und Frauen den Gästen nach Tisch Kaffee, Zucker und Liköre anbieten, die übermäßigen Essern eine widerstrebende Verdauung erleichtern. Bald jedoch erscholl Gelächter, das Murmeln schwoll an, die Stimmen erhoben sich. Die für einen Augenblick gezähmte Orgie drohte hie und da wieder loszubrechen. In diesem Wechsel von Stille und Lärm lag eine entfernte Ähnlichkeit mit einer Symphonie von Beethoven.
Die beiden Freunde, die sich auf einem weichen Diwan niedergelassen hatten, sahen zuerst ein großes wohlgebautes Mädchen herannahen, das eine prächtige Haltung, unregelmäßige, aber eindringliche, feurige Gesichtszüge hatte, die durch kräftige Kontraste auf die Seele wirkten. Ihr dunkles, in aufreizenden Locken herabfallendes Haar, das ohne Zweifel schon die Stürme der Liebe erfahren hatte, umspielte ihre breiten Schultern, die anziehende Ausblicke boten. Lange, braune Locken umhüllten halb einen majestätischen Hals, über den das Licht zuweilen dahinglitt und die Feinheit grazilster Konturen enthüllte. Die mattweiße Haut ließ die warmen Töne ihres kräftigen Teints lebhaft hervortreten. Das von langen Wimpern beschattete Auge schleuderte kühne Blitze, Liebesfunken. Die roten, feuchten, halboffenen Lippen luden zum Kusse ein. Sie war kräftig gebaut, aber reizvoll geschmeidig; ihre Brust und ihre Arme waren üppig wie bei den schönen Gestalten von Carracci;100 bei alledem schien sie leicht und gewandt und ihre Kraft mahnte an die Behendigkeit einer Pantherkatze, so wie die männliche Eleganz ihrer Formen verzehrende Wollust verhieß. Obwohl dieses Mädchen zweifellos lachen und schäkern konnte, schrak man vor ihren Augen und ihrem Lächeln zuinnerst zurück. Gleich jenen von einem Dämon besessenen Prophetinnen rief sie mehr Staunen als Wohlgefallen hervor. Auf ihrem beweglichen Gesicht wechselte der Ausdruck blitzartig, in rascher Folge. Blasierte Männer hätte sie vielleicht entzückt, aber einem jungen Mann mußte sie Furcht einflößen. Sie war wie eine Kolossalstatue, die von einem griechischen Tempel herabgestürzt ist, wundervoll aus der Entfernung, aber von nahem betrachtet grob. Nichtsdestoweniger hätte ihre blendende Schönheit Ohnmächtige wecken, ihre Stimme Taube entzücken, ihre Blicke alte Gebeine neu beleben können. Darum verglich Émile das Mädchen mit einer Tragödie von Shakespeare, einer Art bewundernswürdiger Arabeske, wo die Freude brüllt, die Liebe etwas unbeschreiblich Wildes hat und wo auf das blutrünstige Toben des Zornes der Zauber der Anmut und das Feuer des Glückes folgen; einem Ungeheuer, das beißen und schmeicheln, wie ein Teufel lachen, wie Engel weinen kann, das in einer einzigen Umarmung alle Verführungskünste des Weibes spielen lässt, ausgenommen die Seufzer der Melancholie und die bezaubernde Sittsamkeit der Jungfrau; das dann plötzlich losbricht, sich die Flanken zerfleischt, seine Leidenschaft zerbricht, seinen Geliebten und schließlich sich selbst vernichtet wie ein aufrührerisches Volk. In einem rotsamtenen Gewand näherte sie sich, zertrat achtlos die Blumen, die schon aus den Haaren einiger Gefährtinnen gefallen waren, und hielt den beiden Freunden mit hochmütiger Gebärde eine silberne Platte hin. Stolz auf ihre Schönheit, stolz auf ihre Laster vielleicht, zeigte sie einen weißen Arm, der sich leuchtend vom Samt des Kleides abhob. Sie stand da wie die Königin der Lust, wie ein Bild menschlicher Sinnesfreude, jener Freude, welche die von drei Generationen angesammelten Schätze verschleudert, über Leichnamen lacht, Vorfahren höhnt, Perlen und Throne in nichts auflöst, Jünglinge in Greise und Greise häufig in Jünglinge verwandelt; jener Freude, die einzig solch Riesen gestattet ist, die der Macht überdrüssig sind, die im Denken erprobt sind oder für die der Krieg zum Kinderspiel geworden ist.
»Wie heißt du?« fragte Raphael sie.
»Aquilina.«
»Oh, oh!« rief Émile, »du kommst aus dem ›Geretteten Venedig‹!«101
»Ja«, erwiderte sie. »Wie sich die Päpste neue Namen geben, wenn sie sich über die Menschen erheben, habe ich einen anderen angenommen, als ich mich über alle Frauen erhob.«
»Hast du denn, wie deine Schutzpatronin, einen edlen und schrecklichen Verschwörer, der dich liebt und für dich zu sterben bereit ist?« fragte Émile lebhaft, den dieser Anschein von Poesie wieder aufrüttelte. »Ich hatte ihn«, antwortete sie; »aber die Guillotine ist meine Rivalin gewesen. Darum trage ich auch immer etwas Rotes in meinem Putz, damit meine Freude nie zu weit geht.«
»Oh, wenn Sie sie die Geschichte der vier jungen Männer von La Rochelle102 erzählen lassen, findet sie kein Ende. – Sei nur still, Aquilina! Haben nicht alle Frauen einen Geliebten zu beweinen? Aber nicht alle hatten das Glück wie du, ihn an das Schafott zu verlieren. Wahrhaftig! Ich möchte meinen weit lieber in einer Grube in Clamart103 wissen, als in dem Bett einer anderen.«
Diese Sätze wurden von einer sanften, melodischen Stimme gesprochen, die dem unschuldigsten, hübschesten, niedlichsten kleinen Geschöpf gehörte, das je unter dem Zauberstab einer Fee aus einem Zauber-Ei geschlüpft ist. Sie war lautlos herangekommen und zeigte ein feines Gesicht, eine zarte Gestalt, blaue Augen von entzückender Sittsamkeit, eine frische, reine Stirn. Eine kindliche Najade, die aus ihrer Quelle taucht, ist nicht schüchterner, weißer, unschuldiger als dieses junge Mädchen, das sechzehn Jahre alt, von Leid und von Liebe nichts zu wissen, von den Stürmen des Lebens verschont zu sein und gerade eben aus einer Kirche zu kommen schien, wo sie die Engel angefleht hatte, sie vor der Zeit zu sich in den Himmel zu rufen. Nur in Paris findet man diese Geschöpfe mit dem unschuldsvollen Antlitz, die unter einer Stirn, so hold und lieblich wie ein Gänseblümchen, die tiefste Verderbtheit, die raffiniertesten Laster verbergen. Von den himmlischen Verheißungen in den lieblichen Zügen des jungen Mädchens anfänglich getäuscht, nahmen Émile und Raphael den Kaffee, den sie ihnen in die von Aquilina gereichten Tassen einschenkte, und begannen sie auszufragen. In den Augen der beiden Dichter vervollständigte sie gleichsam durch eine unheimliche Allegorie das Bild einer gewissen Seite des menschlichen Lebens, indem sie dem wilden, leidenschaftlichen Ausdruck ihrer imposanten Gefährtin diese kalte, wollüstige, grausame Verdorbenheit gegenüberstellte, die leichtfertig genug ist, ein Verbrechen zu begehen, stark genug, sich lachend darüber hinwegzusetzen; ein Dämon ohne Herz, der reiche zärtliche Seelen dafür bestraft, daß sie Empfindungen haben, deren er unfähig ist, der immer eine Liebesgrimasse zu verkaufen hat, Tränen für den Leichenzug seines Opfers und Jubel, wenn er am Abend dessen Testament liest. Ein Dichter hätte die schöne Aquilina bewundern können; aber die rührende Euphrasie müßte die ganze Welt fliehen: die eine war die Seele des Lasters, die andere das Laster ohne Seele.
»Ich möchte wohl wissen«, fragte Émile das hübsche Geschöpf, »ob du bisweilen an die Zukunft denkst.«
»Die Zukunft?« erwiderte sie lachend. »Was nennen Sie die Zukunft? Warum soll ich an etwas denken, was noch nicht ist? Ich blicke nie zurück und nie voraus. Ist es nicht schon zuviel, wenn ich mich mit einem ganzen Tag beschäftige? Im übrigen kennen wir die Zukunft. Sie ist das Spital.«
»Wie kannst du das Spital jetzt schon voraussehen und nicht vermeiden wollen, hineinzukommen?« rief Raphael.
»Was hat das Spital denn so Furchtbares?« fragte die schreckliche Aquilina. »Wenn wir weder Mütter noch Gattinnen sind, wenn das Alter uns schwarze Strümpfe auf die Beine und Runzeln über unsere Stirnen zieht, wenn es alles, was an uns Weib ist, welk macht und die Freude in den Blicken unserer Freunde auslöscht, was können wir dann noch weiter wollen? Von all unserer jetzigen Schönheit seht ihr nur mehr ein Stück Dreck in uns, das auf zwei Beinen einherschlottert, kalt, dürr und entstellt ist und im Gehen raschelt wie welkes Laub. Der schönste Putz wird uns zu Lumpen, das Ambra, das unser Boudoir durchduftete, riecht nach Moder und Verwesung; und wenn in diesem Kot ein Herz steckt, so sprecht ihr alle ihm Hohn und gestattet uns nicht einmal die Erinnerung. Ob wir also dann in einem reichen Haus wohnen und Hunde warten oder im Spital Lumpen sortieren, ist unser Dasein nicht genau dasselbe? Ob wir unsere weißen Haare unter einem rot-blau karierten Taschentuch oder unter Spitzen verstecken, ob wir die Straße mit Rutenbesen oder die Stufen der Tuilerien mit Atlasschleppen fegen, ob wir an vergoldeten Kaminen sitzen oder uns die Hände an einem irdenen Kohlen-Topf wärmen, dem Spektakel auf der Place de Grève zuschauen oder in die Oper gehen: Ist das ein so großer Unterschied?«
»Aquilina mia, niemals hast du in all deiner Verzweiflung so recht gehabt«, sagte Euphrasie; »ja, Kaschmir, Spitzen, Parfüms, Gold, Seide und Luxus, alles, was glänzt, was gefällt, steht nur der Jugend gut. Die Zeit allein könnte gegen unsere Torheiten recht behalten, aber das Glück spricht uns frei. – Sie lachen über meine Worte«, rief sie und lächelte den beiden Freunden boshaft zu; »habe ich nicht recht? Ich sterbe lieber am Vergnügen als an einer Krankheit. Ich habe weder die Manie, lange leben zu wollen, noch großen Respekt vor der menschlichen Gattung, wenn ich sehe, was Gott daraus macht. Gebt mir Millionen, ich werde sie durchbringen; nicht einen Centime davon würde ich für das nächste Jahr sparen. Leben, um zu gefallen und zu herrschen, das ist die Maxime, die jeder Schlag meines Herzens kundgibt. Die Gesellschaft pflichtet mir bei; befriedigt sie nicht dauernd meine Vergnügungssucht? Warum läßt mir denn der liebe Gott jeden Morgen zukommen, was ich am Abend ausgebe? Warum baut ihr uns Spitäler? Da er uns nicht die Wahl gelassen hat zwischen dem Guten und dem Bösen, damit wir wählen, was uns kränkt und widerwärtig ist, so wäre ich ja sehr dumm, wenn ich mich nicht amüsierte.«
»Und die anderen?« fragte Émile.
»Die anderen? Nun, mögen sie doch nach ihrer Fasson selig werden! Ich will lieber über ihre Leiden lachen, als über meine eigenen weinen zu müssen. Ich rate es keinem Mann, mir den geringsten Kummer zuzufügen.«
»Was hast du denn gelitten, um so zu denken?« fragte Raphael.
»Ich bin um einer Erbschaft willen verlassen worden! Ich!« sagte sie und nahm eine Haltung an, die alle ihre Reize hervortreten ließ. »Und dabei habe ich Tag und Nacht gearbeitet, um meinen Geliebten zu ernähren. Ich will auf kein Lächeln, auf keine Versprechungen mehr reinfallen und aus meinem Leben eine lange Vergnügungspartie machen.«
»Aber«, rief Raphael aus, »kommt das Glück denn nicht aus der Seele?«
»Nun«, erwiderte Aquilina, »ist es nichts, sich bewundert, umschmeichelt zu sehen, über alle Frauen, selbst die tugendhaftesten, zu triumphieren, sie mit unserer Schönheit, unserem Reichtum in den Schatten zu stellen? Überhaupt, erleben wir an einem Tage nicht mehr als eine gute Bürgersfrau in zehn Jahren? Und damit ist alles gesagt.«
»Ist eine Frau ohne Tugend nicht verabscheuungswürdig?« versetzte Émile, zu Raphael gewandt.
Euphrasie warf ihnen einen Schlangenblick zu und antwortete mit unnachahmlicher Ironie: »Die Tugend überlassen wir den Häßlichen und Buckligen. Was wären sie denn ohne diese, die Armen?«
»Schweig!« rief Émile, »sprich nicht von Dingen, die du nicht kennst.«
»So! Ich kenne sie nicht!« rief Euphrasie. »Sich sein ganzes Leben lang einem verhaßten Menschen hingeben, Kinder aufziehen, die einen verlassen, und ihnen auch noch Danke sagen, wenn sie einen ins Herz treffen: das sind die Tugenden, die ihr von der Frau verlangt; und um sie für ihre Entsagung zu belohnen, legt ihr ihr neue Leiden auf, indem ihr sie zu verführen sucht; widersteht sie, so kompromittiert ihr sie. Ein schönes Leben! Nein, lieber doch frei bleiben, die lieben, die uns gefallen, und jung sterben.«
»Fürchtest du denn nicht, dafür eines Tages zahlen zu müssen?«
»Nun«, antwortete sie, »statt meine Freuden mit Leid zu mischen, wird mein Leben in zwei Hälften zerteilt: eine gewiß fröhliche Jugend und ein wer weiß wie ungewisses Alter, wo ich nach Belieben leiden kann.«
»Sie hat nie geliebt«, sagte Aquilina mit dunkler Stimme. »Sie hat niemals 100 Meilen zurückgelegt, um mit tausend Wonnen einen Blick zu erhaschen und ein ›Nein‹ zu hören; sie hat ihr Leben nie an ein Haar gehängt, hat nicht soundso viele Männer niederstechen wollen, um ihren Herrn, ihren Herrscher, ihren Gott zu retten. Für sie war die Liebe ein hübscher Oberst.«
»Haha! La Rochelle!« erwiderte Euphrasie. »Die Liebe ist wie der Wind, wir wissen nicht, woher sie kommt. Im übrigen, wenn ein Tier dich sehr geliebt hätte, würdest du die vernunftbegabten Menschen verabscheuen.«
»Das Gesetz verbietet uns, Tiere zu lieben«, versetzte die große Aquilina spöttisch.
»Ich glaubte, du seist nachsichtiger gegen das Militär!« rief Euphrasie lachend.
»Wie glücklich sind die Frauen, daß sie sich so ihrer Vernunft entäußern können!« rief Raphael aus.
»Glücklich?« fragte Aquilina, lächelte mitleidig und entsetzt und warf den beiden Freunden einen furchtbaren Blick zu. »Ach! ihr wißt nicht, was es heißt, mit einem Toten im Herzen zum Vergnügen verdammt zu sein.«
Wer zu diesem Zeitpunkt einen Blick in die Salons getan hätte, der hätte eine Vorstellung von Miltons Pandämonium104 bekommen. Die blauen Flammen des Punsches malten Höllenfarben auf die Gesichter derer, die noch trinken konnten. Frenetische Tänze, angepeitscht von einer wilden Besessenheit, erregtem Gelächter und Geschrei, das losballerte wie ein Feuerwerk. Das Boudoir und ein kleiner Salon sahen aus wie ein von Toten und Sterbenden übersätes Schlachtfeld. Die Atmosphäre war vom Wein, der Lust und den vielen Worten durchglüht. Rausch, Liebe, Wahnwitz, Weltvergessenheit erfüllte die Herzen, war auf den Gesichtern und stand auf den Teppichen geschrieben, prägte das allgemeine Wirrwarr und umflorte die Blicke mit Schleiern, die in der Luft betäubende Dünste sehen ließen. Flimmernder Staub wie in den Lichtbahnen eines Sonnenstrahls hing über allem und umwölkte die absonderlichsten Formen, die groteskesten Kämpfe. Hier und da schienen Gruppen verschlungener Gestalten förmlich eins geworden mit den weißen Marmorleibern edler Kunstwerke, welche die Gemächer zierten. Obwohl die beiden Freunde in ihren Gedanken und Sinnen eine gewisse trügerische Klarheit bewahrt hatten, ein letztes Aufzucken, ein unvollkommenes Scheinbild des Lebens, war es ihnen unmöglich zu erkennen, was an den bizarren Erscheinungen wirklich, was den übernatürlichen Bildern, die unaufhörlich an ihren ermüdeten Augen vorüberzogen, möglich war. Die Schwüle, die über unseren Träumen lastet, die glutvolle Anmut, die die Gestalten in unseren Visionen gewinnen; vor allem eine sonderbare, mit Ketten beladene Leichtigkeit, kurzum, die ungewohntesten Phänomene des Schlafs stürmten so lebhaft auf sie ein, daß sie die Spiele dieser Orgie für die Gaukelbilder eines Alpdrucks hielten, wo die Bewegung geräuschlos ist und die Schreie vom Ohr nicht vernommen werden. Zu diesem Zeitpunkt gelang es einem vertrauten Kammerdiener, nicht ohne Mühe, seinen Herrn in das Vorzimmer zu ziehen und ihm zuzuflüstern: »Monsieur, alle Nachbarn sind an den Fenstern und beklagen sich über den Lärm.«
»Warum lassen sie nicht Stroh vor ihre Türen legen, wenn sie Angst vor dem Lärm haben?« rief Taillefer.
Unvermittelt brach Raphael lauthals in ein so unangebrachtes Gelächter aus, daß sein Freund ihn nach der Ursache dieses brutalen Freudenausbruchs fragte.
»Du würdest mich schwerlich verstehen«, antwortete er. »Zuerst müßte ich bekennen, daß ihr mich gerade in dem Augenblick auf dem Quai Voltaire traft, als ich mich in die Seine stürzen wollte, und du würdest zweifellos die Beweggründe meines Vorhabens erfahren wollen. Aber wenn ich hinzufügte, daß sich kurz zuvor, durch einen ans Fabelhafte grenzenden Zufall, die poetischsten Trümmer der materiellen Welt vor meinen Augen zu einer symbolischen Gestalt der menschlichen Weisheit zusammenfügten, während in diesem Augenblick die Trümmer aller intellektuellen Schätze, die wir bei Tisch durcheinanderwarfen, auf diese beiden Frauen, die leibhaftigen Urbilder der Torheit, hinauslaufen; und daß unsere tiefe Unbekümmertheit um Menschen und Dinge nur als Übergang zu den farbenprächtigen Bildern zweier sich so diametral gegenüberstehenden Lebensweisen diente, würdest du davon klüger sein? Wenn du nicht so betrunken wärst, sähest du vielleicht eine philosophische Abhandlung darin.«
»Wenn du nicht beide Füße auf dieser hinreißenden Aquilina hättest, deren Schnarchen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Grollen eines nahenden Gewitters hat«, erwiderte Émile, der sich seinerseits damit vergnügte, Euphrasies Haare zusammen- und auseinanderzurollen, ohne daß ihm diese unschuldige Beschäftigung recht bewußt war, »würdest du über deine Betrunkenheit und dein Gefasel schamrot werden. Deine beiden Lebensweisen kann man mit einem einzigen Satz auf einen Nenner bringen. Das einfache mechanische Leben führt zu irgendeiner unsinnigen Weisheit, indem es unsere Intelligenz durch die Arbeit erstickt, während das Leben, das man in der Leere der Abstraktionen oder in den Abgründen der moralischen Welt verbringt, zu irgendeiner närrischen Weisheit führt. Mit einem Wort: die Gefühle töten, damit man alt wird, oder jung sterben, indem man das Martyrium der Leidenschaften auf sich nimmt, das ist unser Entweder-Oder. Allerdings ist diese Bestimmung uneins mit den Temperamenten, die uns der strenge Spaßvogel, dem wir das Muster aller Kreatur verdanken, mitgegeben hat.«
»Esel!« unterbrach ihn Raphael: »Fahre nur fort, dich selbst solcherart auf Kurzfassung zu bringen, und du füllst Bände. Wenn ich mir angemaßt hätte, diese beiden Auffassungen präzise und knapp zu formulieren, hätte ich dir gesagt, daß der Gebrauch des Verstandes den Menschen verdirbt, die Unwissenheit ihn läutert. Das heißt die Gesellschaften antasten wollen? Aber ob wir mit den Weisen leben oder mit den Narren zugrunde gehen, ist das Resultat nicht früher oder später das nämliche? Übrigens hat der Meister ausgeklügelter Quintessenzen diese beiden Systeme seinerzeit in zwei Worten ausgedrückt: Carymary, Carymara.«105
»Du machst mich an der Allmacht Gottes zweifeln, denn deine Dummheit übertrifft seine Allmacht«, erwiderte Émile. »Unser teurer Rabelais106 hat diese Philosophie durch ein kürzeres Wort als ›Carymary, Carymara‹ ausgedrückt, und zwar: ›Vielleicht‹, woher Montaigne107 sein ›Was weiß ich?‹ nahm. Außerdem sind diese letzten Worte der Moralphilosophie nichts anderes als der Ausruf des Pyrrhon,108 denn er blieb zwischen Gut und Böse, wie Buridans Esel109 zwischen zwei Heuhaufen. Aber lassen wir diesen ewigen Streit, der heute doch nur auf ein Ja oder Nein hinausläuft. Welche Erfahrung wolltest du denn machen, als du in die Seine springen wolltest? Warst du auf die hydraulische Maschine des Pont Notre-Dame neidisch?«
»Ach, wenn du mein Leben kenntest.«
»Oh! ich hätte dich für weniger banal gehalten, die Phrase ist abgedroschen. Weißt du nicht, daß wir uns alle einbilden, weit mehr als die anderen zu leiden?«
»Ach!« seufzte Raphael.
»Was bist du lächerlich mit deinem dauernden Ach! Was ist los? Zwingt dich eine Krankheit der Seele oder des Leibes, durch eine Muskelkontraktion alle Morgen die Pferde vorzuführen, die dich am Abend vierteilen sollen, wie dazumal Damiens?110 Hast du deinen Hund roh und ungesalzen in deiner Dachstube verzehrt? Haben deine Kinder jemals zu dir gesagt: ›Ich habe Hunger‹? Hast du die Haare deiner Geliebten verkauft, um zum Spiel gehen zu können? Bist du jemals in eine falsche Wohnung gelaufen, um einen auf einen falschen Onkel gezogenen falschen Wechsel zu bezahlen, mit der Furcht im Nacken, zu spät zu kommen? Nun, laß hören! Wolltest du jedoch einer Frau oder eines abgewiesenen Wechsels wegen oder aus Langerweile ins Wasser gehen, so würdige ich dich keines Blickes mehr. Bekenne, lüge nicht; ich verlange keine historischen Memoiren von dir! Vor allem: sei so kurz, wie dein Rausch es erlaubt. Ich bin anspruchsvoll wie ein Leser und schläfrig wie eine Frau beim Abendgebet.«
»Armer Tor! Seit wann bestimmen die Schmerzen den Grad der Empfindsamkeit? Wenn wir in der Wissenschaft einmal so weit sein werden, eine Naturgeschichte der Herzen aufzustellen, sie zu benennen, sie in Arten, Unterarten, Familien, in Krustazeen, Fossilien, Saurier, in Kleinstlebewesen – und was weiß ich noch alles – einzuteilen, dann, lieber Freund, wird es bewiesen sein, daß es Herzen gibt, die so zart und empfindlich sind wie Blumen und gleich ihnen von einer leichten Berührung gebrochen werden können, die gewisse versteinerte Herzen nicht einmal spüren.«
»Oh! ich bitte dich, verschone mich mit deiner Vorrede«, sagte Émile mit einer halb lachenden, halb kläglichen Miene und faßte Raphael bei der Hand.
1 Palais-Royal: 1633 für den Kardinal Richelieu erbauter Palast in Paris, der spätere Wohnsitz der Prinzen des Hauses Orléans, war eines der Zentren öffentlichen Glücksspiels in Paris <<<
2 Coatzacoalco: Fluß in Mexiko, an dem Frankreich 1823 versuchsweise eine Strafkolonie einrichtete <<<
3 Darcet, Jean-Pierre-Joseph (1777-1844): französischer Chemiker, Akademiemitglied, der sich unter anderem mit der Zusammensetzung von Knochen beschäftigte und die daraus gewonnene Gelatine als billiges Grundnahrungsmittel für die Armenspeisung empfahl <<<
4 Zerberus: in der griechischen Mythologie Hund, der den Eingang zum Hades, der Unterwelt, bewacht <<<
5 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): französischer Schriftsteller und Philosoph der Aufklärung; durch seine sozial- und kulturkritischen Schriften wurde er zum Wegbereiter der Französischen Revolution <<<
6 Trente-et-Quarante: Glücksspiel mit Karten <<<
7 Place de Grève: Platz in Paris, auf dem bis zur Restauration die Hinrichtungen stattfanden <<<
8 Tantalus: nach der griechischen Mythologie wurde der König Tantalus dazu bestraft, im Anblick des Überflusses qualvoll Hunger und Durst leiden zu müssen <<<
9 Bagno: Gefängnis der Galeerensträflinge in Toulon <<<
10 Napoleon: Napoleondor, unter Napoleon I. und Napoleon III. geprägte Goldmünze im Wert von zwanzig Francs <<<
11 »Di tanti palpiti«: Anfangsworte der Schlußkabaletta aus der Oper »Tankred« (1831) von Rossini <<<
12 Tuilerien: ehemaliges Stadtschloß der französischen Könige in Paris, Residenz Napoleons und der nachfolgenden Herrscher Frankreichs, mit einem großen Park <<<
13 seit 1793: Anspielung auf die als »Schreckenszeit« bezeichnete Periode der Französischen Revolution, in der die revolutionär-demokratische Diktatur der Jakobiner herrschte <<<
14 Lord Castlereagh, Henri Robert Stewart, Marquis von Londonderry (1769-1822): englischer Staatsmann, Bevollmächtigter Englands auf dem Wiener Kongreß, endete durch Selbstmord <<<
15 Auger, Louis-Simon (1772-1829): französischer Literaturkritiker, beendete sein Leben durch Selbstmord. <<<
16 Monsieur Dacheux: 1830 Inspektor der für die erste Hilfe Ertrinkender längs der Seine errichteten Rettungsstützpunkte <<<
17 … Tabakrauch bereithalten: mit Hilfe einer besonderen Spritze wurde den aus dem Wasser Geretteten Tabakrauch durch den After in den Dickdarm geblasen <<<
18 Caliban: Gestalt aus dem Drama »Der Sturm« (1611) von Shakespeare (1564-1616) <<<
19 Bernard Palissy (1510-1589 oder 1590): französischer Glasmaler, Kunsttöpfer und Naturwissenschaftler; entdeckte das Verfahren, Tongefäße mit farbigem Email herzustellen. Seine dekorativen Zwecken dienenden Tonarbeiten schmückten tierische und pflanzliche Darstellungen <<<
20 Cicero, Marcus Tullus (106-43 v. Chr.): größter Redner des römischen Altertums, seine philosophischen Schriften wurden zum Vorbild für den klassischen lateinischen Stil <<<
21 Jaquotot, Marie-Victoire (1776-1835): Porzellanmalerin der Manufaktur von Sèvres (Ort an der Seine, berühmt durch seine 1763 im Park von Saint-Cloud errichtete Porzellanmanufaktur) <<<
22 Sesostris: griechische Form eines altägyptischen Königsnamens <<<
23 Dubarry, Jeanne Bécu, Comtesse du Barry (1743-1793): lothringisches Bauernmädchen, Mätresse Ludwigs XV., 1793 hingerichtet <<<
24 Latour, Maurice Quentin de La Tour (1704-1788): französischer Pastellmaler, berühmt für seine Porträtdarstellungen <<<
25 Tschibuk: lange türkische Tabakspfeife <<<
26 Chimära: in der Mythologie feuerspeiendes Ungeheuer mit Löwenkopf, Ziegenleib und Schlangenschweif <<<
27 Titus Livius (59 v. Chr.-17 n. Chr.): römischer Geschichtsschreiber <<<
28 ›Senatus Populusque Romanus‹: lat., der Senat und das römische Volk <<<
29 Borgia: mächtiges Adelsgeschlecht im Italien des 15./16. Jahrhunderts <<<
30 Benvenuto Cellini (1500-1571): italienischer Goldschmied und Bildhauer der Spätrenaissance; seine Autobiographie wurde von Goethe ins Deutsche übertragen <<<
31 Kabinett von Ruysch: Fredrik Ruysch (1638-1731), niederländischer Anatom, entwickelte ein Verfahren zur Konservierung anatomischer Präparate und gründete eines der ältesten anatomischen Museen. Seine Sammlung wurde 1717 von König Stanislaus von Polen und von Peter dem Großen erworben <<<
32 Lara: Titelheld der gleichnamigen Verserzählung von Lord Byron (1814) <<<
33 Teniers, David, gen. der Ältere (1582-1649), und dessen Sohn David, gen. der Jüngere (1610-1690): flämische Maler <<<
34 Mieris, wahrscheinlich Frans van Mieris der Ältere (1635-1681): holländischer Maler, vor allem Porträts und Genrebilder <<<
35 Salvator Rosa (1615-1673): italienischer Maler, Dichter und Musiker <<<
36 Rubebe: auch Rebec, ursprünglich arabisches, auch mittelalterliches Geigeninstrument mit zwei oder drei Saiten <<<
37 Jean Goujon (geb. zwischen 1510 und 1514, gest. zwischen 1564 und 1569): französischer Maler des Barock <<<
38 Claude Lorrain, auch Le Lorrain (1600-1682): französischer Maler, Meister der Landschaftsmalerei <<<
39 Gérard Dou, auch Dow (1613-1675): niederländischer Genremaler <<<
40 Murillo, Bartolomé Esteban (1617-1682): spanischer Maler, der neben Madonnen- und Heiligenbildern auch realistische Genreszenen schuf <<<
41 Velasquez, Diego (1599-1660): spanischer Hof- und Porträtmaler <<<
42 Byron, George Noël Gordon, Lord (1788-1824): englischer romantischer Dichter, nahm aktiv an der Carbonari-Verschwörung und am griechischen Freiheitskampf teil <<<
43 Correggio, Antonio (1489-1534): italienischer Maler, Meister des Helldunkel <<<
44 Cuvier, Georges, Baron (1769-1832): Begründer der modernen Paläontologie und vergleichenden Anatomie, verteidigte die metaphysische Auffassung von der Unabänderlichkeit der biologischen Arten <<<
45 Kadmos: Gestalt der griechischen Mythologie, säte die Zähne eines von ihm getöteten Drachens, aus denen Krieger wuchsen, mit denen er die Stadt Theben gründete <<<
46 in dem von Descartes empfohlenen philosophischen Zweifel: René Descartes (1596-1650), französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph des Rationalismus, zweifelte an der Sinneserkenntnis, stellte die Selbstgewißheit (»ich denke, also bin ich«) als Prinzip und Ausgangspunkt aller Wahrheit dar <<<
47 Gay-Lussac, Louis-Joseph (1778-1850): französischer Physiker und Chemiker <<<
48 Arago, François (1786-1853): französischer Astronom und Physiker <<<
49 Funambules: Théâtre des Funambules, Pariser Theater für Vaudevilles <<<
50 Siegel Salomons: Salomo, König von Israel (gest. um 925 v. Chr.), gilt als Urbild der Weisheit und Beherrscher der Geister; sein Siegelring, ein fünfzackiger Stern, spielt als Talisman der Weisheit und der Zauberei in der Kabbalistik eine große Rolle <<<
51 Swedenborg, Emanuel von (1688-1772): schwedischer Theosoph und Naturwissenschaftler; lehrte den organischen und mechanischen Zusammenhang aller Dinge. Er soll eine Vision gehabt haben, bei der ihm Gott erschienen sei und ihn als Propheten ausersehen habe. Swedenborg lehrte, daß Christus die Dreieinigkeit wäre und daß zwischen Gott und dem Menschen eine unsichtbare Welt existiere, die er als eine geistige Übersetzung der menschlichen Welt veranschaulicht. Diese Welt sei bevölkert von Engeln, die wie Menschen lebten <<<
52 Leonarda: Gestalt der Köchin aus dem Roman ›Gil Blas‹ (erste Auflage 1715) von Alain-René Lesage (1668-1747) <<<
53 Bouffons: Bezeichnung für die Opéra Comique, ein 1714 gegründetes Pariser Theater, dessen Repertoire Opernparodien und Singspiele, später auch die französische komische Oper umfaßte. 1762 ging die Opéra Comique in der Comédie Italienne auf und wurde 1801 als »Théâtre de l’Opéra Comique« neugegründet. Die Opéra Comique war zwischen 1830 und 1870 eines der bedeutendsten Musikzentren Europas <<<
54 Sainte-Pélagie: Gefängnis in Paris <<<
55 La Force: 1782 im ehemaligen Hôtel de la Force eingerichtetes Gefängnis von Paris <<<
56 … über den Pont-des-Arts gegangen: Auf dem Pont-des-Arts mußte ein Sou Brückengeld bezahlt werden <<<
57 … wie der Staatshaushalt seinen Sitz vom Faubourg Saint-Germain zur Chaussée-d ’Antin verlegt hat: d. h. vom Wohnviertel des Adels, dem Faubourg Saint-Germain, zum Wohnsitz der Finanzbourgeoisie, Chaussée-d’Antin <<<
58 Bürgerkönig: Louis-Philippe (1773-1850), König der Franzosen (1830-1848); von der französischen Finanzbourgeoisie zum König proklamiert, regierte er in ihrem Interesse bis zu seinem Sturz durch die Februarrevolution 1848 <<<
59 Panurge: Gestalt aus dem Roman »Gargantua und Pantagruel« von François Rabelais (um 1494-1553) <<<
60 more orientali: lat., nach orientalischer Sitte <<<
61 Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti, Comte de (1749-1791): führender Ideologe des liberalen Adels und der Bourgeoisie, Abgeordneter des Dritten Standes; konspirierte mit dem König, um die konstitutionelle Monarchie gegen die revolutionäre Volksbewegung zu sichern, und wurde des Verrats angeklagt <<<
62 Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838): Bischof von Autun (1788), Deputierter der Gesetzgebenden Versammlung. Unter Napoleon war Talleyrand Außenminister (1797-1807); er intrigierte gegen den Kaiser (1808) und fiel in Ungnade. 1814 konstituierte er eine Provisorische Regierung, die Ludwig XVIII. den Thron antrug, was ihm unter der Restauration wieder das Außenministerium einbrachte. Während der Juli-Monarchie war Talleyrand französischer Botschafter in London (1830-1835) <<<
63 Pitt, William (1759-1806): englischer Premierminister von 1784 bis 1801 und 1804; war die treibende Kraft des Kampfes gegen die Französische Revolution und das napoleonische Kaiserreich <<<
64 Metternich, Clemens Wenzel Lothar, Fürst von (1773-1859): österreichischer Staatsmann; ab 1809 Außenminister, 1821-1848 Staatskanzler; wurde nach dem Wiener Kongreß (1815) Haupt der Reaktion in Europa; unterdrückte gewaltsam alle nationalen und liberalen Bestrebungen; durch die Wiener Märzrevolution 1848 gestürzt <<<
65 Crispin: dreiste und stets auf das eigene Wohl bedachte Diener-Gestalt der französischen Komödie <<<
66 Amphitryon: sagenhafter König von Theben, der eine Blutschuld sühnen mußte, um die Hand Alkmenes zu erlangen. Nach der gleichnamigen Komödie von Molière gilt er als wohlhabender, gern den Gastgeber spielender Mann <<<
67 Saturnalien: altrömische Feste zu Ehren des Gottes Saturn mit karnevalistischem Treiben und dem Rollentausch von Herren und Sklaven <<<
68 roter Korsar: Anspielung auf den Helden des Romans »Der rote Korsar« (1827) von James Fenimore Cooper (1789-1851) <<<
69 Botany Bay: große Bucht in der Nähe von Sydney, ursprünglich für die in Port Jackson errichtete Strafkolonie vorgesehener Standort, auf die sich die Anspielung bezieht <<<
70 ›De Viris illustribus: lat., ›Über berühmte Männer‹, Biographiensammlung des römischen Geschichtsschreibers Cornelius Nepos (99-24 v. Chr.) <<<
71 Meister Alcofribas: Gestalt aus dem Roman ›Gargantua und Pantagruel‹ von François Rabelais. <<<
72 Saint-Simonist: Anhänger der Lehre des französischen Sozialphilosophen Claude-Henri Comte de Saint-Simon (1760-1825), einem Hauptvertreter des utopischen Sozialismus <<<
73 die berühmte Lüge Ludwigs XVIII.: Eintracht mit den Bonapartisten, Vergessen der konterrevolutionären Verschwörungen in der Vendée <<<
74 Cambacérès, Jean-Jacques Régis de (1753-1824): während der Französischen Revolution Präsident des Nationalkonvents, danach Mitglied des Wohlfahrtsausschusses und Zweiter Konsul nach Napoleon; im Kaiserreich Erzkanzler und Senatspräsident <<<
75 Brillat-Savarin, Anthelme (1755-1826): französischer Feinschmecker, bekannt geworden durch sein Werk ›Physiologie des Geschmacks oder Betrachtungen über das höhere Tafelvergnügen‹, einer Huldigung der Gastronomie und der Tafelfreuden <<<
76 Rossini, Gioacchino (1792-1868): italienischer Opernkomponist, feierte während der Restauration große Erfolge in Paris <<<
77 Non cecidit animus!: lat., Der Geist ist nicht gesunken! <<<
78 Bossuet, Jacques-Bénigne (1627-1704): französischer Prälat, Schriftsteller und berühmter Prediger; Bischof von Condom (1669) und Meaux (1681); Erzieher des Dauphin; hatte maßgeblichen Einfluß auf die Kirchenpolitik Ludwigs XIV <<<
79 Ballanche, Pierre-Simon (1776-1847): französischer Schriftsteller, war einer mystisch-christlichen Vorstellungskraft verhaftet und sah in dem konstitutionellen Regime der Restauration den endgültigen Gipfelpunkt der historischen Entwicklung <<<
80 die Wasserleitungen von Maintenon: unter Ludwig XIV. begonnener, aber unvollendeter Bau einer Wasserleitung, die die Wasser der Eure nach Versailles leiten sollte <<<
81 Konvent: die französische Nationalversammlung von 1792-1795, vereinigte die legislative und exekutive Gewalt <<<
82 Monbard: auch Montbars, gen. »Der Vernichter« (geb. 1645): berühmter französischer Freibeuter <<<
83 Perrault, Charles (1628-1703): französischer Schriftsteller, bekannt durch seine Märchensammlung <<<
84 Charlet, Nicolas (1792-1845): französischer Maler und Lithograph, trug durch die Darstellung von Militärszenen zum Napoleonmythos bei <<<
85 Circulus vitiosus: lat., Teufelskreis <<<
86 Karl X. (1757-1836): König von Frankreich 1824-1830; Bruder Ludwigs XVI. und Ludwigs XVIII., nach dessen Tod er den Thron der Bourbonen bestieg. Seine restriktive Politik führte zur Julirevolution, vor der er nach England floh <<<
87 vice versa: lat., umgekehrt <<<
88 Malibran, Maria-Felicia Garcia (1808-1836): seit 1828 gefeierte Opernsängerin in Paris <<<
89 Heinrich IV. (1553-1610): König von Frankreich 1589-1610; wurde von Ravaillac ermordet <<<
90 La Fayette, Marie-Joseph Motier, Marquis de (1757-1834): unterstützte als Vertreter der Liberalen 1830 die Thronbesteigung von Louis-Philippe <<<
91 »Geschichte des Königs von Böhmen und …«: 1830 erschienene Erzählung von Charles Nodier (1780-1844) <<<
92 Charenton: Irrenanstalt in der Nähe von Paris <<<
93 »Revue des Deux Mondes«: 1829 gegründete Kulturzeitschrift. Die Anspielung bezieht sich auf ihren damaligen Besitzer und Leiter, François Buloz, der seines Schielens wegen Gegenstand allgemeinen Spottes war <<<
94 Crébillon, Prosper Jolyot, Sieur de Crais-Billon, gen. Crébillon der Ältere (1674-1762): französischer Tragödiendichter; häufte in seinen nach antiken Stoffen gestalteten Stücken grausige, pathetische Szenen <<<
95 Bichat, Marie-François-Xavier (1771-1802): französischer Arzt und Physiologe; grundlegende Betrachtungen zur Gewebelehre und pathologischen Anatomie <<<
96 Pantagruel: Titelgestalt aus dem Roman »Gargantua und Pantagruel« von François Rabelais <<<
97 Diis ignotis: lat., den unbekannten Göttern <<<
98 Ossian: sagenhafter keltischer Sänger aus dem 3. Jahrhundert, unter dessen Namen der schottische Dichter James Macpherson (1736-1796) eine seinerzeit hochberühmte Gedichtsammlung veröffentlichte <<<
99 Lebel, Dominique-Guillaume (1696-1768): Kammerdiener Ludwigs XV., der seinem König die Mädchen zuführen mußte <<<
100 Carracci: italienische Malerfamilie des 16. Jahrhunderts <<<
101 … aus dem »Geretteten Venedig«: Aquilina ist eine Gestalt aus der 1682 erschienenen Tragödie »Das gerettete Venedig« des englischen Dramatikers Thomas Otway (1652-1685) <<<
102 … die Geschichte der vier jungen Männer von La Rochelle: Der Feldwebel Bories (1795-1822) und seine Kameraden Goubin, Pommier und Goupillon wurden als Mitglieder einer Carbonarigruppe verraten, die drei ersteren 1822 in La Rochelle zum Tode verurteilt und hingerichtet <<<
103 Clamart: Pariser Friedhof, 1833 stillgelegt <<<
104 Miltons Pandämonium: Reich der bösen Geister in dem Poem »Das verlorene Paradies« (1667) des englischen Dichters John Milton (1608-1674) <<<
105 ›Carymary, Carymara‹: aus dem anonymen Schwank »Meister Pierre Pathelin« (1461-1469); Zitat aus der Szene, in der Pathelin das Delirium simuliert, um den Tuchmacher zu prellen <<<
106 Rabelais, François (um 1494-1553): französischer humanistischer Schriftsteller der Renaissance, Verfasser der berühmten »Gargantua« (1534) und »Pantagruel« (1532) <<<
107 Montaigne, Michel Eyquem de (1553-1692): französischer Moralphilosoph, bekannt durch seine »Essais« <<<
108 Pyrrhon (365-275 v. Chr.): griechischer Philosoph, Skeptiker, negierte die Möglichkeit der Wahrheitserkenntnis <<<
109 Buridans Esel: Dem französischen Logiker und Naturphilosophen Jean Buridan (vor 1300 – nach 1358) zugeschriebene Allegorie vom Esel, der zwischen zwei Heubündeln steht, sich weder für das eine noch für das andere entscheiden kann und deswegen verhungern muß <<<
110 Damiens, Robert-François (1715-1757): wurde nach einem Attentat auf Ludwig XV. öffentlich gefoltert und gevierteilt <<<