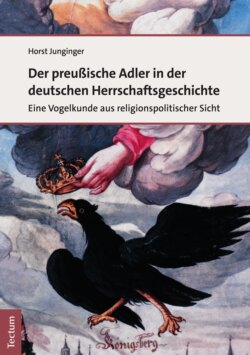Читать книгу Der preußische Adler in der deutschen Herrschaftsgeschichte - Horst Junginger - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеReligiöser und militärischer Drill als Programm
An den christlichen Tugenden, die man den Soldaten predigte, haperte es oft. Abgesehen von Alkoholgelagen und der exorbitant hohen Zahl unehelicher und unversorgter Kinder in Potsdam (Kroener 236) stellte die Unbotmäßigkeit gegenüber den Vorgesetzten ein immer wiederkehrendes Problem dar. Der Mangel an Kirchendisziplin äußerte sich unter anderem in dem Versuch der Soldaten, vom Gottesdienst fernzubleiben oder sich heimlich aus ihm hinauszuschleichen. Nur die Bewachung der Ausgänge konnte dem im wahrsten Sinne des Wortes einen Riegel vorschieben. In einem bis 1811 geltenden Reglement aus dem Jahr 1743 heißt es:
„Alle Officiers sollen mit in die Kirche und nebst den Soldaten nicht eher aus der Kirche gehen, bevor Vormittag der Priester von der Cantzel und Nachmittag die Kirche he gantz aus ist; Dieserhalb, damit nemlich kein Unterofficier oder Gemeiner aus der Kirche gehen kan, vor jeder Kirchenthüre ein Unterofficier mit dem Kurtzgewehr gesetzt werden soll.“ (Bamberg 283)
Grundsätzlich bestand für alle vermögenslosen Preußen lebenslange Dienstpflicht. In der Praxis beschränkte sich diese auf zwei oder drei Jahrzehnte bzw. auf eine zwei- bis dreimonatige Dienstzeit im Jahr. Das 1733 eingeführte Kantonsystem erlaubte dem König dann, auf die lückenlose Erfassung der Bevölkerung den Unterhalt eines stehenden Heeres zu gründen. Dabei wurde das Land in sog. Enrollierungskantone eingeteilt, die eine bestimmte Anzahl an Soldaten zur Verfügung stellen mussten. In der Regel wurden die dienstpflichtigen Rekruten bei der Konfirmation durch den Pfarrer registriert (enrolliert) und den Kantonlisten zugeordnet. Auf diese Weise konnte niemand durch die Maschen des Systems schlüpfen. Eine sich aus der eigenen Bevölkerung zusammensetzende Armee bot verschiedene Vorteile gegenüber einem Söldnerheer, dessen Soldaten wesentlich teurer und im Zweifelsfall auch weniger loyal waren.
Abb. 10: Verschärfte Strafen gegen Desertion, 1726
„Allergnädigste Declaration Des geschärfften Edicts von 1723. Gegen die Durchhelffung der Deserteurs; Daß auch diejenige, so von eines, oder des andern Soldaten Desertion, Nur einige Nachricht und Wissenschafft haben, Es aber denen Regimentern, und Compagnien nicht sofort anzeigen / ebenmäßig an Leib und Leben gestraffet werden sollen. Sub Dato Berlin, den 5. Augusti 1726.“
Wurde im Krieg ein Regiment aufgerieben, musste der Kanton für Ersatz sorgen. Weil sich viele fragten, warum sie ihre bescheidene Existenz dem Luxusleben und den Machtgelüsten des Königshauses opfern sollten, wurde jeder Versuch, von der Fahne zu gehen, hart bestraft. Selbst jemand, der einem Deserteur nur behilflich war, musste mit dem Galgen rechnen. Zur Abschreckung hatte ein Blutsverwandter den Platz des Fahnenflüchtigen einzunehmen. Doch alle Repressalien änderten nichts daran, dass sich die Desertion im 18. Jahrhundert zu einem Massenphänomen auswuchs (Kroener 238, Willems 46 f.). In Friedenszeiten machte der Anteil der Kantonisten im preußischen Heer etwa vierzig Prozent aus, wobei die Angehörigen eines Regiments eigene Kirchengemeinden mit eigenen Militärgeistlichen bildeten.
Oft wird der Gegensatz zwischen Friedrich I. und den ihm vorausgehenden brandenburgischen Kurfürsten überbetont. An der Notwendigkeit, dass auch der König von Preußen Steuereinnahmen für seine Politik brauchte, änderte sich nichts. Die Religion war dabei der wichtigste ideologische Faktor, um die Kontinuität der preußischen Herrschaftspraxis abzusichern. Und bereits im 17. Jahrhundert spielte die geistliche Betreuung durch Feld- und Regimentsprediger eine zentrale Rolle für die Schlagkraft der Truppe. „Vor einer Schlacht, die für viele Soldaten das letzte Stündlein war, hatten sie nichts so nötig wie die geistliche Zurüstung durch die Kommunion. Neben der Predigt war die Feier des Abendmahls die wichtigste Aufgabe der Feldprediger.“ (Wallmann 152).
Für das Fernbleiben vom Gottesdienst sah das kurfürstliche Kriegsrecht schwere Strafen vor. Keinesfalls durfte „bey Vermeidung der Straffe des Halss Eisens“ die morgendlichen und abendlichen Betstunden im Feldlager versäumt werden. Stand ein „Treffen oder Sturm“ bevor, wurde eine „extra Bet-Stund“ mit „öffentlicher Beicht und ertheilter General-Absolution“ angesetzt (Bamberg 26). Abschließend sollte ein „schicklich Gebet“ rezitiert werden und das Regiment gemeinsam niederknien: „An solchen Actu würde die Devotion nicht wenig vermehret“ (ebd. 31 f.). Die Feldprediger hatten die Aufgabe, den Soldaten die Angst vor dem Tod zu nehmen und ihnen auch in Extremsituationen die Pflicht zum Gehorsam vor Augen zu halten. Mit dem Ausbau des Militärkirchenwesens setzte Friedrich Wilhelm I. das existierende System der Truppenbetreuung fort. Unter Beibehaltung des alten Mottos „Gut gebetet ist immer halb gesiegt.“ (Weigert 25 f.) wurde es von ihm aber deutlich besser und effizienter organisiert.
Berücksichtigt man noch den militärischen Drill, wurden in Potsdam perfekte Kämpfer und Soldaten herangebildet. In Kombination mit eiserner Disziplin und härtesten Strafen verhalfen ihnen Gottesfurcht und religiöser Glaube dazu, ihre Einsätze selbständig durchzuführen und als freiwillige Pflichterfüllung aufzufassen. Das Prinzip der preußischen Freiwilligkeit bestand aus bedingungsloser Subordination und hatte in der doppelten Furcht vor irdischen und überirdischen Strafmaßnahmen seine wichtigste Stütze.
„Was bei dem gemeinen Mann durch den Appell an das Ehrgefühl nicht bewirkt werden konnte, das musste durch eine strenge, eiserne Disziplin erreicht werden. Dieselbe beruhte vor allem auf dem Grundsatze der unbedingten Subordination, d. i. nicht der passiven Untertänigkeit und Unterwürfigkeit, sondern jenes militärischen Gehorsams, dessen Betätigung sittliche Tüchtigkeit und Selbstbeherrschung erfordert.“ (Preußens Heer 9)
Verstöße gegen die militärische Dienstpflicht wurden deswegen mit Züchtigung, Arrest, Gassenlaufen und nicht selten mit der Todesstrafe „durch Pulver und Blei“ geahndet.
„Durch diese eiserne Disziplin gelang es, die rohe Masse für die hohe Aufgabe des Kriegsheeres, den Schutz der Heimat und des Vaterlandes, heranzubilden und sie mit dem Geiste der mannhaften Zucht und der strengen Pflichterfüllung zu durchdringen, – Eigenschaften, deren Wert noch gesteigert wurde, als die sittlichen Hebel der Kriegerehre, Vaterlandsliebe und Königstreue, hinzukamen.“ (Ebd.)