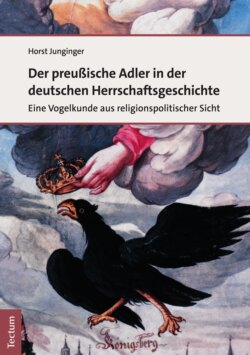Читать книгу Der preußische Adler in der deutschen Herrschaftsgeschichte - Horst Junginger - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Potsdamer Garnisonkirche,
Stammsitz des Adlers
Das Herz der preußischen Militärmonarchie schlug nicht in Berlin, sondern in Potsdam. Als Garnisonstadt par excellence wurde Potsdam im Laufe der Zeit immer stärker von militärischen Anlagen dominiert und vom Geist des preußischen Soldatentums durchdrungen. Weil der Kirchgang zu den elementaren Pflichten aller Staatsbürger und Militärangehörigen gehörte, scheute Friedrich Wilhelm I. keinen Aufwand, um im sumpfigen Gelände eine der Garnisonstadt gemäße Soldatenkirche errichten zu lassen. Zwar musste der erste Fachwerkbau wegen baulicher Mängel wieder abgetragen werden. Doch unter Philipp Gerlach, dem Oberbaudirektor der königlichen Residenzen, wurde in kurzer Zeit ein gigantischer Neubau realisiert.
Die Einweihung der Königlichen Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam wurde am 17. August 1732 mit einem Gottesdienst für die Lutheraner am Vormittag und einem für die Reformierten am Nachmittag begangen. Der König ließ es sich nicht nehmen, an beiden teilzunehmen (Bamberg 181). Im riesigen Innenraum der Kirche fanden annähernd 3000 Gläubige Platz, bei einer Stadtbevölkerung von nur etwa 5500 Personen. Später stieg der Prozentsatz des Militärpersonals auf bis zu 50 Prozent der Einwohner Potsdams an. Um keine teuren Kasernen unterhalten zu müssen, wurden die Soldaten in den Häusern der Zivilbevölkerung untergebracht. Das wiederum ließ die Zahl der unehelichen Kinder in die Höhe schnellen und machte 1724 den Bau eines Militärwaisenhauses notwendig. Zudem stellte Friedrich Wilhelm I. fest, dass viele ihre Kinder nicht im Christentum erzogen, „als welches doch das einzige Mittel ist, wodurch gute Untertanen gemacht werden müssen“ (Potsdam 33). Auf dieser Grundlage ließ er in Potsdam nach Halleschem Muster eine Erziehungsanstalt errichten, in der mit christlicher Unterweisung, militärischem Drill und harter Arbeit Kinder bis zum Alter von 14 Jahren in nützliche Untertanen verwandelt wurden (Kotsch 27–29).
Abb. 3: Potsdamer Riesengarde vor dem Hintergrund der Garnisonkirche
In militärischer wie in religiöser Hinsicht bildete die Garnisonkirche das geistige Zentrum Potsdams. Ihre beeindruckende Höhe von fast 90 Metern korrespondierte mit der Körpergröße der Soldaten des altpreußischen Infanterie-Regiments 9, dessen Mitglieder mindestens sechs Preußische Fuß messen mussten. Nicht nur im Hinblick auf die Größe harmonierten Kirche und Militär. Auch die Pflicht zur bedingungslosen Subordination hatte hier wie dort den gleichen Stellenwert.
An der Spitze des Garnisonkirchenturms verlängerte sich das Kreuz der Königskrone zur Wetterfahne, die einem zur Sonne aufblickenden Adler Sitz bot. In seinen Krallen hielt er ein Blitzbündel, den Donnerkeil. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich das vergoldete Monogramm des Königs FWR: Fridericus Wilhelmus Rex. Es hatte eine Höhe von 2,25 Meter und zeigte an, von woher der Wind wehte. Die Sonne war aus Kupfer gefertigt und hatte einen Durchmesser von 2,40 Meter. Insgesamt wog die Wetterfahne 24 Zentner (Schwipps 35). Um sie im Gleichgewicht zu halten, wurde passenderweise auf der gegenüberliegenden Seite des Adlers neben den Initialen FWR eine Kanonenkugel angebracht.
Abb. 4: Wetterfahne bei der Instandsetzung, 1927
Abb. 5: Wetterfahne der Potsdamer Garnisonkirche, Animation 2013
Der preußische Adler auf dem Turm der Garnisonkirche symbolisierte das Vertrauen, das der König auf Gott, den Herrn der himmlischen Heerscharen, setzte. Dem vertrauensvollen Blick des Adlers nach oben zu ihm entsprach auf der horizontalen Machtebene die neue Frontstellung Preußens gegen Frankreich. Dessen „Roi-Soleil“ hatte sich die Sonne zum Symbol seiner Herrschaft erkoren, um seinem absoluten Machtanspruch adäquaten Ausdruck zu verleihen. So wie Ludwig XIV. im Zentrum des höfischen Absolutismus stand, so sollten die anderen Mächte um Frankreich als Mittelpunkt des politischen Sonnensystems in Europa kreisen. Friedrich Wilhelm I. wollte sich als Protestant mit diesem Anspruch des katholischen Gottesgnadentums nicht abfinden. Er sah im Sonnenkönig seinen Hauptgegner und stellte dem Motto Ludwigs XIV. Nec pluribus impar („Auch nicht mehreren unterlegen“) den Wahlspruch Non soli cedit („Nicht einmal der Sonne weicht er“) entgegen. Niemand sollte Zweifel daran haben, dass Preußen vorhatte, Frankreich Konkurrenz zu machen:
„Zur damaligen Zeit regierte in Frankreich der Sonnenkönig Ludwig XIV., mit dessen Truppen sich die Brandenburger schon in manchem heißen Kampf gemessen hatten. Jene trugen ihrem Königlichen Herrn zu Ehren auf ihren Feldzeichen eine oder mehrere strahlende Sonnen. Dass die junge aufstrebende Macht der brandenburgischen Kurfürsten aber nicht gesonnen war, sich vor dem großmächtigen Frankreich ängstlich ins Mauseloch zu verkriechen, sollte der Adler, der mit dem Schwert und den zuckenden Blitzen in den bewehrten Fängen die Sonne angeht, zum Ausdruck bringen.“ (Lezius 28 f.)
In einem ähnlichen Duktus schrieb der Potsdamer Denkmalpfleger Andreas Kitschke, dass sich in dem Wahlspruch Non oder Nec soli cedit das neue Selbstbewusstsein des jungen Staates Preußen manifestierte, „der im Begriff war, eine europäische Großmacht zu werden. Der preußische Adler erhob sich gegen die Rangordnung in Europa. Die französische ‚Sonne‘ begann zu sinken.“ (Kitschke 1991, 8) Immer wenn man vom militärischen Katechismus des Soldatenkönigs abwich, sei es mit Preußen abwärts gegangen, doch „wo man sich auf die ursprünglichen Soldatentugenden besonnen hat, da ist der preußische Adler in seinem Fluge aufwärts gestiegen. Der Adler, der in seinen Fängen den Spruch trägt: Nec soli cedit – selbst der Sonne weicht er nicht!“ (Zappe 11)
Ein paar Jahre vor der Garnisonkirche in Potsdam schmückte der Leitspruch des Königs bereits die Berliner Garnisonkirche, wo er über jedem Eingang und an der Kanzel zu lesen war: „Kampfbereit schaute der Adler, der ein Blitzbündel gegriffen hatte, zur vergoldeten Sonne auf.“ (Bamberg 220) Auch die Dukatmünze mit dem Konterfei Friedrich Wilhelms I. aus dem Jahr 1713 zeigt auf der Rückseite einen Adler in aggressiver Angriffshaltung gegen die Sonne fliegen. Über der Sonne steht in Großbuchstaben: NEC SOLI CEDIT. Im königlichen Siegel und im Fahnenmuster der königlichen Regimenter hatte der die französische Sonne angreifende preußische Adler ebenfalls einen prominenten Platz (Schobeß 48, Kündiger 76 f.): NON SOLI CEDIT.
Abb. 6: Siegel der Berliner Garnisonkirche
Abb. 7: Siegelmarke der Königlichen Garnisonkirche zu Berlin, 1722
Abb. 8: Kompaniefahne des Königs-Regiments No. 6, Fahnenmuster 1713–1717
Die königliche Losung des Non oder Nec soli cedit konnte sich unmöglich gegen Gott oder Jesus gerichtet haben. Eine solche Interpretation ist völlig abwegig. Wie käme der preußische König dazu, sich gegen die göttliche Sonne zu erheben?
Im Innenraum der Garnisonkirche befand sich die Allegorie des auffliegenden Adlers in geschnitzter Form an den Bänken, am Kanzelkorb und an der Orgel, wo die Sonnen durch ein mechanisches Getriebe in Drehung versetzt werden und die Adler drohend mit den Flügeln schlagen konnten (Kitschke 1991, 8).
Abb. 9: Innenraum der Potsdamer Garnisonkirche
Friedrich der Große (1712–1786) änderte später den preußischen Wahlspruch Nec soli cedit in Pro Gloria et Patria („Für Ruhm und Vaterland“). Die Teilnahme Frankreichs am Siebenjährigen Krieg veranlasste ihn dann trotz seiner frankophonen Neigungen, das alte Nec soli cedit am Giebel des 1769 fertiggestellten Neuen Palais als Gegenmotto zum französischen Nec pluribus impar („Auch mehreren nicht unterlegen“) anzubringen (Hüneke 2014, 20).
Weil die Garnisonkirche dem direkten Patronat des Königs unterstand, waren in ihr Gottesfurcht und Königstreue besonders eng miteinander verflochten. Christentum und Soldatentum bildeten dabei eine im wahrsten Sinne des Wortes schlagkräftige Einheit. Der gefürchtete Rohrstock des Königs und der körperliche Drill des in Potsdam allgegenwärtigen Exerzierens fußten auf dem strengen Ordnungsprinzip von Befehl und Gehorsam, das in der Garnisonkirche religiös abgesichert wurde. So wie Friedrich Wilhelm I. die Regeln der militärischen Ausbildung bestimmte, so legte er auch die Ausschmückung der Kirche und den Ablauf der Gottesdienste fest. Anlässlich der Einweihung der Garnisonkirche verfügte er:
„Des Sonntags allemahl sollen die Regimenter ordentlich Compagnie weise, so wie sie in Bataillon stehen, herein geführt werden. Wenn die Regimenter nach ihrem Rang herein marschirt, als dann folget das Bataillon Artillerie, als dann wird zwey Gesange halten, dann wird das Evangelium abgelesen, dann ein Lied, Vater unser, die Predigt, als dann der Segen und wieder ein Lied, als dann ist der Gottes Dienst vorbey.“ (Gass 37)
Als Simultankirche diente die Garnisonkirche nicht nur der lutherischen Militär- und Zivilgemeinde als religiöse Heimstatt. Zugleich war sie reformierte Hofkirche und königliche Grablege der Hohenzollern. Der calvinistische Glaube des Königs drückte sich in einer betont schlichten und auf religiösen Schmuck verzichtenden Ausgestaltung des Kirchenraums aus. Was beide Konfessionen jedoch einte, war die militärische Symbolik. Innen wie außen strotzte die Kirche nur so vor soldatischen Hoheitszeichen und Trophäen. Selbst die Engel trugen Helme und verliehen der Kirche mit den antiken Figuren des Kriegsgottes Mars und der Kriegsgöttin Bellona (von lat. bellum „Krieg“) das Gepräge eines Militärtempels.
Der Gottesdienstbesuch gehörte zu den elementaren Dienstpflichten jedes Soldaten. Er hatte in der Kirche Montur zu tragen und wurde am Eingang kontrolliert, ob die Uniform richtig saß und in allem den Vorschriften entsprach. Obwohl der königliche „Drillmeister“ befahl, die Predigten kurz, bündig und kräftig zu halten, stieß die christliche Glaubensunterweisung bei den großenteils analphabetischen Soldaten auf keine große Gegenliebe (Rudolph 209). Das tat dem religiösen Erziehungsansatz des Königs allerdings keinen Abbruch. Aus seiner Sicht ließen sich Zucht und Ordnung nur mit Hilfe der Religion aufrechterhalten: Ein „Kerl, welcher Gott nicht fürchtet“, wird „schwerlich seinem Herrn treu dienen und seinen Vorgesetzten rechten Gehorsam leisten.“ (Gass 82)