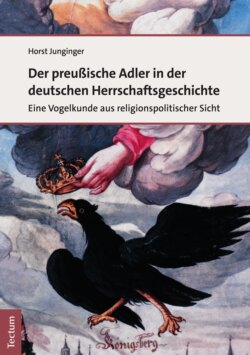Читать книгу Der preußische Adler in der deutschen Herrschaftsgeschichte - Horst Junginger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKönig des Himmels
Der Adler symbolisiert von alters her Weitblick, Mut, Kraft und Unsterblichkeit. Er ist der König der Lüfte. Schon in der Antike wurde ihm als Beherrscher des Himmels eine besondere Nähe zu den Göttern attestiert. Wegen seiner achtungsgebietenden Eigenschaften ist der Adler nach dem Löwen das am häufigsten verwendete Wappentier in der Heraldik. Die machtorientierten Römer übertrugen das Adlermotiv vom Aufstieg in den Himmel auf die Repräsentanten der politischen Herrschaft. Es bot sich an, den Gedanken der Himmelsnähe auf die Kaiser Roms anzuwenden und ihnen den Ehrentitel Divus (der Göttliche, weiblich Diva) zu geben. Durch seine besondere Beziehung zu den himmlischen Göttern sorgte der Adler für das Wohlergehen des Volkes. Er konnte deshalb Respekt und Verehrung erwarten. Weltliche Interessen und die eigene Regentschaft auf höhere Mächte zurückzuführen, gehörte aber nicht nur zu den Herrschaftstechniken der Römer. Mit einem unmittelbaren Auftrag Gottes ausgestattet zu sein, begründete auch den Machtanspruch von Papst und Kaiser im christlichen Mittelalter. Die Kirche bestand darauf, dass es außer ihr keine andere Instanz geben durfte, um die Beziehung zwischen der weltlichen und überweltlichen Macht aufrechtzuerhalten.
Die leicht nachvollziehbare Vorstellung, dass der Adler bei seinem Auffliegen in die Sonne blickt, ließ ihn zum christlichen Sinnbild für den Aufstieg der Seele in den Himmel werden. Dort, in der Sphäre Gottes, erlangt der Mensch Erlösung und Unsterblichkeit. Das Dogma der leiblichen Himmelfahrt Christi (Ascensio Domini) bezeugt die Erhebung der menschlichen Natur in den Zustand der göttlichen Herrlichkeit. Am vierzigsten Tag nach Ostern feiert die Kirche mit diesem Fest die Rückkehr des Sohnes zum „Vater unser, der Du bist im Himmel“, wie es im wichtigsten christlichen Gebet heißt. Würde Gott nicht im Himmel thronen, hätte der Sonnenflug des Adlers keine religiöse Symbolkraft. Dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung Garnisonkirche, Wolfgang Huber, ist deshalb zuzustimmen, dass Sonne und Adler wichtige Symbole des christlichen Glaubens sind. Auch die Beteuerung des Altbischofs, dass der Adler „für einen Aufstieg‚ beflügelt vom Glauben an Gott“ steht (PNN 2014), klingt überzeugend.
Der Wiederaufbau der Garnisonkirche und die Fertigstellung einer drei Tonnen schweren, 200000 Euro teuren und mit einem goldenen Adler an der Spitze des Kirchturms versehenen Wetterfahne würdigt den Aufstieg Preußens in einer dem entsprechenden Weise. Wie die Potsdamer Neuesten Nachrichten am 10. Mai 2014 außerdem berichteten, hätten sich neben Wolfgang Huber auch der frühere brandenburgische Innenministier Jörg Schönbohm, Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel sowie Altbundespräsident Richard von Weizsäcker zuversichtlich über die baldige Fertigstellung des Garnisonkirchenturms gezeigt (ebd.). Ein dreiviertel Jahrzehnt danach geht der von maßgeblichen Repräsentanten in Politik und Kirche verfolgte Plan – zumindest was den Kirchturm betrifft – seiner Erfüllung entgegen. „Meinem Mann lag der Wiederaufbau sehr am Herzen, die Kirche war mit seinem Leben verbunden,“ sagte Marianne von Weizsäcker über das Engagement ihres 2015 verstorbenen Gatten (PNN 2019). Die emotionale Verbindung zur Garnisonkirche hatte mit den Gottesdiensten zu tun, die Richard von Weizsäcker dort als junger Mann feierte. 1938 war er mit 18 Jahren Mitglied des Potsdamer Infanterie-Regiments 9 geworden, in deren Hauskirche von einer friedenspolitischen Agenda allerdings nicht die Rede sein konnte. Ganz im Gegenteil: Wie in den zweihundert Jahren davor, so diente die Garnisonkirche auch für ihn der religiösen Zurüstung zum Krieg, der Richard von Weizsäcker Ende 1941 bis kurz vor Moskau führte (Nayhauß 1994).
In der von Wolfgang Huber, dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD, dem preußischen Adler zugesprochenen Vermögen, zwischen dem Glauben an Gott und der Herrschaftslegitimierung durch den Glauben an Gott eine symbolische Verbindung herzustellen, findet die ideologische Dimension des Streits um die Garnisonkirche ihren adäquaten Ausdruck. Das griechische Verb symbállein bedeutet seinem Ursprung nach „zusammenbringen“. Dinge oder Interessen werden zu einem Sinnkomplex zusammengeführt, der den Bereich des bloß Materiellen und Rationalen transzendiert. In religiösen Symbolen manifestiert sich die Teilhabe des Menschen an der numinosen Qualität des Heiligen.