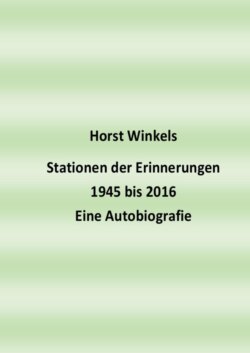Читать книгу Stationen der Erinnerungen 1945 bis 2016 - Eine Autobiografie - Horst Winkels - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSTATION I BEHÜTET
1944 – 1951
Gezeugt hat mich mein Vater im April 1944. Meine Eltern sind Hans-August und Gerda Winkels. Gerda, geborene Schölwer, entstammte einer eingesessenen Familie in Gelsenkirchen-Buer. Mein Vater Hans, damals bei der Reichswehr, wuchs bei seinen Eltern Hans und Henriette mit zwei Schwestern in Herten-Westerholt in der Nähe von Buer auf.
Im Bauch meiner Mutter wohnte ich, ungeborener Weise, bei meinen Großeltern Hermann und Maria in Gelsenkirchen-Buer. In einer Bombennacht, Ende 1944, wurde das Wohnhaus der Großeltern völlig zerstört. Unter den Trümmern fand man mit meiner Mutter auch mich in ihrem Bauch, beide unverletzt.
Da das Leben in den Städten, besonders des Ruhrgebietes, damals gegen Ende des Zweiten Weltkrieges sehr gefährlich war, wurden Teile der Bevölkerung, vor allem Frauen und Kinder, evakuiert. So landete ich im Teutoburger Wald in der Nähe von Detmold, in Bad Meinberg. Hier kam ich am 20. Januar 1945 zur Welt.
Nachdem der Krieg vorbei war und mein Vater aus Griechenland zurückkehrte, bildeten wir drei eine kleine Familie. Da mein Vater beim Ruhrbergbau im Labor beschäftigt war, bezogen wir einen betriebseigenen Neubau, der noch zu Nazi-Zeiten fertiggestellt worden war in der Buerschen Resser Mark.
Nach eineinhalb Jahren kam mein Bruder Peter zur Welt.
Einige Dinge und Schlüsselerlebnisse der damaligen Zeit sind für mich noch heute präsent. So war z. B. alles knapp. Es musste vieles „organisiert“ werden, das heißt, es mussten ständig Wege gefunden werden, dringend benötigte Dinge des Alltags zu beschaffen.
Wir zählten damals eindeutig zu den Privilegierteren, weil Opa Hermann zusammen mit seinem Bruder Theodor eine Bäckerei betrieb und außerdem eine Schwester meines Vaters mit einem Bauern verheiratet war, die im Vorgebirge in der Nähe von Bonn lebte. Aus diesen Quellen schöpften und überlebten wir.
Wenn es aber darum ging, anderes wie z. B. Kleidung für uns Kinder oder anderes aus der Non-Food-Abteilung des Bedarfs zu beschaffen, brauchte man Geld.
Die Angestellten des Ruhrbergbaus hatten ein jährliches Anrecht auf einige Zentner Kohlen. Dieses Deputat, ausschließlich für den Eigenbedarf der Empfänger bestimmt, war aber auch ein Kapital, das darauf wartete, verflüssigt zu werden.
Nun kam meine Mutter ins Spiel. Der Begriff Kohlenschieber war damals nicht negativ belegt und gang und gäbe. Kohlenschieber waren die, die nachts mit ihren klapprigen, meist dreirädrigen, kleinen Lieferwagen vor den Häusern standen. Es waren die Ehefrauen und Mütter, die dann, meist ohne Wissen ihrer Männer, auftauchten, mit den Kohlenschiebern in den Keller gingen, wo dann gegen Bargeld der eine oder andere Sack Deputat-Kohlen den Besitzer wechselte.
Mein Vater tat immer sehr erstaunt, wenn Mutter mit Stolz die Dinge vorzeigte, die sie mit diesem Geld gekauft hatte. Offiziell durfte er von Mutters Kohlenschiebereien natürlich nichts wissen.
Nachdem unsere Familie in die Nähe von Vaters Arbeitsplatz umgezogen war, in die Westfalenstraße in Gelsenkirchen-Buer, gingen Peter und ich in den Kindergarten Sankt Ludgeri. Das muss für mich recht langweilig gewesen sein, denn an Details aus den Kindergartentagen kann ich mich nicht erinnern.