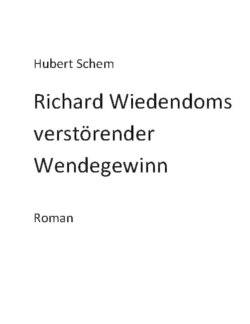Читать книгу Richard Wiedendoms verstörender Wendegewinn - Hubert Schem - Страница 3
Оглавление3
Richards vertrauensvoller Auftrag ging zu Lasten eines Projekts, das mir schon viele Jahre unscharf vorgeschwebt, das ich aus wechselnden Gründen aber nie in Angriff genommen und schließlich auf die Zeit nach meiner Emeritierung verschoben hatte. Ich wollte mit einer zündenden populärwissenschaftlichen Abhandlung einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führen, welche schädlichen Auswirkungen sprachliche Schlamperei auf das Bewusstsein der denkenden und handelnden Bürger und damit auf wirtschaftliche und politische Entscheidungen haben kann. Als Beispiel dafür wollte ich einen Begriff unter die Lupe nehmen, der in den verschiedensten Fach- und Rechtsgebieten sowie im Alltagsleben von Millionen eine höchst bedeutsame Rolle spielt: das Unternehmen.
Als Student im ersten Semester hatte ich gelernt, die zwei großen Begriffe Rechtssubjekt (oder auch Rechtsinhaber) und Rechtsobjekt (oder auch Rechtsgegenstand) strikt voneinander zu unterscheiden: Wer Rechtssubjekt sein kann, kann niemals Rechtsobjekt sein, und umgekehrt. Ein juristischer Laie, aufgefordert, Gründe für die eindeutige Abgrenzung zu nennen, würde vermutlich spontan die Schwergewichte Sklaverei, Leibeigenschaft und Frauenkauf anführen. Menschen als Objekte im Rechtsverkehr – das ist heute nicht mehr ernsthaft diskutabel. Das wäre eine krasse Verletzung der Würde des Menschen, die im Grundgesetz als unantastbar garantiert wird. Die inzwischen übliche Schreib- und Sprechweise der Sportjournalisten, wenn sie vom sogenannten Spielermarkt berichten oder von einzelnen Fußballprofis, die den Verein wechseln wollen oder sollen, kennt zwar längst keine Anführungszeichen oder ironisierenden Adjektive mehr – Kauf und Verkauf, Anschaffungspreis und Amortisation werden wie bei einem Sachgegenstand verwendet -, aber ich wage nicht zu entscheiden, ob diese Sprachrohheit lediglich eine zur Gewohnheit gewordene Provokation sein soll oder ob den Schreibern das Ungeheuerliche ihrer Schreibweise nicht im geringsten bewusst ist.
Trotz solcher Entgleisungen scheint es mir immer noch einfach für jeden Laien wie auch für jeden Juristen, die Unterscheidung immer und überall zu beachten, wenn es darum geht, Menschen nicht als Sachen zu behandeln. Aber gilt das auch für juristische Personen als Rechtssubjekt? Und ist es ein eben so starkes Tabu, einem Rechtsobjekt niemals Rechte zuzuweisen? Schon in meinem fünften Semester fing ich an, mich mit solchen Fragen herumzuschlagen. Weil ich entdeckte, dass im sogenannten Unternehmensrecht, namentlich im Aktiengesetz, selbst der Gesetzgeber die Unterscheidung nicht rigide durchgehalten hat: Mal erscheint das Unternehmen als Rechtsobjekt, mal wie ein Rechtssubjekt, mal als schillerndes Mittelding. Wie trotz der Beteiligung zahlreicher Juristen in den Ministerien ein derartiger sprachlicher Wechselbalg entstehen konnte, ist mir unbegreiflich. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig sind nur die Folgen. Und deren negatives Ausmaß ist evident: Der Begriff Unternehmen ist inzwischen so vieldeutig, dass er sich dem Zugriff scharfsinniger Juristen und Laien entzieht und fast jeder an die Wurzeln gehenden Kritik geschmeidig ausweicht. Nicht zuletzt dieser Begriffsverwirrung ist es zuzuschreiben, dass die Verantwortlichen für katastrophale Fehlentwicklungen oder kriminelle Machenschaften innerhalb eines Unternehmens nicht namhaft gemacht werden. Der Unternehmer als Mensch mit Fleisch und Blut oder als juristisches Gebilde, hinter dem letztlich auch immer Menschen mit Fleisch und Blut stehen, ist fast aus der deutschen Sprache verschwunden. Er wurde verschmolzen mit dem komplexen Rechtsgegenstand, der ursprünglich als Unternehmen bezeichnet wurde. Seitdem ist der Begriff nicht mehr fassbar. Ein Mythos wurde gezeugt und geboren. Ein schillerndes oder auch schwammiges Gebilde. Nein, kein Gebilde, sondern ein Konstrukt – ein reines Geistesprodukt ohne materiellen oder ideellen Gehalt. Aber ein Konstrukt, das sehr gezielt im politischen Alltag herumgeistert und schwerwiegende politische Entscheidungen bestimmt. Einerseits sind Unternehmen angeblich schöpferisch, gehen Risiken ein, schaffen Arbeitsplätze, sind äußerst sensibel, können schrecklich leiden, insbesondere weil sie Steuern zahlen sollen, brauchen Subventionen, um ihren sozialen Auftrag erfüllen zu können – haben also alle Eigenschaften eines Subjekts. Trotz ihrer ausgeprägten Sensibilität können Unternehmen andererseits nicht nur gegründet und liquidiert, sondern auch verkauft, verpachtet, mit anderen Unternehmen verschmolzen und zergliedert werden – sind also Objekte des Rechtsverkehrs. Dass dieser Wahn zu einem guten Teil auch mitschuldig ist für das unterentwickelte Niveau der Auseinandersetzungen auf wirtschaftlichem Gebiet, scheint mir sehr naheliegend.
Ich hatte mir vorgenommen, die Begriffsverwirrung und ihre verheerenden Folgen deutlich zu machen und ein flammendes Plädoyer dafür zu halten, den missratenen Begriff Unternehmen aus dem deutschen Wortschatz zu tilgen. Dabei ging es mir keinesfalls um schlichte Beckmesserei. Vielmehr hatte ich mir vorgestellt, wie ich anhand dieser Fehlentwicklung demonstrieren würde, dass es eine Wechselwirkung zwischen klarem Denken, eindeutigem Sprechen, gradlinigem Handeln und unabdingbarer Verantwortung gibt.
Nachdem ich die Herausforderung durch Richard angenommen hatte, rückte dieses Projekt in den Hintergrund.
Der Sog der Praxis hatte mich erfasst. - Womöglich eine letzte Bestätigung dafür, dass die Weichen für meine Berufslaufbahn vor vierzig Jahren falsch gestellt wurden. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Richard ein begnadeter Rechtswissenschaftler und -lehrer geworden wäre, während ich selbst nach meiner eigenen Einschätzung nie über das Mittelmaß hinausgewachsen bin. Dazu muss ich anfügen, dass das Mittelmaß von Leistungen für mich keine schlechte Bewertung ist. Die schlichte Logik sagt mir, dass es sich aus besseren und gleichviel schlechteren Leistungen ergibt. Wenn alle besser werden, wird sich auch das Mittelmaß verändern. Mir mangelte es immer an dem absolut störungsfreien Antrieb zum Erreichen des Außergewöhnlichen. Unbedingter Glaube, vorbehaltslose Liebe und unerschütterliche Hoffnung sprudelten mir nicht dauerhaft als Quellen der Zielstrebigkeit. Dagegen spricht vieles dafür, dass ich die Last besser geschultert hätte, die Richard von seinem Vater aufgebürdet wurde. Leider stand uns damals ein solches Wahlrecht nicht zu. So blieb uns beiden nichts übrig, als sich mit den Gegebenheiten, die wir nicht verändern konnten oder wollten, nach besten Kräften zu arrangieren. Mein Hirn schaffte es allmählich, mir durch feinziselierte Abstraktionen Vergnügen zu bereiten, während Richard – leider allerdings ohne finanziellen Nutzen für sein eigenes Unternehmen - beachtliche technische Neuerungen auf dem Gebiete des Bauwesens initiierte oder förderte, obwohl sein Herz immer noch der Juristerei gehörte.
Sofort nach Richards eindrücklicher Schilderung begann mein altes Juristenhirn auf jene Weise zu arbeiten, die das Blut eines deutschen Rechtsprofessors schneller und intensiver in Wallung bringt als alle bekannten Stimulanzien – ein für Nichtjuristen befremdliches, wenn nicht sogar lächerliches Phänomen. Ich sah eine zunächst namenlose Teilfläche unserer Mutter Erde durch einen Rechtsakt als eigenständiges Grundstück entstehen. Erdstück wurde Grundstück. Dieser Schöpfungsakt war vollendet, als das in der Natur vermessene, durch Grenzsteine markierte, im Kataster durch fachmännische Bezeichnungen von allen anderen Teilen der Erdfläche unterschiedene Erdflächenstück im Grundbuch von Rostock als separater Gegenstand des Rechtsverkehrs eingetragen wurde. Ich verkniff es mir, Mutmaßungen über die Gründe des Eigentümers, von dem Richards Vater das Grundstück 1938 erwarb, für den Verkauf anzustellen. Aber es fiel mir nicht schwer, mir die wirtschaftliche Bedeutung des Grundstücks im Zweiten Weltkrieg für die Baustoffhandlung Philipp Wiedendom GmbH auszumalen. In einem großen schwarzen Loch lagen jedoch die Gründe dafür verborgen, dass der Volksgerichtshof im Herbst 1944 Philipp Wiedendom zum Tode verurteilte und sein gesamtes Vermögen einzog.
Der Übergang des Eigentums vom Deutschen Reich oder irgendeiner Unterorganisation des Reichs auf „das Volk“ entsprach dem Normalverlauf nach dem Krieg in der sowjetisch besetzten Zone. Das weitere Schicksal des Grundstücks war nicht im einzelnen feststellbar. Irgendwann muss es dem Volkseigenen Betrieb Schiffswerft Anker zur Nutzung zugeordnet worden sein.
Das Grundstück wurde mit anderen volkseigenen Grundstücken, die bereits zum Bestand der Werft gehörten, verschmolzen. Damit war seine Existenz als eigenständiges Grundstück zu Ende. Wahrscheinlich diente es nach damaliger Sprachregelung in hervorragender Weise dem Aufbau eines neuen Staates. Eines Staates mit Riesenambitionen, wie es bei den Landsleuten von Hegel, Marx und Engels nicht verwunderlich ist. Das realsozialistische Gegenmodell zur Bundesrepublik Deutschland, dem angeblichen Musterschüler des monopol-kapitalistischen Imperialismus. Riesenambitionen – immer wieder verkündet und dem Volk eingebläut. Nach einundvierzigjähriger Existenz sang- und klanglos wieder aus der Geschichte abgetreten. Kein Schuss von Angreifern oder Verteidigern. Unblutig und undramatisch – jedenfalls nach den landläufigen Vorstellungen von Dramatik in der Geschichte. Schleichender und schließlich galoppierender Staatsbankrott. Abstimmung der Bürger mit den Füssen, die Mittel und Wege finden, das Land zu verlassen. Mutige Demonstranten in rasch wachsender Menge auf den Straßen. Passivität der Großen Sozialistischen Brudernation. Verwirrung. Missverständnisse über die Beschlusslage. Ungewollte Öffnung der Grenze. Eine kurze Phase eigenständiger demokratischer Experimente. Wiederherstellung der alten Länder in der DDR. Währungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Zaubermittel Deutsche Mark. Und schließlich, wie von der großen Mehrheit der demokratisch gewählten Volkskammer beschlossen: Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Ende der DDR. Da die Rechtsordnung der Bundesrepublik kein „Eigentum des Volkes“ im Sinne der ehemaligen DDR kennt, ist dieser Begriff seit dem 3. Oktober 1990 Teil der Rechtsgeschichte. Und nun ...?
Der konkrete Einzelfall des zu einer bedeutenden volkseigenen Werft in Rostock gehörenden Flurstücks ließ mich das Ausmaß der Herausforderung für Juristen, Ökonomen und andere Merker und Macher ahnen, die darin besteht, nicht nur die einundvierzig Jahre eines sozialistischen Experiments vermögensrechtlich so weit wie möglich wieder rückgängig zu machen, sondern auch die materielle Wiedergutmachung des Nazi-Unrechts, vor der sich die DDR-Regierung wie vorher schon die sowjetische Militäradministration immer gedrückt hatte, nachzuholen. Als ich mir dies alles vorstellte und mir klarmachte, dass es in der Rechts- und Wirtschaftsgeschichte weltweit keinen vergleichbaren Vorgang gab und je gegeben hatte, spürte ich, wie es in mir vibrierte. Das ist Praxis. Das ist Leben. Das ist etwas ganz anderes als eine Abhandlung zu schreiben, die sich mit einer vagen Vorstellung von der Wirkungsmacht des Wortes verbindet. Und was für ein Einzelfall in diesem historischen Rahmen! Mehr als sechzig Jahre lag im konkreten Fall das Ereignis zurück, dessen rechtliche Einordnung vielleicht darüber entscheiden würde, ob mein Freund Richard Wiedendom sich in absehbarer Zeit zu den Millionären zählen konnte oder ob er seinen Ruhestand mit sehr bescheidenen Mitteln bestreiten musste. So etwas stand in keinem Lehrbuch.
Richard hatte mir erzählt, dass es ihm im Sommer 1990 nur nach hartnäckigen Verhandlungen mit einem pflichtbewussten Pförtner gelungen war, auf das Werftgelände gelassen zu werden. Mit einer Mischung aus prickelnder Neugierde, Erinnerungsfetzen und wachsendem Unbehagen hatte er versucht, das frühere Wiedendom-Grundstück auf dem weitläufigen Gelände zu finden. An einer Verzweigung der Hauptwerkstraße war ihm dann plötzlich klar geworden, dass er nichts mehr von den Merkmalen des Grundstücks, die er noch in Erinnerung hatte, finden würde. Keine Kies- und Sandberge, keine Gleisanlage mit beladenen und leeren Loren, kein Entladekran am betriebseigenen Kai, nichts mehr von der großen Baracke mit einem Büroteil, einem Aufenthaltsraum für die Belegschaft und mit einer kleinen Wohnung. Wie aus einem Traum in die nüchterne Wirklichkeit erwacht, war er umgekehrt, hatte seinen Passierschein wortlos beim Pförtner abgegeben und war zu seinem außerhalb abgestellten Wagen geeilt.
iIm Frühjahr 1997 konnten Richard und ich problemlos mit dem Wagen auf das Werftgelände fahren. Die Pförtnerloge war unbesetzt. Niemand hielt uns auf. Nichts von dem vage erwarteten Konzert kreischender, dröhnender, zischender, knallender Maschinen, sondern eine unbehagliche Stille. Dämmrige Werkshallen. Und nur hier und da einzelne Arbeiter auf dem Gelände.
Wir wurden im Verwaltungsgebäude erwartet. Die mächtigen Anlagen des benachbarten Reparaturdocks verwiesen den ansehnlichen Klinkerbau auf einen bescheidenen Rang. Ein einfacher Büroraum war zum Besprechungszimmer umfunktioniert worden. Hier zwang kein ausladender Konferenztisch die Teilnehmer, sich in eine Frontlinie einzuordnen. Nach zurückhaltend-freundlicher Begrüßung glaubte ich sekundenlang bei den Werftvertretern eine Mischung aus Anspannung, Unsicherheit, Bereitschaft zur Interessenvertretung und Resignation zu erkennen. Der Geschäftsführer der Anker Schiffswerft GmbH, die im Mai 1990 aus dem Volkseigenen Betrieb hervorgegangen war, wurde von zwei Abteilungsleitern und einem jungen Rechtsanwalt unterstützt. Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen war durch drei Juristen vertreten. Von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) – neuer Name der ehemaligen Treuhandanstalt - war zu meinem Bedauern niemand erschienen. Obwohl der Geschäftsführer diese Tatsache als unwesentlich darzustellen versuchte, war mir sofort klar, dass die auf Initiative des Landesamtes anberaumte Besprechung unter diesen Umständen nicht zu einem schnellen Ergebnis führen konnte. Auch wenn wir mit den Werftvertretern zu einer abschließenden Einigung kamen, konnten wir nicht sicher sein, ob das Verfahren damit beendet wäre. Die BvS als einzige Gesellschafterin der GmbH hatte sich generell vorbehalten, derartige Einigungen zu genehmigen.
Der Referatsleiter des Landesamtes führte konzentriert und um strikte Neutralität bemüht in den Verhandlungsgegenstand ein. Tatsachen, die den Rückgabeanspruch begründen, andere Tatsachen, die ihm entgegenstehen könnten. Unklarheiten, Zweifelsfragen. Ich bemühte mich, die wichtigsten Daten zu notieren und gleichzeitig die strategischen Konsequenzen für mich als Verfahrensbevollmächtigten Richards zu bedenken.
Abschließend bat der Referatsleiter den Geschäftsführer der Werft, die wesentlichen Stationen der Entwicklung der Werft seit der Wende darzustellen, eine realistische Prognose für die kommenden Jahre abzugeben und insbesondere darzulegen, inwiefern das zurückverlangte Grundstück betriebsnotwendig war, noch sei und bei wirtschaftlich vernünftiger Betrachtungsweise voraussichtlich auch bleiben werde. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist eine Rückgabe ausgeschlossen, wenn zwar alle Tatsachen erwiesen sind, die den Anspruch auf Rückgabe begründen, wenn jedoch das Grundstück für einen Gewerbebetrieb zum Zeitpunkt der Wende lebensnotwendig war und es seitdem geblieben ist. Auf diese Weise wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Arbeitsplätze durch die Rückgabe von Grundstücken an frühere Eigentümer oder deren Erben vernichtet wurden.
Der Geschäftsführer sprach präzise und emotionslos. Totaler Verlust aller Auftraggeber mit dem Zusammenbruch der Staatswirtschaft in den Ländern des Ostblocks. Schnellste Orientierung am freien Markt. Notwendigkeit, sich in die gegebenen Strukturen des Westens einzufügen. Verzicht auf den Bau von neuen Schiffen. Statt dessen Spezialisierung auf Schiffsreparaturen und -wartung. Zwei Ansätze zur Privatisierung gescheitert, weil die Investoren den Mund zu voll genommen hatten. Jetzt brandneue Kontakte zum Kapitaleigner einer renommierten westdeutschen Werft. Im Moment mäßige Auslastung, aber durchaus Chancen für die Erhaltung von etwa fünfhundert Arbeitsplätzen von einstmals über zweitausend. Mehrere hundert Mitarbeiter in einer Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft „geparkt“. Es wäre wirtschaftlich fatal, diese qualifizierten und spezialisierten Mitarbeiter auf Nimmerwiedersehen zu entlassen. Insofern absolute Betriebsnotwendigkeit der Halle, die von dieser Gesellschaft genutzt wird. Nutzung einer weiteren Halle derzeit für betriebsinterne Reparaturarbeiten, zugegebenermaßen nicht sehr intensiv. Aber schweres Hemmnis bei den Privatisierungsverhandlungen, wenn ein derartig wertvoller Teil aus dem Gelände herausgeschnitten werden müsste. Im übrigen Nutzung für die jeweiligen Produktionszwecke der Werft seit der Wende.
Auf eine Frage des Referatsleiters, wie die beiden Hallen technisch mit dem übrigen Grundstück verflochten seien, kam der Vorschlag, sich dies im Gelände anzusehen. Vor Ort machten wir eine banale Erfahrung: Was auf der Flurkarte vollkommen klar erschien, hatte im Gelände keine Entsprechung. Die exakt bestimmten Grenzen in den Katastern Deutschlands, die das Land zu einem riesigen Flickenteppich aus Hunderttausenden von Flurstücken macht, finden sich in der Natur nicht vor. Wir versuchten uns anhand der auf der Flurkarte eingezeichneten Strassen und der Wassergrenze zu orientieren, konnten aber trotzdem nicht genau bestimmen, wo die Flurstücksgrenzen verliefen. Der technische Leiter der Werft hob hervor, dass die gesamte sichtbare und unsichtbare Infrastruktur des Werftgeländes eine technische Gesamtheit sei, die keine Flurstücksgrenzen kenne. Auf meine Rückfrage räumte er jedoch ein, über kurz oder lang, müssten sowohl die Versorgungsleitungen als auch die Abwasserkanäle erneuert werden. Und auf mein weiteres Insistieren bestätigte er meine Vermutung, dass auch die Werkstraßen in absehbarer Zeit zum Teil neu geführt werden müssten.
Der anschließende Meinungsaustausch war geprägt von Hypothesen. Wie wäre die Rechtslage, wenn ...? Welche Rechtsfolgen träten zwangsläufig ein, wenn diese oder jene Annahme sich als richtig oder als falsch erwiese? Mich erstaunte das hohe Maß an Sachlichkeit bei allen Anwesenden. Keiner versuchte, die Interessen der anderen Seite als fragwürdig darzustellen oder die Tatsachen für die von ihm vertretenen Interessen zu verbiegen. Von Richard hatte ich nichts anderes erwartet. Meine Sorge war eher gewesen, dass er taktische Fehler machen könnte, weil er die wirtschaftliche Entwicklung in Rostock keinesfalls behindern wollte. Er beschränkte sich jedoch zunächst darauf, zu begründen, warum die Nazis seinen Vater als Gegner betrachten mussten. Er habe keinen Zweifel, dass seinem Vater das Grundstück mittelbar verfolgungsbedingt entzogen worden sei. Dies lasse sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus den Gründen des Volksgerichtshofurteils entnehmen. Die seinerzeit für die Rückgabe des Unternehmens in Spandau zuständige Behörde habe überhaupt keine Zweifel daran gehabt, dass der Verlust des Unternehmens eine Folge des Volksgerichtshofurteils war, obwohl das Urteil selbst auch ihr nicht vorgelegen habe. Unabhängig von den Bemühungen des Amtes lasse er seit einigen Monaten in allen auch nur entfernt in Frage kommenden Archiven nach der Prozessakte des Volksgerichtshofes und nach anderen Unterlagen suchen. Zu der Frage, ob die Rückgabe des Grundstücks ausschlaggebend für die weitere Entwicklung der Werft sein könne, meinte er dann etwas sybillinisch: „Wissen Sie, Prognosen über die Unternehmensentwicklung für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren sind nach meiner eigenen unternehmerischen Erfahrung so hoch spekulativ, dass ich darauf nicht einmal eine Baracke bauen würde.“ Eine typische Richard-Bemerkung. Ohne jede Rücksicht auf die Wirkung für oder gegen seine eigenen Interessen.
Der Geschäftsführer schmunzelte flüchtig, und ich meinte, etwas wie Respekt und Dankbarkeit für die unerwartete Unterstützung aus seinen Zügen lesen zu können. Dann fing er den Ball auf und führte mit großem Ernst aus, er könne nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln und planen. Luftschlösser dürfe und wolle er allerdings auch nicht bauen. Man müsse aber berücksichtigen, dass es in der Wirtschaftsgeschichte noch keine vergleichbare Situation gegeben habe. Deshalb müsse man in den neuen Bundesländern den Horizont der Optionen viel weiter ausdehnen als in den alten Bundesländern, wo die Unternehmer auf ihre langjährige Erfahrung zurückgreifen könnten.
Als die Diskussion stockte, bat der Referatsleiter des Landesamtes darum, abschließend den Verfahrensstand unter Berücksichtigung der vor Ort gewonnenen Erfahrungen noch einmal zusammenfassen zu dürfen. Er beschränkte sich auf die wesentlichen Fakten, zeigte auf, wie die Entscheidung des Landesamtes ausfallen könnte, und wies eindrücklich darauf hin, dass mit der Behördenentscheidung die Sache höchstwahrscheinlich nicht ausgestanden sei, weil entweder die eine oder aber die andere Seite Klage beim Verwaltungsgericht erheben werde. Leider müsse man nach der bisherigen Erfahrung damit rechnen, dass ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht mindestens fünf Jahre dauere. Es sei auch nicht auszuschließen, dass es anschließend noch ein Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gäbe. Von dort könne die Sache wieder an das Verwaltungsgericht zurückverwiesen werden, weil die untere Instanz nach Ansicht der Bundesrichter den Sachverhalt nicht genügend aufgeklärt hätte, der Rechtsstreit also noch nicht entscheidungsreif sei. Alles in allem könne es bis zu einer endgültigen Entscheidung noch zehn Jahre dauern. Im Interesse aller Betroffenen sei es dringend zu empfehlen, die Angelegenheit durch eine einverständliche Regelung zwischen dem Antragsteller und der Anker Schiffswerft GmbH zu beenden. Dabei müsse die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben als Anteilseigner der Werftgesellschaft mit einbezogen werden.
Keiner der Anwesenden widersprach. Erst als der Referatsleiter konkreter wurde, machte sich Unruhe bemerkbar. Er führte zunächst aus, wie er persönlich die Chance des Antrags bewerte. Danach sei es zwar sehr wahrscheinlich, dass dem Grunde nach ein Anspruch bestehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein verfolgungsbedingter Verlust nicht nachgewiesen werden könne, schätze er mit höchstens zwanzig Prozent ein. Dagegen habe er große Bedenken, ob der Werft das antragsbefangene Flurstück, eines von mehreren, aus dem sich das Grundstück zusammensetze, insgesamt weggenommen werden könne. Nach dem Willen des Gesetzgebers habe der Erhalt von Arbeitsplätzen Vorrang vor dem Anspruch auf Rückgabe. Trotz aller Rückschläge bestehe offenbar immer noch eine realistische Chance, einige Hundert Arbeitsplätze zu erhalten. Diese Chance dürfe unter keinen Umständen durch die Rückgabe eines betriebsnotwendigen Grundstücks zunichte gemacht werden. Andererseits sei höchstrichterlich entschieden, dass Teile des zurückverlangten Grundstücks zurückgegeben werden müssten, wenn sie nicht betriebsnotwendig seien und wenn sie nach Abtrennung vom Gesamtgrundstück eigenständige Gegenstände des Rechtsverkehrs sein könnten.
Bei den bekannten Schwierigkeiten, die verschiedenen Gesichtspunkte in Ziffern zu fassen, wolle er dies doch wagen. Und dann begann er mit Zahlen zu jonglieren, dass ich größte Mühe hatte, mir die wichtigsten Ziffern zu notieren. Ausgehend von einem geschätzten Gesamtwert des Grundstücks von rund 4,8 Millionen Mark machte er Abschläge für die vorher erwähnten Risiken, differenzierte dabei nach den festgestellten Nutzungen, nahm für eine zum Verkauf anstehende Fläche eine separate Berechnung vor und wandte auf das Zwischenergebnis noch einen Faktor an, der das unterschiedlich stark ausgeprägte Interesse der Parteien an einer schnellen Regelung berücksichtigen sollte. Und dann nannte er nach einer kurzen taktischen Pause endlich die Zahl, auf die wir alle gewartet hatten: 2,7 Millionen Deutsche Mark. Sein Vorschlag laute also: Die Anker Schiffswerft GmbH zahlt innerhalb eines Monats nach Abschluss der Vereinbarung 2,7 Millionen Deutsche Mark an den Berechtigten. Der Berechtigte erklärt alle Ansprüche hinsichtlich des Grundstücks für abgegolten.
Ich war so mit meinen Notizen beschäftigt, dass ich nicht beobachten konnte, was sich in Richards Gesicht abspielte. Für mich überraschend, versuchten die Vertreter der Werft nicht, die Summe herunterzudrücken. Der Geschäftsführer schien beeindruckt von dem virtuosen Zahlenspiel des Referatsleiters und erklärte sofort sein Einverständnis. Wie zu erwarten, wies er jedoch darauf hin, dass er nur eine Empfehlung im vorgeschlagenen Sinne gegenüber der BvS abgeben könne. Die Entscheidung werde einzig und allein dort getroffen, zumal die Werft den Betrag nicht aus eigenen Mitteln aufbringen könne, da sie ohnehin schon tief bei der BvS in der Kreide stehe. Der Mitarbeiter des Landesamtes setzte nach und bot an, die Einigung sofort schriftlich zu fixieren. Um die BvS ins Boot zu holen, könne der Werft ein Widerrufsrecht von vier Wochen eingeräumt werden. Ich berief mich ohne Absprache mit Richard auf den Grundsatz der Waffengleichheit und verlangte für ihn ebenfalls ein Widerrufsrecht. Ein kurzes Nachhutgeplänkel ohne ernsthafte Gefahr. Nachdem der Geschäftsführer versprochen hatte, den Vorschlag des Landesamtes noch am gleichen Tag der BvS zu unterbreiten, beließen wir es schließlich bei den gegenseitigen mündlichen Absichtserklärungen.