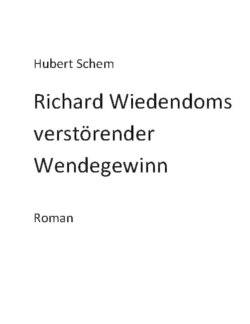Читать книгу Richard Wiedendoms verstörender Wendegewinn - Hubert Schem - Страница 5
Оглавление5
Henrike Voss trug die für sie von Mitarbeitern des
Bundesarchivs bereitgelegten Akten an ihren Stammplatz am Mittelgang. Die Tische im Saal waren um diese frühe Zeit nicht einmal zur Hälfte besetzt. In ihrer Reihe waren die drei mittleren Tische noch blank. Auf dem Tisch am Fenstergang lag akkurat aufgeschichtet ein hoher Aktenstapel. Ein Laptop wartete auf seinen Besitzer, der sich wie immer seinen Platz nur gesichert hatte, um dann in der Gaststätte auf dem Gelände des Archivs zu frühstücken. Henrike kannte ihn seit ihrem ersten Termin vor einem halben Jahr. Sie wusste nicht nur, woran er arbeitete, sondern war auch informiert, wie ihm sein Dissertationsthema aufgedrängt worden war, wie er sich innerlich gesträubt, aber im Laufe seiner Arbeit allmählich Feuer gefangen hatte. Ein japanischer FU-Absolvent, der sich bereits während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften zur Wirtschaftsgeschichte hingezogen gefühlt hatte und ein Doktoranden-Stipendium nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium dazu nutzen wollte, diese Neigung mit dem Nützlichen zu verbinden. Als er dem von ihm auserwählten Doktorvater seine noch vage Themenvorstellung vorgetragen hatte – ein Thema, das genug Spielraum ließ, die Wirtschaftsgeschichte nach einer Tendenz zur Globalisierung überhaupt und nach deren Abhängigkeiten und Gesetzmäßigkeiten zu erforschen – hatte der Professor mit freundlicher Bestimmtheit abgewinkt. „Vorsicht vor noch nicht genügend abgehangenen Themen“, hatte er mit einem eigenartigen Lächeln gemurmelt, eine Warnung, deren genaue Bedeutung dem Japaner auch nach ausführlichem Studium aller verfügbaren Wörterbücher und Lexika nicht verständlich geworden war. Stattdessen hatte er ihm eine Mitarbeit bei einem seit längerem unter seiner Obhut betriebenen Forschungsprojekt angeboten. Dabei ging es um den Einfluss von Verbänden, die der NSDAP angeschlossen waren, auf die Wirtschaft in der NS-Zeit. Innerhalb des Teilgebietes „Deutsche Arbeitsfront (DAF)“ war noch das Unterthema „Die unmittelbare und mittelbare Teilnahme der Deutschen Arbeitsfront am Wirtschaftsprozess während des Zweiten Weltkriegs – Art, Umfang und Bedeutung für die Kriegswirtschaft“ zu vergeben.
Enttäuscht über ein so offensichtlich auf spezifisch deutsche Verhältnisse ausgerichtetes Thema hatte der Doktorand zunächst die Strategie verfolgt, seinen Professor so schnell wie möglich davon zu überzeugen, dass dieses Thema keine nennenswerten neuen Forschungsergebnisse versprach. Aber schon nach dem Lesen einiger Bücher und nach flüchtiger Einsicht von Akten unterschiedlicher Herkunft hatte er Feuer gefangen und seine Bedenken vergessen. Henrike konnte seinen Mitteilungsdrang nicht mehr bremsen, nachdem sie beim Kaffee durch geschickte Fragen den Damm seiner anerzogenen Zurückhaltung durchstoßen hatte. Er schien alle Daten über die Deutsche Arbeitsfront bereits in seinem Kopf gespeichert und sortiert zu haben. Die Entwicklung der Mitgliederzahl von rund fünf Millionen im Mai 1933 auf über fünfundzwanzig Millionen ab Ende 1942. Die Vermögensverwaltung der Deutschen Arbeitsfront GmbH. Die Treuhandgesellschaft für wirtschaftliche Unternehmungen mit beschränkter Haftungaftung. Die Bank der deutschen Arbeit. Die Versicherungsgesellschaft Deutscher Ring. Die Deutsche Bau AG. Die zahlreichen regionalen Siedlungsgesellschaften. Die Entwicklung von Fertigbauelementen. Die Verlagerung der Finanzmittel vom Wohnungsbau zu kriegswichtigen Projekten ab 1941. Verlage. Das Diana-Bad in Wien, Europas größtes Freibad. Die großen Prestigeprojekte: Das Volkswagenwerk mit einer neuen Stadt für die Beschäftigten in der Nähe von Fallersleben – jetzt Wolfsburg - sowie die Freizeit-Anlage für zwanzigtausend Urlauber in der Gemarkung Prora auf Rügen. Die Errichtung von Ordensburgen, Schulungsburgen und Adolf-Hitler-Schulen auf eigene Rechnung - großzügige Geschenke der Deutschen Arbeitsfront an die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, propagandistisch ein Ausdruck der engen Verbundenheit zwischen Partei und DAF, wirtschaftlich ein Zeichen für die überlegene Finanzkraft der DAF mit jährlich über einer halben Milliarde Reichsmark Mitgliedsbeiträgen. Und ... und ... und ...
Henrike hörte zu und staunte über dieses Füllhorn an Informationen. Als der Doktorand schließlich erschrocken bemerkte, dass fast eine Stunde vergangen war, entschuldigte er sich mehrmals und fragte sie – offenbar Ausdruck seiner unerschütterlichen Höflichkeit - nach dem Zweck ihrer eigenen Forschungen im Bundesarchiv. Henrike bemühte sich, so allgemein zu bleiben, wie es die gebotene Höflichkeit gerade noch erlaubte. Aus einem Impuls heraus bat sie ihn jedoch, sie zu informieren, wenn ihm bei seinen Studien zufällig der Name Wiedendom begegne. So lange sie selbst noch keinen erfolgversprechenden Pfad im Aktendschungel des Bundesarchivs erkennen konnte, musste sie auf das Prinzip Zufall setzen. Zwei weitere Augen konnten dabei nicht schaden. Er versuchte immer wieder, den Namen zu wiederholen. Henrike konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Der junge Japaner verlor seine gute Laune nicht und kicherte bei jedem Fehlversuch. Schließlich ließ er sich den Namen buchstabieren, notierte ihn in lateinischen Druckbuchstaben und wiederholte ihn so oft, bis sie ihm bestätigte, dass seine Aussprache tadellos sei. Ihre Visitenkarte steckte er mit wiederholten leichten Verbeugungen und der Versicherung, besonders aufmerksam nach dem Namen Wie-den-dom schauen zu wollen, in seine Geldbörse.
Heute lagen alle bestellten Akten bereit – acht Bände von sehr unterschiedlicher Dicke. Bevor sie sich in die Arbeit stürzte, lehnte Henrike sich zurück und versuchte sich zu lockern wie ein Läufer vor dem Start. Der wievielte Termin im Bundesarchiv war das jetzt in Richards Sache? Der sechste oder der siebte? Bei jedem Termin mindestens fünf Akten, von ihr vorher mit einer Mischung aus rationalen Erwägungen und ihrem aus dem Bauch geleiteten Spürsinn in den Findbüchern ausgewählt. Viel bürokratischer Kleinkram, aus dem selbst der begnadetste Historiker keine Funken schlagen könnte. Aber auch Vorgänge von historischer Bedeutung, die die Aufmerksamkeit mit einem verführerischen Sog auf sich zogen. Die Gefahr, sich in solchen Akten zu verlieren und den Zweck der Recherche zu vergessen. Bisher weder ein Volltreffer noch irgendeine Spur, die weiterführen könnte.
Ging es ihr überhaupt noch um Richards Anliegen, oder war es schon ihr eigenes Hobby, das sich vom Anlass gelöst hatte, fragte sich Henrike. Versprach sie sich Stoff für ein interessantes Rundfunkfeature? Zum Einstieg in ein ganz neues Gebiet ihrer journalistischen Tätigkeit? Ein Unternehmer, der vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden war aber dann nicht hingerichtet wurde. Ein faszinierendes Thema ganz unabhängig von Richards Sorgen. Die Haftzeit des Verurteilten wahrscheinlich in Tegel. Die Spuren in der Literatur, die zu dieser Haftanstalt führten oder von ihr ausgingen. Die Erinnerungen des evangelischen Gefängnispfarrers Harald Poelchau, der bis zum Ende des NS-Regimes an die tausend zum Tode verurteilte Menschen in Berlin und Brandenburg seelsorgerisch betreut und über zweihundert zur Hinrichtung begleitet hatte. Nirgendwo war der Name Wiedendom aufgetaucht. Richard hatte ihr eine plausible Erklärung dafür vorgeschlagen: Der aus dem westlichen Westfalen stammende Vater, gehörte zur ansehnlichen katholischen Minderheit in Berlin und hätte selbst im Angesicht des Todes keinen geistigen Beistand von einem evangelischen Pfarrer angenommen. Eine Geschichte mit großartigem Potential. Gut recherchieren, geschickt kombinieren, attraktiv drapieren - und vielleicht damit sogar den Sprung ins Fernsehen schaffen. Fernsehdokumentationen waren seit einigen Jahren in. Und dies waren schließlich keine blutleeren Abstraktionen, keine historischen Verallgemeinerungen, die den Hörern oder Zuschauern bestenfalls zum Kopf herein- und schnell wieder hinausgedrängt würden, sondern die Erlebnisse einer konkreten Person in den schlimmsten Jahren der deutschen Geschichte. Was war der Grund für die Verurteilung des Philipp Wiedendom zum Tode? Warum wurde er nicht – wie sonst üblich – kurz nach dem Urteilsspruch hingerichtet? Was war an Richards Vater so besonders, dass er dem perfekt organisierten Todesapparat der Nazis entging? Richards Vater – ein Mann der Tat, ein Energiebündel, ein Erfolgsmensch. Bestimmt kein überzeugter Nazi. Noch beeinflusst von den Ideen des Zentrums, den Ultramontanen, national unsicheren Kantonisten, denen das Wort des jenseits der Berge residierenden Papstes mehr galt als das von Kaiser und Kanzler. Als Unternehmer trotzdem ein Opportunist, der auch in der Nazizeit ein bisschen mitmachte, um sein Unternehmen nicht zu gefährden? Ein Familienvater im alttestamentarischen Sinn? Pflicht, Verantwortung, Durchhaltevermögen, Tatkraft. Zu welchem Zweck? Erhalt und Vergrößerung des Unternehmens als oberstes Ziel? Familientreue mit dem Blick über viele Generationen – losgelöst von allen konkreten Personen? Ein holzschnittartiges Charakterprofil, als Ganzes entworfen nach einem Negativtyp und nicht anhand gesicherter Tatsachen geprägt, Henrike ertappte sich sofort bei ihrem lustvollen Ausbruch in pseudowissenschaftliches Gelände. Der Vater und sein in Russland vermisster Erstgeborener. Wuchernde Familienlegenden ohne tragfähiges Tatsachengerüst. Wie Richard davon erzählte – mit dem vergeblichen Bemühen um Distanz. Ein noch unbekanntes Zweitleben des Unternehmers, das zu seiner Verurteilung durch den Volksgerichtshof führte? Ein privater Rachefeldzug? Verbindungen zu einer Widerstandsgruppe? Frage nach Frage – einstweilen immer noch keine einzige Antwort.
Henrike starrte auf den Aktenstapel vor sich, ohne die Herausforderung schon anzunehmen. Vielleicht sollte sie einer Nebengeschichte nachgehen und ein eigenes Feature über Elisabeth Wiedendom, geborene Lintel, entwickeln. Ehefrau eines waschechten Unternehmers, Mutter zweier grundverschiedener Söhne. Ihre Position in der Familie. Ihre Monat für Monat, Jahr für Jahr aussichtsloser gewordene Hoffnung auf die Rückkehr des vermissten Sohnes. Ihr schleichender Rückzug aus der Realität in Phasen der Depression. Die Vorstellung von einem Wiedersehen im Jenseits als letzter Trost. Ihre Rolle bei den Versuchen des Vaters, den Nachgeborenen zum Unternehmer zu formen. Die kurze Phase nach dem Tod ihres Mannes, als sie versuchte, aktiv ihr Leben zu gestalten. Die Gründe des Misslingens. Und ihr Dahinsiechen. Nein! Henrike verbot sich ein solches Projekt sofort. Unzumutbar für Richard, selbst wenn er es ausdrücklich gutheißen würde.
Das interessanteste Feature überhaupt wäre aus ihrer Sicht über Richard selbst zu produzieren. Der Mann, der zu klug war, um erfolgreich zu sein. Aber nicht ganz klug genug, sich das einzugestehen und zu vergeben. Das Scheitern seiner Berufsträume. Sein lebenslanger Kampf um Gelassenheit und um Unabhängigkeit von materiellen Werten. Die Auswirkung der Wende auf seine Grundbefindlichkeit. Sein aktueller Versuch, mit aller Kraft für ein materielles Ziel zu kämpfen. Seine ausgeprägte Menschenfreundlichkeit. Seine ambivalente Beziehung zu dem Mythos Familie. Der Unfalltod seiner Ehefrau. Quälende Selbstvorwürfe als Grund für das spätere Auseinanderbrechen der neu zusammengesetzten Familie? Ein vergleichendes Porträt der Mütter seiner Söhne? Und nicht zuletzt: ihre eigene Rolle in seinem Leben. Dass ein solches Feature niemals gesendet werden durfte, stand für Henrike außer allem Zweifel. Es war dazu bestimmt, in ihrem Innern verschlossen zu bleiben.
Jetzt ganz gelöst, verglich Henrike die Signaturen der Aktendeckel noch einmal mit ihrer Bestellung. Es stimmte alles. Wo jetzt anfangen mit der spannenden aber auch anstrengenden Arbeit? Welche Akte versprach am ehesten Erfolg? Sie widerstand dem Impuls, mit der dünnsten Akte zu beginnen und griff stattdessen nach der dicksten. Zunächst ein noch nicht voll konzentriertes Durchblättern. Es sah nach einem kompletten Fehlgriff aus. Schriftverkehr in Personalsachen. Originalbriefe des Reichsministers der Justiz an den Präsidenten des Berliner Kammergerichts, Durchschläge von Schreiben des Präsidenten an den Reichsminister. Vorschläge zu Versetzungen und Beförderungen, kurze Sätze des Einverständnisses, lange Antworten mit Bedenken und Gegenvorschlägen. Alles in allem anscheinend personelle Routineangelegenheiten auf hohem hierarchischen Niveau. Henrike legte die Akte zunächst unter den Stapel und griff nach der nächsten, ohne sich über ihr System Rechenschaft abzulegen. Ein Bündel von 250 Seiten. Beschaffungsanträge, Genehmigungen, Rechnungen, Zahlungsanweisungen, Schriftwechsel mit Lieferanten und Handwerkern. Anschaffungen für Haftanstalten in Berlin. Stockwerksbetten, Strohsäcke, Anlagen für Durchsagen und zum Abhören, Handschellen, Gummistöcke, Uniformen, schließlich auch Pistolen. Die nächste Akte anscheinend das Gleiche. Sie ging dazu über, nur noch Stichproben zu machen. Bürokratischer Alltag ohne jeden speziellen Bezug zum NS-System. Einfach nur ermüdend. Sie schob auch diese Akte unter den Stapel und lehnte sich wieder zurück. Fast zwei Stunden erfolgloser Anstrengung.
Ihr Blick wanderte nach links. Der junge Mann mit seinem tiefschwarzen Haar war in seine Arbeit vertieft. Er bewegte die Tasten seines Laptop mit rasender Geschwindigkeit. Sein feines Profil zeigte hohe Konzentration. Wenn er arbeitete, war er hundertprozentig bei der Sache. Das hatte Henrike immer wieder beobachtet – manchmal mit einem Anflug von Neid. Von seinem Aktenstapel lagen jetzt zwei Akten auf der rechten Tischseite. Die dritte Akte schien inhaltsschwer zu sein. Er tippte, schlug die Seite um, tippte weiter, kurze Pause, neuer Start, blättern, blicken, tippen. Jetzt tippte er anscheinend keinen Text aus der Akte, sondern eine Zusammenfassung aus dem Stegreif. Bewundernswert. Henrike hatte Lust auf einen Kaffee, schob ihren Stuhl zurück und wollte aufstehen. Ihm war die Bewegung nicht entgangen. Er schaute herüber, lächelte, machte eine angedeutete Verbeugung im Sitzen, griff dann hastig in seine Aktentasche und wedelte mit einigen Blättern in der Luft herum. Sie verständigten sich wortlos und verließen zusammen den Lesesaal. Die Blätter hielt er weiter demonstrativ in seiner ausgestreckten Hand, wie ein Straßenverkäufer, der den Vorbeiflanierenden seine Ware aufzudrängen versucht.