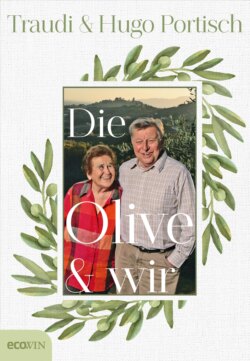Читать книгу Die Olive und wir - Hugo Portisch - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Grundstück
ОглавлениеChi troppo sa – poco sa. Wer zu viel weiß, weiß wenig.
Nichts ist so beeindruckend wie ein Olivenwald. Trotzdem würde niemand eine größere Anzahl von Olivenbäumen einen Wald nennen. Die eigentliche Bezeichnung lautet: Olivenhain. Ein antiquiertes Wort, das man sonst kaum mehr gebraucht. Es hat etwas Mystisches an sich. Ein heiliger Hain. Pan spielte in einem Olivenhain. Die Oreaden wohnten in Hainen. Orion belauschte Diana in einem Hain, und Faune tummelten sich darin.
Warum sich Oliven nur in Hainen befinden und keine Wälder bilden, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kommt es daher, dass Olivenbäume viel Platz brauchen und deshalb immer in großem Abstand voneinander stehen. Aber da gibt es noch etwas anderes sehr Interessantes an einem Olivenbaum. Man kauft einen jungen Baum in einer Baumschule mit einem dünnen, geraden Stamm, setzt ihn ein, und es fällt einem auf, wie fremd er unter den anderen Bäumen steht. Er hat eben einen geraden Stamm! Kaum aber trägt er die ersten Oliven, fängt er an, sich auch schon zu krümmen. Ein paar Jahre danach beginnen sich die Äste nach allen Richtungen zu drehen, der Stamm teilt sich auch oft, kurz, er hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem Baum, den man gekauft hat. Ihre groteske Veränderungskunst aber macht Olivenbäume nicht unheimlich wie manche alte Weiden, sondern zart und ätherisch, als wären sie so in die Landschaft hineingelegt. Ihre wahre Pracht aber ist die silberne Farbe ihrer Blätter, obwohl sie klein und unscheinbar sind. Oft habe ich zugesehen, wie ein einziges Blatt in Bewegung geriet, während alle anderen ganz still waren. Es schien mir dann, dass das irgendein Zeichen für mich war, das ich aber nicht deuten konnte. Die Olivengeister sind gute Geister. Das wissen alle Toskaner. Sie können es nicht beweisen, aber das ist auch nicht notwendig, denn jeder, der hierher kommt, spürt sie.
Die Blüte der Olive ist klein und unscheinbar, wie die Blätter und die Früchte. Besonders sind nur die knorrigen bizarren Stämme. In unseren Hügeln sind die Olivenbäume hoch und ihre Äste ragen wie riesige Arme in den Himmel. In der Ebene aber sind sie klein, rund und dickstämmig. Wie silberne Steinbrocken liegen sie in langen Reihen im Land.
Wenn der raue Februarwind aus den Bergen in unser Tal zieht, dann werden die Olivenbäume zart und durchsichtig, dass man meinen könnte, sie hätten ihre Blätter verloren. Kurz darauf aber können sie in einem warmen Wind so voll erscheinen, als trügen sie Früchte. Diese Verwandlungskunst habe ich noch an keinem anderen Baum gesehen, vor allem nicht an einem immergrünen Baum. Wenn Olivenbäume dein Haus umgeben, dann fühlst du dich auf merkwürdige Weise beschützt, als stünden die Jahrhunderte Wache rund um dich.
Wenn man unseren Hügel hinuntersteigt, dann läuft ein schmaler Weg in einen dichten Bambuswald. Ich hatte vorher noch nie einen Bambuswald gesehen, ja ich wusste gar nicht, dass es so etwas in Europa überhaupt gab. Es war daher eine große Überraschung, als wir plötzlich Besitzer eines solchen waren.
Betritt man diesen Wald, versetzt er einen in eine exotische Urlandschaft. Das Licht bricht sich hier anders, die Geräusche der langen, dünnen Blätter sind fremd und rascheln, nein, sie zischen, wenn man durchgeht. Der Pfad durch den Bambuswald ist voller Überraschungen, denn immer wieder brechen neue Schösslinge aus der Erde und müssen abgeschnitten werden, damit der Pfad erhalten bleibt. Es ist ein lebhaftes Aus-der-Erde-Schießen, ein Grünwerden und ein ebenso schnelles Braunwerden bis zum Verdorren. Alles in rascher Folge. So wächst und wächst der Wald, wird an einer Stelle dichter, an einer anderen lichter. Immer denken wir, es wäre gut, wenn wir einmal alle toten Stämme entfernen würden, vielleicht, um etwas Luft zu machen, denn wahrscheinlich würde das den Bambus größer und stärker werden lassen, aber dann greifen wir doch nicht ein. Wir überlassen es ihm, sich selbst zu vermehren und zu vermindern, groß zu werden und wieder kleiner, breiter und wieder enger, wie er es will. Der Mensch soll sich nicht so wichtig machen. Vielleicht würden wir dem Wald dann das Geheimnisvolle nehmen, das uns derart gefangen hält.
Unterhalb des Bambuswaldes läuft ein Bach. Manchmal ist er ein Rinnsal, manchmal ist er ein klares Wässerchen, in dem man am liebsten baden würde. Wir lieben ihn, er ist unser Bach. Im Sommer trocknet er manchmal aus, was uns traurig macht. Neben einer kleinen Brücke, die wir mit Mühe gebaut haben, gibt es einen kleinen Teich. Auch der Teich ändert sich ständig. Mitunter scheint er ganz ausgetrocknet, manchmal quillt er über. Im Frühjahr siedeln sich hier Frösche an. Und in dieser seit Jahrhunderten bebauten Gegend, wo der Mensch die Vorherrschaft hat, ist jedes Lebewesen eine Freude.
Gleich oberhalb des Teiches beginnt ein Haselnusswald. Es ist kein Hain, es ist auch kein Buschwerk, es ist ein echter Wald, denn die Haselnussstämme erreichen hier eine Höhe wie bei uns Buchen und Birken. In diesem Wald hausen unsere Mitbewohner, die Haselmäuse. Wenn wir nicht durch Zufall einmal dazugekommen wären, wie eine Schlange eben dabei war, eines dieser lustigen Tierchen zu schlucken, wüssten wir wahrscheinlich gar nicht, dass es welche gibt, es sei denn, man sieht sich die angenagten und leer gefressenen Haselnüsse genauer an. Die Haselmaus hat jedoch einen argen Konkurrenten beim Verzehr der Haselnüsse, nämlich einen Käfer, der ein so perfektes Schneidewerkzeug besitzt, dass er kreisrunde Löcher in eine Nuss schneiden kann.
Die Schlange ließ ihr Opfer aus dem Maul fallen, und die Haselmaus war vor Schreck so gelähmt, dass sie sich in die Hand nehmen ließ. Sie sah uns mit ihren großen braunen Augen an und hatte nicht begriffen, was mit ihr geschehen war. Wir ließen sie im Haselnusswald aus, wo sie mit ihren Artgenossen zwar für eine merkliche Reduzierung unserer Haselnussernte sorgt, aber es ist genug für uns alle da.
Einmal haben wir auch zwei Haselmaus-Nester gefunden. Manche afrikanische Vögel bauen ähnliche Nester. Sie sind oval, wie ein großes Ei und aus Grashalmen gewoben. An einer Seite im oberen Drittel befindet sich ein Loch, in dem wir einmal den Kopf einer Haselmaus entdeckten. Sie sah uns mit verängstigten Augen an. Wir entfernten uns leise. Seither haben wir im Winter immer wieder solche Nester auf dem Boden gefunden. Wo sich die Haselmäuse aber im Winter verstecken, wissen wir nicht.
Im Haselnusswald haben wir vor ein paar Jahren kleine Haselnusssträucher neu gesetzt, die mit Trüffelmyzel geimpft waren. Jedenfalls werden sie als solche angeboten und man kann sie kaufen. Wir hatten die Plätze zwar mit Stöcken markiert, aber ein, zwei Jahre später standen rund um die Stöcke ein Dutzend frischer Haselnusssträucher, die auf mysteriöse Weise gerade dort aus dem Boden geschossen waren, sodass wir nun nicht mehr wussten, wo wir graben sollten, um herauszufinden, ob die Trüffeln gediehen waren. Leider wachsen die Trüffeln unter der Erde, und darum werden wir nie erfahren, ob es bei uns Trüffeln gibt oder nicht, es sei denn, wir borgen uns ein Trüffelschwein oder einen Trüffelhund aus, die abgerichtet sind, Trüffeln auch unter der Erde zu wittern und nach ihnen zu graben. Immerhin können wir behaupten, dass in unserem Haselnusswald vermutlich Trüffeln wachsen.
Dass es Pilze auf unserem Grundstück gibt, wussten wir von Anfang an, und ich bin heute noch davon überzeugt, dass die Parasole, die wir vor dem Haus fanden, als wir es zum ersten Mal besichtigten, ausschlaggebend waren, das Haus zu kaufen. Auch sonst wachsen immer wieder Pilze auf unserem Grund, von Parasolen, Wiesenchampignons und Bovisten bis zu dem sensationellsten Fund des letzten Jahres, nämlich eines Kornblumenröhrlings, ein sehr seltener Pilz, der zu den besten Speisepilzen zählt. Seit wir wissen, wie selten sie sind, lassen wir sie stehen. Semmelstoppelpilze haben sich inzwischen auch im Haselnusswald angesiedelt. Unserer eigenen Züchtung von kultivierten Träuschlingen folgten wilde Träuschlingskolonien in unserem Bambuswald.
Zunächst konnten wir es gar nicht fassen, da gibt es tatsächlich einen Bambuswald auf unserem Grund. Wie in China, nur ohne Pandabären. Doch unsere Nachbarn klärten uns bald auf: Der junge Bambus wird von den Bauern dazu benützt, die Zweige ihrer in großen Töpfen gezogenen Zitronenpflanzen zu stützen, nichts eigne sich da besser als Bambus.
Alles hier hat seinen Sinn und Zweck.
Das hätten wir oft bedenken sollen! So gab es da eine Steinmauer, über die unser Bach in einem beachtlich hohen Wasserfall stürzte. Sicher war sie schon Hunderte Jahre alt. Auch das Bachbett war in seiner ganzen Länge mit Steinen ausgelegt. Die Mauer war mit wilden Brombeersträuchern überwuchert. Wir fanden es schade – außerdem wollten wir den Wasserfall in seiner ganzen Schönheit sehen! Also rissen wir die Brombeersträucher aus. Nun rauschte der Bach ungehindert über die Mauer. Wir waren stolz darauf. Aber dann kam der Regen, ein schweres Gewitter, der Bach schwoll an und das Wasser schoss ungehindert die Mauer hinunter. Die Mauer hielt diesem Wasserschwall nicht stand und brach in sich zusammen. Seither sind wir sehr vorsichtig geworden, wenn wir der Natur unsere Ordnung aufzwingen wollen. Die kleinste Veränderung einer Terrasse, die Anlage eines neuen Weges, ja sogar das Fällen eines morschen Baumes kann schlimme Folgen haben.
Die Terrassen sind Jahrhunderte alt und haben ihre eigene Art, mit dem Herbst- und Winterregen fertig zu werden.
Wir mussten, um einen neuen Weingarten anzulegen, den Bach umleiten, sonst hätte er den Weingarten jährlich mehrere Male überschwemmt. Die Folge waren unglaubliche Erdrutsche, die Jahr für Jahr stattfanden, bis sich die Landschaft an den neuen Wasserlauf gewöhnt hatte. Das alles mussten wir erst lernen.
Unter dem Haselnusswald, den kleinen Bach entlang, kommt man über mehrere kleine Brücken in den großen Weingarten. Hier standen immer schon Reben, aber die alten waren seit Langem verdorrt und nicht mehr zu beleben. Also legten wir, nach einer sehr schwierigen Rodung, einen neuen Weingarten an. Eigentlich wollten wir gar nicht noch mehr Wein produzieren, aber was sollte man mit diesem Stück Grund machen? Es war leicht zu bearbeiten.
Vielleicht hätten wir Obstbäume pflanzen sollen, aber da die anderen Weinstöcke verstreut im Grund standen und auch schon sehr alt waren, hörten wir auf den Rat der Nachbarbauern. Jetzt haben wir mehr Wein, als wir je verbrauchen können, und ein Verkauf bringt sehr wenig. Aber die Bauern sagen: „Öl und Wein, das muss sein.“ Unsere Landwirtschaft beherrscht uns und nicht wir sie, das ist sicher, und vielleicht ist es auch gut so.
Oberhalb des Weingartens führt ein kleiner Weg in einen größeren Wald, den wir einfach Dschungel nennen. Er ist von Erlen und Buchen bewachsen, und auf unserer Seite des Weges steht auch ein Kastanienbaum, der jedes Jahr Früchte trägt. Oberhalb des Weges standen, als wir das Haus kauften, mehrere riesige Mimosenbäume, die zu Weihnachten prachtvoll blühten. Als Schachtelhalme wachsen diese Riesen so lange, bis sie durch ihr eigenes Gewicht zu Fall kommen. Auf diese Weise bildeten sich einst die Kohlenflöze. Es war ein trauriger Anblick, als wir eines Tages zwei dieser Riesen quer über den Weg liegen sahen. Die Blüten waren gerade knapp vor dem Aufspringen, und wir holten noch Tage danach immer wieder Äste ins Haus, um sie zum Aufblühen zu bringen. Ein Trost war nur, dass neben diesen Riesen sich schon eine Unzahl kleiner Mimosenpflanzen angesiedelt hatte, und dass wir uns daher um Nachwuchs nicht zu sorgen brauchten.
Der Dschungel wurde von uns deshalb so genannt, weil sich auf jeden der hohen Bäume Efeu und andere Schlingpflanzen hinaufranken. Von den Wipfeln hängen Lianen herunter in das dichte Unterholz, sodass der Wald wirklich wie ein asiatischer oder afrikanischer Dschungel wirkt. Durch diesen Dschungel fließt ein größerer Bach, der das ganze Jahr über Wasser führt, aber nur auf einer Seite zu uns gehört. An diesem Bach wachsen seltene Pflanzen, manche sind bei uns in Blumenhandlungen zu haben. Es gibt auch Calla und Schneerosen, Seite an Seite! Die Blüten beider werden seltsamerweise nicht weiß, wie bei uns, sondern bleiben grün. Besonders die Schneerose sieht sehr hübsch aus, selbst im grünen Zustand, ist viel höher und ihre Blätter sind viel größer. Aber auch der Dschungel verändert sich jährlich. Der Bauer, dessen Grund sich auf der anderen Seite des Baches befindet, hat schon einige Bäume herausgeschlagen und den Wald gelichtet. Uns tut es um jeden Baum leid, aber er musste sich einen neuen Hühnerstall bauen und dazu brauchte er das Holz. Für ihn ist der Dschungel keine botanische Seltenheit wie für uns, und wir müssen das verstehen.
Alle diese Entdeckungen mussten doch einen Mitteleuropäer begeistern! Etwas weniger Begeisterung zeigten wir, als wir den ersten kleinen Skorpion sahen, und noch viel weniger, als uns die erste Viper begegnete.
Wir wussten, dass es Vipern gab, und gingen durch das hohe Gras auch immer in Stiefeln, aber uns schien es, dass man sie doch nur sehr selten zu Gesicht bekam. Die Bauern jedenfalls redeten kaum darüber. Als sich dann eine Viper dicht vor unserer Gartentür unter dem Strahl eines Gartenschlauches auf uns zu bewegte, waren wir sehr überrascht und erschrocken.
Was die Skorpione betrifft, so sagen die Bauern, dass sie nicht ärger stechen als eine Biene, dass sie aber in den Monaten mit „R“ giftiger sind als sonst. Jedenfalls sind sie sicher viel kleiner als afrikanische Skorpione. Wir bringen sie nicht um, sondern befördern sie mit einer Schaufel in den Weingarten, obwohl wir wissen, dass sie sehr bald wieder zum Haus zurückkehren werden. Warum sie ausgerechnet die menschliche Gesellschaft bevorzugen, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass dort, wo Menschen sind, auch Wasser ist, besonders unter Blumentöpfen oder Sonnenschirmständern. Etwas Feuchtigkeit brauchen sie, und sie können sich unter einem Blumentopf so flach machen, dass man sie dort nicht vermuten würde. Wenn sie laufen, sind sie zwar sehr schnell, aber auch wehrlos. Ein Tritt, und das Leben des Skorpions ist vorbei. Es scheint mir, dass wir einen sehr unfairen Vorteil ihnen gegenüber haben. Unsere Katze aber nimmt sie nicht ernst und spielt mit ihnen ganz so, als hätten sie keinen Giftstachel.
Manche Vögel in dieser Gegend bauen ihre Nester nicht in den Bäumen, sondern in den Löchern der Böschungen und wären deshalb jedem Zugriff einer Katze oder eines Hundes ausgesetzt, gäbe es nicht die vielen wilden Brombeersträucher, die den Zugang zu ihren Nestern mit ihren stacheligen Zweigen versperren. Die zart belaubte Olive bietet ihnen zu wenig Schutz, und die Zypressen haben so eng stehende Äste, dass sie wenig Platz für den Nestbau zulassen. Im Hof erhebt sich jedoch ein großer Lorbeerbaum, und darin finden sich viele Vögel, vor allem Rotkehlchen, Jahr für Jahr zum Nestbau ein.
Die Jagd auf kleine Vögel wird den Italienern immer wieder sehr übel genommen. Sie empört die Tier- und Naturschützer. Zu Recht. Aber dass es so ist, dafür gibt es eine sozialhistorische Erklärung, die wir uns anhören mussten, als auch wir die Vogeljagd kritisierten.
Wie bei uns, gab es auch in Italien Bauernaufstände, die sich gegen die meist adeligen Großgrundbesitzer richteten. Die Bauern aber waren de facto Leibeigene, kaum einer besaß eigenen Grund, auch kein eigenes Haus, sie arbeiteten für die adeligen Herren und mussten ihnen den Großteil der Ernte abliefern. Im Besonderen verboten aber war die Jagd. Wer einen Hasen oder einen Fasan oder gar ein Reh erlegte, wurde hart bestraft mit Gefängnis und Zwangsarbeit. Gegen all das empörten sich die Bauern, und es kam zu blutigen Aufständen. Nördlich der Alpen erzwangen die Bauern ihre Freiheit und eigenen Grundbesitz. In Italien waren sie nicht so erfolgreich, nur die abzuliefernde Erntemenge wurde reduziert. Aber man gewährte ihnen ein lang ersehntes Recht – das Recht auf die Jagd. Von nun an durften sie Jagdgewehre besitzen und jagen auf den Gründen, die sie bearbeiteten. Das Gewehr und die Jagd wurden damit zum Statussymbol der Bauern. Die jagdbaren Tiere auf den Gründen aber waren bald ausgerottet, die Hasen, Fasane und Rebhühner. Die Rehe im Wald, die Hirsche und Wildschweine durften weiterhin nur die Waldbesitzer jagen. Deswegen schoss man auf die noch verbliebenen Vögel und tut dies auch noch heute, wenn auch Zeiten und Tage für die Jagd gesetzlich beschränkt worden sind.
Was nun die Vögel betrifft, so haben einige Vogelarten die ihnen drohende Gefahr erkannt und flüchten im Herbst beim ersten Schuss in die nahe Stadt, wo sie sich im Kurpark einfinden. Sie sind schlau und wissen, wo sie vor den Jägern in Sicherheit sind.
Vor uns spricht man nicht von der Vogeljagd. Und der Baumeister zeigt uns auch nicht seine kleinen Käfige, in denen er die Lockvögel hält, wie er es bei anderen Besuchern voller Stolz tut. Ich aber hoffe, dass alle diese vielen Lockvögel, die in winzigen Käfigen ihr Leben fristen müssen, eines Tages doch durch ein Gesetz endlich frei werden!
Unser Dschungel artet zur Jagdzeit zu einer regelrechten Vogelfalle aus, denn die Jäger bauen sich dort kleine Hütten aus Zweigen, mit Schlitzen, um ungesehen auf die Vögel zu schießen. Wir könnten sie zerstören, aber das würde wohl nur zu Streit führen, noch dazu ohne Erfolg, wie ich mich von den Carabinieri belehren lassen musste. Doch davon wird noch später zu berichten sein. So warten wir auf die nächste Volksabstimmung, die hoffentlich das Ende dieser Art von Jagd bedeuten wird.
Vom Dschungel kann man zum Weingarten durchstoßen und danach über die Oliventerrassen zu unserem Haus gehen. Heute ist das Haus umgeben von blühenden Büschen und Blumen, von Geißblatt und Jasmin, und vor allem geschmückt von den beiden Spalierbäumen an der Südwand. Vor Jahren gab es eine stürmische Winternacht, in der die Temperatur auf minus 21 Grad Celsius sank. Eine seit Jahrhunderten nicht erlebte Kälte. Wir waren damals nicht anwesend, und als wir wiederkamen, gab es auf den Zitronenbäumen kein einziges Blatt mehr, alles abgefroren. Wir waren verstört. Das Haus war wie verwandelt. Die leeren Äste am Spalier sahen aus wie Skelette. Da gab es nur eines: Die Bäume bis auf ungefähr 50 Zentimeter abzusägen und zu hoffen, dass beide Bäume wieder austreiben würden.
Doch im Frühjahr geschah etwas Seltsames: Beide Bäume trieben aus, einer viel stärker als der andere, aber immerhin! Im Spätfrühjahr sahen wir dann, dass der eine Baum dunklere Blätter hatte. Und als sie Früchte trugen, stellte es sich heraus, dass der stärkere Baum eine Bitterorange geworden war, während der andere eine Zitrone geblieben ist. Offenbar war die Zitrone auf dem Stamm einer Bitterorange veredelt worden, und wir hatten sie unterhalb der Veredelung abgeschnitten. Heute bringt der Orangenbaum viele Kilo Bitterorangen hervor, von denen wir mühevoll, aber begeistert eine Orangenmarmelade kochen, wie man sie in England kaum besser macht.
Bei uns wachsen auch Blumen, die in Mitteleuropa den Winter nie überdauern würden. Die Passiflora bedeckt unser Glashaus, damit die Sonnenstrahlen im Inneren nicht alles versengen. Aber die Hitze muss man mögen und ertragen können, denn im Sommer ist es schon merklich heißer als nördlich der Alpen. Wenn dann die Zikaden in der vor Hitze zitternden Mittagsluft zirpen und die Eidechsen regungslos auf der Mauer liegen, scheint es, als würde die Welt stillstehen. Alles ringsumher sinkt in einen Trancezustand. Man selbst hat Angst, diese Stille zu stören. Wenn das Gezirpe der Zikade verstummt, hört man jedes Blatt, das sich bewegt.