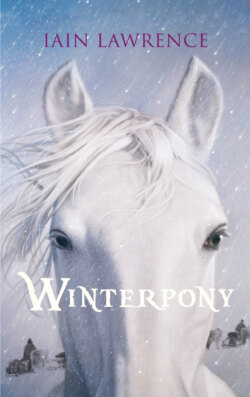Читать книгу Winterpony - Iain Lawrence - Страница 11
KAPITEL 2
ОглавлениеDie Fahrt auf dem alten Dampfer war eine Quälerei, jedenfalls zum größten Teil. Ich war es nicht gewohnt, dass sich der Boden unter meinen Hufen bewegte, und das Rollen des Schiffs machte mich seekrank. Die Sonne brannte zu heiß, das Meer gleißte zu hell. Der Gestank der Hunde war unerträglich.
Am liebsten hätte ich die ganze Zeit Wasser gesoffen, aber ich bekam nur zweimal täglich ein paar Schlucke, wenn der russische Junge mit einem Eimer herumging. Ich beugte mich ihm jedes Mal über den Rand meines Verschlags entgegen, während mir beim Duft des süßen Wassers die Lippen zuckten. Aber immer dann, wenn ich gerade angefangen hatte zu saufen, riss der Russe den Eimer weg.
Mir taten die Beine weh, weil ich mich nicht hinlegen konnte. Mein Rücken juckte von dem Ruß, der aus dem Schornstein niederging, ein schwarzer Regen, der fast alles bedeckte, bis auf die verfluchten Hunde. Sie beobachteten mich unentwegt mit ihren wilden kleinen Augen, die nichts als schmale Schlitze im Fell waren.
Manchmal kam Mr. Meares vorbei und streichelte mich, aber nicht sehr oft. Er kümmerte sich viel mehr um die Hunde als um die Ponys. Das Gleiche traf auch auf seinen Hundeführer zu, einen Russen, den ich nur selten sah und niemals schätzen lernte. Und der Junge, ein Jockey, war so aufgeregt über die weite Reise, dass er die Ponys manchmal einfach vergaß.
Wir segelten nach Süden, immer nach Süden, geradewegs durch den Winter, ohne ihn zu sehen. Wir waren im Sommer losgefahren und kamen im Frühling an, wobei die feurige Sonne jeden Tag heißer schien.
Wir legten auf einer Insel an, wo das Gras grün und üppig wuchs und die Bäume groß waren und reichlich Schatten spendeten. Es gab einen Sandstrand, an dem wir uns austoben konnten, und wir galoppierten durch das seichte Wasser und wirbelten mit unseren Hufen weißen Schaum auf.
Das war ganz und gar nicht das, was ich erwartet hatte. Einige der Ponys, besonders die älteren, hätten hier bis an ihr Lebensende glücklich werden können. Die Wärme tat ihren Knochen gut, während die Sonne sie schläfrig und faul machte. Oft lagen drei oder vier gleichzeitig lang ausgestreckt im Gras und schliefen. Ich musste im Schatten bleiben und mir die Insekten mit meinem Schweif vom Leib halten. Ich war ein Winterpony mit einer dicken Mähne und zotteligem Fell. Ich mochte knisternd kalte Morgen, an denen ich weißen Dampf ausatmete, Flüsse mit eisigem Wasser und Berge mit Schnee auf den Gipfeln.
Aber im Augenblick war ich sehr glücklich. Hier gab es zwar keine Eiszapfen, aber auch keine Stockschläge und Peitschenhiebe. Die Männer schienen nicht grausam zu sein. Aber ich konnte einfach nicht glauben, dass ich nicht mehr geschlagen wurde, und so zuckte ich jedes Mal zusammen, wenn ein Mann die Hand hob, um sich am Kopf zu kratzen oder seinen Hut zurechtzurücken. «Ganz ruhig, Junge», hörte ich ungefähr hundertmal am Tag. «Ganz ruhig, ich tu dir nichts.»
Mr. Meares zog kurze Hosen an, und schon bald waren seine Beine genauso feuerrot wie sein Gesicht. Auf seinem Rücken und an seinen Armen zeichneten sich lange, nasse Schweißstreifen ab, und er legte ein Taschentuch unter seinen Hut, um sich doppelt vor der Sonne zu schützen.
Einige Ponys waren enttäuscht, als er Zuggeschirr und Stränge herbeischleppte. Aber ich arbeitete gern, weshalb es mir nichts ausmachte, obwohl in den Sinn unserer Aufgabe nicht verstand. Wir mussten Holzstämme den Strand entlang ziehen, Stämme, die so schwer waren, dass sie nicht im Wasser trieben. Wir zogen sie bis ans Ende des Strands, kehrten um und zogen sie wieder zurück. Es war eine nutzlose Arbeit, aber wir lernten die englische Art kennen, Lasten zu transportieren. Sie war sanfter als das, was wir gewohnt waren, und beinhaltete eine Führhand am Halfter und einen Keks, wenn wir fertig waren. Ich legte mich mit Freuden ins Zeug, weil ich Mr. Meares gefallen wollte.
Ich wünschte nur, dass der Hengst und einige der anderen Ponys sich ebenfalls gefügt und ihre Angst vergessen hätten. Aber für sie waren alle Menschen zum Fürchten.
Eines Tages kam ein Herr aus seinem Haus, ein Herr mit weißen Haaren und einem kerzengeraden Rücken. Eine Dame hatte sich bei ihm untergehakt. Er blieb stehen, bewunderte den Hengst und fragte den Jockey: «Wie alt ist dieser hier?» Der Jockey zuckte nur mit den Schultern; er wusste es nicht. Also trat der Herr näher an den Hengst heran.
Der Hengst versuchte den Mann zu warnen. Er legte die Ohren nach hinten, senkte den Kopf und schwang ihn vor und zurück. Aber der Mann merkte es nicht – oder verstand nicht – und kam noch näher. Und da griff der Hengst ihn an.
Der alte Mann stand einfach nur da. Vielleicht war er zu überrascht, um wegzulaufen. Mit einem Satz stand der Hengst direkt vor ihm, stieg auf die Hinterbeine und schlug zu.
Im allerletzten Moment hob der Herr einen dürren Arm, um das Pony mit seinem Spazierstock abzuwehren. Dann traf der Hengst sein Ziel, und der Mann flog rückwärts in das Gras. Mit einem Schrei stieg der Hengst wieder in die Höhe und ließ die Hufe wirbeln.
Es waren vier Männer nötig, um das Pony wegzuziehen. Der Hengst bockte, trat um sich und wehrte sich nach Kräften. Die Männer hatten Angst, waren aber auch voller Ehrfurcht. Einen solchen Kämpfer hatten sie noch nie erlebt. Sie nannten ihn Hackenschmidt, nach dem berühmten russischen Ringer, der noch nie einen Kampf verloren hatte.
Ich sah seine Augen an diesem Tag, sie waren ganz wild und verrückt, und wieder einmal fragte ich mich, was ihm bei den Menschen widerfahren war. Er war so wütend und so bitter, dass er sogar den anderen Ponys Angst einjagte. Es gab nur eines, das ihn nicht fürchtete – ein anderer HHengst, ein bisschen jünger, aber genauso wild wie der alte. Die Männer nannten ihn Christopher, meiner Meinung nach ein viel zu netter Name für so ein schreckliches Pony.
Die beiden waren wie zwei Schläger, die sich nur miteinander anfreundeten, damit sie sich nicht gegenseitig umbrachten. Beide waren dickköpfig und ungezähmt. Sobald sie das Geschirr und die Stränge sahen, machten Hackenschmidt und Christopher den Männern klar, dass sie nicht arbeiten wollten. Aber die Männer waren noch dickköpfiger, und obwohl sie manchmal zu viert oder zu fünft an einem Pony hingen, schafften sie es jedes Mal, den beiden das Geschirr anzulegen. Und sie brachten sie jedes Mal dazu, die Arbeit zu erledigen, und das ohne Stock oder Peitsche.
Ich dachte mir, dass sie uns auf eine besondere Aufgabe vorbereiteten, denn kein Mensch – nicht einmal ein Engländer – würde einfach nur aus reinem Vergnügen arbeiten. Ich zerbrach mir den Kopf, was es wohl sein konnte, und hielt überall nach Hinweisen Ausschau.
Der erste Anhaltspunkt kam im November, als ein merkwürdiges Schiff auf unserer Insel eintraf. Es war Captain Scotts Terra Nova, aber das wusste ich damals noch nicht. Ich bemerkte nur den Schornstein, der schwarzen Rauch ausspuckte, und einen alten Geruch nach Tod, den man mit Farbe und Teer übertüncht hatte.
Das Schiff fuhr noch am Anleger entlang, da sprangen die Männer schon an Land, wie Flöhe von einem Hund hüpfen.
Einer dieser Männer hatte eine Pfeife zwischen den Zähnen. Eine Zeit lang lief er mit einem seltsam schaukelnden Gang, als ob das Land unter seinen Füßen sich bewegen würde, obwohl es stillstand. Er marschierte den Anleger auf und ab, drehte sich dann um und kam geradewegs auf die Ponys zu.
Er ging schnell, mit langen Schritten, querfeldein bis zu der Wiese, wo wir grasten. Dort legte er seine Ellbogen auf den Weidenzaun, zog an seiner Pfeife und paffte.
Hackenschmidt und Christopher schnaubten ängstlich. Sie kanterten auf die gegenüberliegende Seite der Wiese, und ein paar der anderen Ponys folgten ihnen. Aber ich blieb stehen, wo ich war, keine drei Meter von dem Mann entfernt. Ich mochte ihn auf Anhieb, denn er lächelte, als er mich ansah.
Über seine Schulter sah ich Mr. Meares auf uns zukommen. Seine rosaroten Beine leuchteten in der Sonne. «Was halten Sie von ihnen, Titus?», rief er dem Neuankömmling zu.
Der Mann nahm die Pfeife aus dem Mund und sagte laut, ohne den Kopf zu wenden: «Sie sehen erstklassig aus.»
Er hatte die freundlichste Stimme, die ich je gehört hatte, und eine so mitfühlende Ausstrahlung, dass sie ihn buchstäblich einhüllte, wie der Rauch aus seiner Pfeife. Ich wollte ihn richtig begrüßen, ihn ausgiebig beschnuppern und mich an ihm reiben, aber ich ließ Vorsicht walten, senkte den Kopf und scharrte mit den Hufen durch das Gras. Ich schnaubte ihn sanft an, um ihm zu zeigen, dass ich keinen Ärger machen wollte.
Er rührte sich nicht. Er blieb einfach an den Zaun gelehnt stehen, mit der Pfeife in der Hand, und beobachtete mich mit hellen, ozeanblauen Augen.
Ich blieb vor ihm stehen, so nah, dass er mich anfassen konnte, wenn er es wollte. Eine geraume Weile schauten wir einander nur an. Dann beugte er sich plötzlich vor.
Er war so flink wie eine Schlange. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte er mein Halfter gepackt. Ich wollte zurückweichen.
«Ganz ruhig, mein Junge», sagte er, als er merkte, wie ich zitterte. «Dir passiert nichts, versprochen.»
Ich kam näher. Ich stupste ihn an, und er lächelte wieder. Dann glitten seine Augen über die Narben an meinen Schultern. Er betastete sie, und ich zuckte nicht einmal zusammen.
Dieser Mann war Lawrence Oates, ein Soldat, ein Hauptmann der Kavallerie. Aber niemand nannte ihn bei seinem richtigen Namen. Für die Männer war er nur Titus oder «der Soldat». Aber mir kam er so wenig wie ein Kämpfer vor, dass er für mich immer Mister Oates blieb.
An diesem Tag blieb er nicht lang. Nachdem er mich getätschelt und mir die Wange gerieben hatte, ging er mit Mr. Meares davon. Gemeinsam schlenderten sie zum Schiff zurück. Von da an hielt ich die ganze Zeit nach ihm Ausschau und stellte mich so oft es ging an dieselbe Stelle am Zaun. Aber es dauerte drei oder vier Tage, bevor ich ihn wieder auf mich zukommen sah.
Er überraschte mich, weil ich erwartet hatte, dass er vom Schiff her kommen würde, aber stattdessen tauchte er auf der Straße auf, inmitten einer fröhlichen Gruppe von Leuten.
Es war ein schöner Tag. Die Wolken hingen am Himmel, sie sahen aus wie Schaum auf einem Fluss. Bienen summten im Klee, und die Menschen schlenderten gemächlich durch die Sonne, wobei sie wie ein Haufen Krähen schwatzten.
Unter ihnen befand sich ein Mann mit einem Spazierstock, einer Mütze mit einem schimmernden Abzeichen und einem Mantel mit Knöpfen, die in der Sonne wie runde Goldstücke glänzten. Die anderen umringten ihn, waren mal vor ihm, mal hinter ihm, wie eine Schar kleiner Vögel. Mr. Oates ging dicht hinter ihm, und an seiner Seite war eine Frau, das schönste Wesen, das ich je gesehen hatte. Ihr weißes Kleid reichte bis zum Boden, und ich fragte mich, ob sie überhaupt Beine hatte, denn sie schien wie eine Wolke über das Gras zu schweben. Hinter den anderen ging der russische Jockey, der Führungsseile über seine Schultern gelegt hatte.
Der Mann in der Mitte war Captain Scott. Er schwang den Spazierstock so munter in der Hand, wie ein Hund mit dem Schwanz wedeln würde. In zehn Metern Entfernung blieb er stehen und starrte mich und die anderen Ponys an. Er schob die Mütze auf seinen Hinterkopf.
Seine Begleiter blieben ebenfalls stehen. Mr. Meares trat zu ihm; er strahlte vor Stolz. Mr. Oates blieb zurück, obwohl ich es genossen hätte, wenn er zu mir gekommen wäre und mich gestreichelt hätte.
Captain Scott betrachtete uns ausgiebig. Ausnahmsweise hielten wir alle still, keiner muckte auf. Sogar Hackenschmidt fraß friedlich Gras, obwohl er dabei äußerst wachsam blieb. Wir boten bestimmt einen beeindruckenden Anblick: neunzehn weiße Ponys auf einer grünen Wiese voller Gras und Klee.
«Prächtig», sagte Captain Scott. Er sah sehr zufrieden aus. «Das ist schon was, finden Sie nicht auch, Titus?»
«Scheint so», sagte Mr. Oates. «Ich konnte sie noch nicht unter die Lupe nehmen.»
«Na, dann besser heute als morgen», sagte Captain Scott.
Die ganze Gesellschaft trat durch das Gatter auf die Weide. Der russische Jockey trieb vier Ponys zusammen, einschließlich mich. Er klinkte die Führleinen an unsere Halfter und stellte uns in einer engen Reihe auf, als Captain Scott und die anderen zu uns traten. Die Dame hielt Abstand und achtete darauf, dass immer ein Mann zwischen ihr und den Ponys stand. Aber Mr. Meares und Captain Scott kamen geradewegs auf uns zu, und dann lächelte mich Mr. Oates mit der Pfeife zwischen seinen Zähnen rundheraus an. «Da ist ja mein braver Junge», sagte er.
Ich war entzückt, dass Mr. Oates sich an mich erinnerte. Ich begrüßte ihn mit einem Schnauben, einem kurzen Wiehern und einem munteren Ruck mit dem Kopf. Aus irgendeinem Grund mussten die Männer darüber lachen, und die Dame rief: «Was für ein lieber Kerl!»
Ich war der Erste, den Mr. Oates begutachtete, während Captain Scott die Führleine hielt. Er hob meine Füße hoch und betastete meine Hufe, fühlte meinen Bauch und meine Brust. Jetzt lächelte er nicht mehr; vielmehr runzelte er die Stirn. Er ging zum nächsten Pony und dann zum nächsten, bis er uns vier untersucht hatte.
Captain Scott wurde ungeduldig. «Nun?», fragte er.
«Sie hatten ein schweres Leben», sagte Mr. Oates seufzend. «Und ein langes.»
«Wollen Sie damit sagen, dass sie alt sind?», fragte der Captain.
«So alt wie Methusalem», sagte Mr. Oates, «und völlig ausgebrannt. Die meisten sind Klepper.»
Klepper. Dieses Wort hörte ich zum ersten Mal. Aber ich wusste gleich, dass es nicht gut war, ein Klepper zu sein. Die Ponys neben mir waren wirklich alt. Ihr Fell hatte kahle Stellen, ihre Rücken waren krumm, die Zähne abgeschliffen. Ich fragte mich, ob Hackenschmidt ein Klepper war, weil er so wild war. Oder Christopher, weil er so gemein und dickköpfig war.
Mr. Meares wirkte enttäuscht. Und Captain Scott war sehr ungehalten. «Sie gehen ein bisschen hart mit ihnen ins Gericht, finden Sie nicht?», sagte er.
Mr. Oates schüttelte den Kopf. «Nicht im Mindesten.»
«Nun, ich glaube, dass sie ihre Sache sehr gut machen werden», sagte Captain Scott. «Sie sind genauso gut wie die von Shackleton, da bin ich mir sicher.»
Noch ein neues Wort. Ich war froh, mindestens genauso gut zu sein wie ein Pony aus Shackleton, wo auch immer das auch sein mochte.
«Sie werden ihre Aufgabe erfüllen», sagte Captain Scott.
Ihre Aufgabe. Ich spitzte die Ohren, in der Hoffnung, mehr darüber zu erfahren. Aber der Captain lief mit Mr. Oates weiter, und die anderen folgten ihnen. Und so stellte ich mich ab von nun an, so oft es ging, an den Rand der Weide und versuchte, bedeutsame Worte aufzuschnappen. Das alles war mir ein absolutes Rätsel.
Als die Männer das Schiff ausluden, hoffte ich, sie würden auf der Insel bleiben. Die Sachen, die zum Vorschein kamen, waren für kaltes Wetter gedacht: große Schlitten, Zelte, wollene Kleidung. Aber sie entluden das Schiff nur, um Reparaturen durchzuführen, dann brachten sie die Sachen wieder an Bord. Die Arbeit dauerte viele Tage, während derer ich meistens im Gras lag und jedes winzige Kleeblatt fraß, das ich erreichen konnte, ohne mich zu bewegen. Jeden Morgen kam die Dame mit einem Sonnenschirm, setzte sich zu mir und kraulte mir die Ohren, während ich an der grünen Köstlichkeit knabberte.
Aber irgendwann war die Arbeit erledigt, und eines Abends gingen alle Männer an Bord.
Ich hatte Angst, dass sie ohne mich abfahren würden. Ich rief nach Mr. Oates, ich wieherte und schnaubte, so laut ich nur konnte. Aber er beachtete mich nicht. Und so rannte ich am Zaun auf und ab und jammerte wie ein Fohlen nach seiner Mutter. Aber dieses Mal – zum ersten Mal – kam Mr. Oates nicht zu mir.
Am nächsten Morgen war die Katastrophe für mich perfekt. Der Anleger war leer, das Schiff voll beladen, und schwarzer Rauch quoll aus dem Schornstein. Ich spürte einen großen Schmerz in meiner Brust. Es wäre schwer genug, Mr. Oates davonsegeln zu sehen, aber noch viel schlimmer, wenn er sich nicht einmal von mir verabschieden würde.
Doch das Schiff segelte nicht davon. Stattdessen erhob sich plötzlich aus den Gepäckstapeln an Deck eine riesige Kiste. Düstere Erinnerungen wurden in mir wach, aber ich rannte nicht davon. Im Gegenteil, ich trabte näher, weil ich der Erste sein wollte, der an Bord gebracht wurde.
Die Männer suchten sich Hackenschmidt aus. Sechs von ihnen rangen ihn nieder und schoben ihn in die Kiste, und die ganze Zeit trat und schlug er um sich. Mit Christopher, der danach kam, war es das Gleiche. Dann war ich an der Reihe. Ein großer Matrose namens Taff Evans fütterte mir einen Keks, während er mich in die Kiste führte. «So ist’s richtig», sagte er stolz. «So wird das gemacht.»
Er rieb mir die Ohren, klappte die Tür zu, und dann ging es aufwärts. Die Männer lachten, als ich nach unten schaute und dabei an meinem Keks kaute.
Mr. Oates wartete auf dem Schiff auf mich. «Da ist ja mein Junge», sagte er, als er mich aus der Kiste holte. «Mittschiffs», sagte er zu einem Matrosen, der mich in meine Box brachte. Wir gingen über das Deck, das mit Kisten und Säcken so vollgestellt war, dass wir nur im Gänsemarsch hintereinander gehen konnten. Ich stand mit drei anderen Ponys in einer Reihe, mit einer Zeltleinwand als Dach. Ich konnte nach oben in Richtung Bug blicken oder über das Dach des Kühlhauses, am Schornstein vorbei zum Heck. Ich musste zwar an Packkisten und Gerätschaften vorbeischauen, aber es war trotzdem ein angenehmer Anblick. Andere Ponys, die nicht so viel Glück hatten, wurden unter Deck ins Dunkel gebracht.
Als das letzte Pony an Bord war, kamen die Hunde kläffend über die Insel gelaufen. Ich hatte gedacht, ich wäre sie los, aber wieder einmal wurden sie rings um mich herum angekettet. Einer lag direkt vor meiner Box, ein anderer nur ein paar Schritte entfernt, ein paar hatten es sich auf dem Dach des Eishauses gemütlich gemacht. Ich hoffte nur, dass ihre Ketten robust und stark waren, und wünschte, sie würden aufhören zu heulen.
Unter mir fing die Dampfmaschine an zu stampfen. Bauschige Rauchwolken quollen aus dem Schornstein wie ein drohendes Gewitter. Mit einem schrillen Pfiff und einem Jubelruf von der Küste aus fuhren wir los. Captain Scott schrie Befehle, die Männer hievten an den Seilen, und mit jeder Sekunde nahm das Schiff Fahrt auf. Das Hämmern der Maschine ließ alles vibrieren und rattern und klappern. Ich sah, wie der Captain seiner Frau zuwinkte, die an Land geblieben war. Dann drehte er sich weg. Nicht lange, und wir hatten den Schutz des Landes hinter uns gelassen und erreichten das offene Meer.
Obwohl das Rollen und Stampfen nicht enden wollte, und trotz der Hunde in meiner Nähe gehören die ersten Tage unserer Reise zu den glücklichsten meines Lebens.
Von allen neunzehn Ponys war ich der Liebling der Matrosen. Sie gaben mir den Namen James Pigg, zu Ehren eines Mannes, den es nur in einem Buch gab. «Ein liebenswürdiger Halunke», sagten sie. Manchmal riefen sie mich Jimmy Pigg, manchmal einfach nur James. Und sie sagten es jedes Mal auf eine fast zärtliche Art, immer mit einem Lächeln und einem Klaps auf meine Schultern. Oft gab es noch einen Keks dazu, der mir insgeheim zugesteckt wurde, damit die anderen Ponys nicht eifersüchtig wurden. «Du bist ein guter Junge, James Pigg», sagten sie.
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich einen Namen. In der Vergangenheit war ich immer nur «das Pony» gewesen, nur ein Ding, das einen Karren oder einen Baumstamm zog. Aber jetzt fühlte ich mich wichtig.
Wir alle bekamen Namen. Ein faules altes Pony links von mir wurde Weary Willy genannt, ein kleines rechts von mir Jehu und das neben ihm Nobby. Ich hörte, wie andere Namen von unten durch die Wände gerufen wurden, wo die restlichen Ponys untergebracht waren. Ich sah sie nicht, aber ich erfuhr ihre Namen: Snatcher und Snippets, Bones und Guts und so viele andere, dass ich mir nicht alle behalten konnte.
Manchmal hörte ich die Matrosen singen, und das Schiff fühlte sich wie ein sicherer und glücklicher Hafen an. Aber je weiter wir nach Süden kamen, desto schneidender wurde der Wind, desto aufgewühlter das Meer. Ich sah die Männer ängstliche Blicke in den Himmel schicken, der sich mit gefährlich aussehenden Wolken füllte.
Der Sturm war entsetzlich. Es fing an mit einem Wind, der so laut heulte wie ein Hund. Dann türmten sich die Wellen immer höher und höher auf, und es dauerte nicht lange, da rollte und schlingerte das Schiff heftig. Ich musste darum kämpfen, auf den Beinen zu bleiben, während ich in meiner Box hin und her geworfen wurde.
Das Schiff legte sich so weit zur Seite, dass ich dachte, es würde umkippen. Wellen krachten über die Reling und schäumten über das Deck. Sie leckten über das Kühlhaus und brachen sich an meiner Box. Plötzlich stand ich bis zum Bauch im Wasser, das nur langsam wieder ablief.
Den Hunden erging es noch schlechter. Die Wellen begruben sie unter sich, und sie kämpften an ihren Ketten um das nackte Überleben. Sie kläfften und heulten nicht mehr. Sie wimmerten wie kleine Vögel und blickten mit angsterfüllten Augen um sich. Selbst mir taten sie leid.
Der Wind nahm noch zu. Die Wellen stiegen immer höher. Packkisten und Säcke mit Kohle rutschten hin und her, schlugen an die Reling und an das Deckhaus.
Dann brach ein Stück der Reling ab. Es trudelte hinunter ins Meer, und ein Hund, der an das Holz angebunden war, paddelte ein paar Sekunden lang mit aller Kraft, bevor er unterging. Er tauchte wieder auf und schwamm, was das Zeug hielt, doch dann versank er endgültig.
Das Schiff würde untergehen, daran hatte ich keinen Zweifel. Es suhlte sich in den Wellen wie ein großes Schwein in einer Schlammkuhle. Ich konnte die Angst der Männer riechen, aber sie arbeiteten unbeirrt weiter. Nur ein paar von ihnen waren Matrosen. Die meisten waren Wissenschaftler und Doktoren. Es waren auch ein Koch und ein Fotograf unter ihnen, der schon an ruhigen Tagen dauernd seekrank war. Aber jeder einzelne Mann legte Hand an, um das Schiff zu retten. Und sie taten ihr Möglichstes. Tonnenweise schaufelten sie Kohle über die Reling ins Meer, pumpten Wasser aus dem Rumpf und trugen es in Eimern nach oben.
Ein Regenbogen erschien am Himmel, während sie noch schufteten. Es war der schönste Regenbogen, den ich je gesehen hatte. Riesig und strahlend stand er über uns. Einer der Männer sah ihn und stieß seinen Nachbarn an, und gleich darauf starrten alle nach oben. Dann schlug die nächste Riesenwelle über dem Schiff zusammen, und die Arbeit begann aufs Neue.
Als das Schiff sich ruckartig zur Seite warf, verlor ich das Gleichgewicht. Meine Vorderbeine rutschten unter mir weg, und ich fiel hart auf die Holzbohlen. Weder konnte ich aufstehen noch mich hinlegen, und ich dachte, jeden Moment würden mir die Beine brechen. Ich hörte eine Welle an Deck krachen, und plötzlich strömte Wasser in meine Box.
Ich geriet in Panik. Ich trat um mich, schrie laut aus Angst und Schmerz. Die See schlug brüllend auf mich ein, über mir zusammen, und der kleine Jehu machte einen Satz zur Seite, um von meinen wild wirbelnden Hufen nicht getroffen zu werden.
Ein Matrose sah mich, ein Mann namens Thomas Crean. Er rief um Hilfe, und Mr. Oates kam angerannt. «Halte durch, Junge», sagte er, während er in die Box kletterte.
Allein schon der Klang seiner Stimme hatte eine beruhigende Wirkung. Ich lag schwer atmend auf dem Boden, während er meine Beine entwirrte. Das große runde Gesicht von Taff Evans blickte über den Boxenrand zu mir herunter. Dann trat er zu Mr. Oates, und die beiden hievten mich gemeinsam wieder auf die Füße, so wie es meine Mutter am Tag meiner Geburt getan hatte. Sie hielten mich fest, bis ich mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, und stützten mich von rechts und links.
«So ist’s recht», sagte Taff Evans. «Auf die Beine mit dir. Und schon ist die Sache erledigt.»
Als Mr. Oates sah, dass ich in Sicherheit war, eilte er davon. Ich hörte, wie die Ponys in der Dunkelheit unter Deck gegen das Schlingern ankämpften, hörte sie schreien, als sie gegen die Holzwände geworfen wurden.
Achtern stand Captain Scott, so zerzaust wie eine Vogelscheuche. Er steuerte nach Osten, mit dem Wind in seinem Rücken. Mir kam das Schiff regelrecht verängstigt vor. Es fuhr in einer rasenden Geschwindigkeit durch die turmhohen Wellen. Captain Scott wirkte ruhig und gelassen, aber das Schiff, so schien es mir, hatte einen Satz gemacht und war losgerannt, nur um wegrennen zu können.