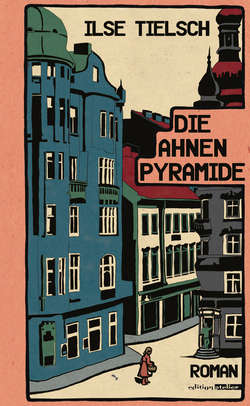Читать книгу Die Ahnenpyramide - Ilse Tielsch - Страница 9
4
ОглавлениеAltgewordene erinnern sich gerne vergangener Zeiten. Wenn der Vater und die Mutter beisammensitzen, sprechen sie häufig davon, wie es FRÜHER war. Das Wort HEIMAT gebrauchen sie nicht, sie sagen: DAMALS ZU HAUSE. Weißt du noch, die Caramelle-Zuckerln, sagt die Mutter, während sie an einem Schal für die Enkelin häkelt, und der Vater sagt: JA, ICH ERINNERE MICH. Meine Mutter hat sie gemacht, die Caramelle-Zuckerln. Ich weiß noch, wie sie geschnitten wurden. Man konnte sie mit Zitronensaft machen, dann waren sie weiß, oder mit Kaffee oder mit Schokolade oder mit einem Tropfen Himbeersaft. Dann waren sie rosarot.
Weißt du noch, sagt die Mutter, wie ich die Grillage gemacht habe, von irgendwoher hatte ich Nüsse bekommen und Zucker hatte ich auch gespart.
DAMALS ZU HAUSE. Wir saßen im Wohnzimmer unter der Hängelampe, im Ofen, AMERICAN HEATING, glühte das Feuer hinter den Marienglasscheiben, die Mutter verpackte kleine, haltbare Näschereien in braune Packpapiersäckchen, die Packpapiersäckchen wurden an die Front geschickt. Statt einer Anschrift gab es eine Feldpostnummer.
Manchmal lebten die Empfänger nicht mehr, wenn die Päckchen ankamen. Manchmal trafen, lange nach dem Abschicken der Päckchen, Feldpostkarten oder graue Faltbriefe mit überschwenglichen Dankesworten ein.
Weißt du noch? Die Köchin Fanni hatte das Rezept, die herrlichen Fondant-Zuckerln, ich bin zu ihr gegangen und habe sie darum gebeten.
An den Zweigen unserer Christbäume hingen Fondant-Zuckerln, nach dem Rezept der Köchin Fanni gemacht, Caramelle-Zuckerln, nach dem Rezept der Mutter des Vaters. Die Großmutter hatte die Herstellung der Caramelle-Zuckerln wiederum von ihrer Mutter im an der steirisch-niederösterreichischen Grenze gelegenen Furthof erlernt.
Weiß du noch, damals die Forellen, wir haben sie in die heiße Butter gelegt, erst hat man sie auf der einen Seite gebraten, dann auf der anderen.
Sie zerfallen leicht, die Forellen.
Nun, in Furthof hat man den Forellen nicht das Rückgrat eingeschnitten. Das habe ich überhaupt noch nie gehört, sagt der Vater. Und den Schleim hat man den Forellen in Furthof auch nicht abgewaschen. Der Schleim muß draufbleiben, sonst schmecken sie nicht so gut.
Meine Großmutter in Furthof hat die Forellen immer in Sardellenbutter gebraten.
ICH MÖCHTE NOCH EINMAL NACH FURTHOF FAHREN, sagt der Vater, Urenkel Johann Wenzels des Zweiten, Großneffe des unglücklichen Ignaz, der sich seiner untreuen, leider leichtfertigen Frau wegen auf dem Scheunenboden seines Hauses im Adlergebirge erhängte, Enkel Josefs, der Färber in jenem mährischen Dorf Schmole südlich von Mährisch-Schönberg war, aber auch Urenkel des k. k. Waldübergehers Karl, der mit seiner Familie, Frau und zwei Kindern, im burgenländischen Rosaliengebirge lebte, und wiederum ein Sohn des FRANZISKUS aus der königlich freien Bergstadt Kremnitz war.
Karl zeugte zwei Kinder mit seiner Frau, einer geborenen Apfelbeck, die ebenfalls Anna hieß, wie jene Anna Josefa in Böhmen, wie Josefs, des Färbers, Frau, wie deren ältestes Kind, er wurde, noch jung, in seinem Revier eines Nachts von Schmugglern erschossen, seine Frau blieb mit den Kindern mittellos zurück. Ich habe das Forsthaus, in dem sie mit Mann und Kindern gelebt hat, gesehen, ich bin mit dem Vater dort gewesen, es liegt auf einer einsamen Höhe, umgeben von dichten Wäldern, ich kenne den Ort, an dem sich das traurige Schicksal des k. k. Waldübergehers Karl erfüllte, ich brauche, um mir das furchtbare Geschehen vorzustellen, keine Lupe, kein Augenglas, keine Fotografie.
Ich stelle mir eine Neumondnacht vor, kein Stern am Himmel, kein Schimmer von Licht zwischen den hohen Bäumen, ich sehe Karl nicht, von dem wir kein Bild besitzen, aber ich weiß ihn im Wald, auf schmalen, finsteren Wegen, das Gewehr über der Schulter, in Erfüllung seiner Pflicht den Schmugglern auf der Spur, vielleicht ist er gewarnt worden, vielleicht hat eine Schmugglerbraut ihren ungetreuen Liebsten verraten, vielleicht hat Anna, die Frau, ihn gebeten, den gefährlichen Gang zu unterlassen, auf die beiden unmündigen Kinder gezeigt, versucht, ihn zurückzuhalten, er aber, eingedenk seiner Pflicht, ist trotzdem gegangen, hat das Knacken der Zweige im Gebüsch gehört, sein Gewehr in Anschlag gebracht, er hat vielleicht HALT, WER DA! gerufen, hat die Schmuggler erschreckt.
Vielleicht hat er auch einen oder mehrere Warnschüsse in Richtung des Knackens abgegeben, aus dem Gebüsch haben die Schmuggler zurückgeschossen, Karl ist auf dem Waldweg niedergesunken, am nächsten Morgen haben ihn Holzarbeiter gefunden und seiner Frau Anna ins Forsthaus gebracht. Ich stelle mir Anna, geborene Apfelbeck, vor, wie sie niedersinkt an der Bahre, vielleicht hat sie geschrien, vielleicht hat sie geweint, vielleicht war sie stumm, ohne Tränen, versteinert, erstarrt in furchtbarem Schmerz. Ich sehe sie, Wochen später, aus der grün gestrichenen Tür des Forsthauses treten, das ich ja kenne, die beiden Kinder an der Hand, das Forsthaus für immer verlassen. Wo sie hingegangen ist, wo sie gelebt hat, gestorben ist, wissen wir nicht, nur, daß sie, weil sie arm war, gezwungen war, sich von ihren Kindern zu trennen.
Alle Fotografien, Dokumente und Briefe, alle die Familie betreffenden Erinnerungsstücke, die der Vater gesammelt hatte, sind in den ersten Tagen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlorengegangen. Nachdem die Artillerie der deutschen Wehrmacht ihre letzten Schüsse über die Häuser der Stadt hinweg in die gegenüberliegenden Weinberge und Weinkeller, aber auch in die Häuser und Gärten der Stadt hinein abgefeuert hatte, nachdem die Stalinorgeln von den der deutschen Artillerie gegenüberliegenden Hügeln zu heulen aufgehört hatten, nachdem sich in den Häusern, Hauskellern, Weinkellern, in den Straßen und Gassen, sogar im Hause des Pfarrers, in das sich Frauen, Mädchen und Kinder geflüchtet hatten, beinahe Unbeschreibliches zugetragen hatte, nachdem es also in der Stadt wieder einigermaßen ruhig geworden war, die Eltern aus dem Obst- und Gemüsekeller in das erwähnte Badezimmer übersiedelt waren, richtete man in der Wohnung, die sie vorher bewohnt hatten, ein Lazarett für die verwundeten russischen Soldaten ein. Man entfernte die überflüssigen Möbelstücke und warf, was man nicht brauchte, einfach aus dem Fenster auf die Straße hinaus. Bücher und Briefe, Klavierauszüge und Noten, Czernys Schule der Geläufigkeit, aber auch der Fingerfertigkeit, Annas Schulhefte und Zeugnisse, überhaupt alles, was aus Papier war, womit man nichts anzufangen wußte, soll in einem großen, beinahe bis an das Fenster der im Halbstock gelegenen Wohnung hinaufreichenden Haufen auf dem Gehsteig gelegen sein. Auch das Wanderbuch von Josef, dem Färber, ist auf diese Weise abhanden gekommen.
Da auch aus den Fenstern der Wohnungen und Häuser der anderen in Böhmen und Mähren ansässigen Verwandten Papiere, Dokumente, Briefe und Fotografien auf die Straßen und Gehsteige geworfen, von dort auf Abfallhaufen gebracht oder einfach vom Wind weggetragen, vom Regen aufgeweicht, von den Schuhen darüber wegsteigender Leute zerrissen und zertreten worden sind, ist es später nicht mehr möglich gewesen, auch nur einen Teil davon wiederzubekommen. Es ist aber auch von den in Wien und in der Umgebung von Wien, in Graz und in der Umgebung von Graz, in Niederösterreich und in der Steiermark lebenden Verwandten und anderen der Familie befreundeten Personen beim Entrümpeln von Schubladen, Schränken, Dachböden, bei Übersiedlungen, Wohnungswechsel oder nach dem Tod einiger schon alt gewordener Familienangehöriger, von anderen ungenügend Informierten vieles weggeworfen, verbrannt, vernichtet worden, was nicht hätte vernichtet werden müssen. Trotzdem sind durch Schenkung und Erbschaft einige wenige Erinnerungsstücke in meinen, beziehungsweise in den Besitz meiner Eltern gekommen. Vor allem von dem aus Niederösterreich und aus der Steiermark stammenden Teil der Verwandtschaft, also der Familie der Mutter des Vaters, ist einiges erhalten geblieben, es wurde uns zu verschiedenen Anlässen geschenkt, beziehungsweise von noch lebenden Verwandten ins Haus gebracht, manchmal auch von Verwandten an uns verkauft.
In meinem Besitz sind zum Beispiel ein mit rotem Samt überzogener Osterhase mit Butte, der einst der Tochter des Waldübergehers Karl gehörte, sowie ein Mörser aus Messing samt dazugehörigem Stössel und eine eiserne Kaffeemühle mit verborgener Kurbel, beides von Karls Tochter wiederum ihrer Tochter als Heiratsgut mitgegeben. Außerdem besitzen wir ein Kästchen, das Franz Joseph, der Kaiser, anläßlich einer Jagd im Lainzer Tiergarten der dort bei ihrem Onkel und dessen Frau lebenden, damals dreizehnjährigen Tochter des unglücklichen k. k. Waldübergehers geschenkt hat und auf dessen Deckel die k. k. Hofoper abgebildet ist.
Es sind aber auch durch Schenkung und Erbschaft wieder Fotografien in den Besitz des Vaters gekommen, der Vater hat sie sorgfältig in einem Album gesammelt, das Album hat er bei einem Trödler erstanden, der Rücken des Albums ist beschädigt, die Ecken sind abgestoßen, aber die Fotografien passen in die schon vergilbten, mit ovalen und rechteckigen Aussparungen versehenen Blätter hinein, als wären sie immer schon darin gewesen.
Aus den Bildern, die in dem Album versammelt sind, blicken mir einige von denen, die vor mir gelebt haben, entgegen. Bräunlich verfärbt, heben sich ihre Gesichter und Körper vom bräunlich verfärbten Hintergrund ab. Sie stehen vor gemalten Kulissen, an gemalte oder aus Holz und Pappe gefertigte Marmorkamine, Kommoden, Birkenzäune gelehnt, in dem Album sind sie versammelt, Anna, die Frau des Waldübergehers als Witwe, ihre Tochter, ihr Sohn Hermann, als Leobner Student, als Feilenfabriksdirektor, dessen Frau Amalia, Tochter Franz Xavers, des Erbpostmeisters, ihre Kinder und Enkelkinder, aus den Fotografien sehen sie mich an, mit aufgesteckten Zopfkronen, Lockenfrisuren, mit sorgfältig gescheiteltem Haar, gebürsteten Bärten, in Loden, Tuch, in gefältelten Taft, in Seide oder in gefärbtes, bedrucktes Leinen gekleidet, in festlichen Roben, im schlichten, rüschenbesetzten Hauskleid mit Flügelärmeln, den Hals von Spitzen umkraust, die Brust in enge Mieder gezwängt. In dem Album sind sie vereint, die einander nicht kannten, aber zur gleichen Zeit lebten, Josef, der Färber, in Mähren, Hermann, der Feilenfabriksdirektor, im niederösterreichischen Furthof, Anna, die Färbersfrau, mit den großen, verarbeiteten Händen und dem griesgrämigen Gesichtsausdruck, und Amalia, die Tochter des Erbpostmeisters, die Geselligkeit liebte, für Mondscheinpartien schwärmte, auf zugefrorenen Teichen Schlittschuh lief, die in Gasthäusern jodelte und ihrer schönen Stimme wegen nicht nur in Furthof, sondern auch in Hohenberg und überhaupt in der näheren Umgebung Furthofs als DAS LERCHERL bekannt und beliebt war. Anna, die Schwerblütige, die ihre schöne, vom städtischen Leben träumende Tochter zwang, einen Fleischhauer aus dem eigenen Dorf zu heiraten, Amalia, die das Kind ihrer Tochter Marie zu fremden Leuten brachte, wo es an Tuberkulose erkrankte und starb.
Ich, die viel später Geborene, weiß um ihre Sünden und um ihre Träume, ich weiß, wie sie lebten und wie sie gestorben sind.
Ich greife zur Lupe, setze die Brille auf, halte die Lupe vor mein rechtes Augenglas. Das Gesicht FRANZ XAVERS, des Gastwirts und Erbpostmeisters, der in steirischem Lodenrock und steirischer Weste, den steirischen Almstock in der linken, die Pfeife mit dem langen Rohr in der rechten, von Gichtknoten verformten Hand, auf einem künstlichen Felsen vor gemalter Almhütte und gemalten Tannenbäumen sitzt, hebt sich ab vom verblichenen Papier, die Barthaare, die buschigen Augenbrauen, die Falten auf den Wangen und am Hals werfen Schatten, die lebhaften, klugen Augen hinter den winzigen, metallgefaßten Brillengläsern sehen mich mit freundlicher Skepsis an. Ich sitze dem Vater eines meiner Urgroßväter gegenüber, der von einem steirischen Hufschmied abstammt, dessen Ahnen bis in eine weit zurückliegende Vergangenheit steirisch gewesen sind, dessen Heimat die Steiermark gewesen ist, der seine Zugehörigkeit zu diesem Land durch Kleidung und Haltung dokumentiert. Als die Fotografie, die ich von ihm besitze, gemacht wurde, war er schon ein alter Mann, war am Grab eines seiner Söhne gestanden, hatte die Frau verloren, das Unglück der Enkelin miterlebt. Ich sehe ihm in die Augen, ich betrachte das Gesicht dieses Mannes, der lange vor mir gelebt hat, ohne den ich nicht wäre, was ich bin, ich empfinde Zuneigung zu diesem Gesicht.
Ich wende die Seiten des Albums, das auf der Holzplatte meines Schreibtisches liegt, betrachte durch Lupe und Augenglas die Gesichter derer, die nach Franz Xaver gewesen sind. Dann nehme ich ein Blatt und zeichne rechteckige Kästchen, in die ich Namen schreibe, denke mir Landschaften um diese Kästchen, mährische Hügel, böhmische Wälder, denke mir die Gold- und Silberstadt Kremnitz in ein enges, von Bergen eingeschlossenes Tal, Kremnitz, Körmetz, den ungarischen Namen gibt es nicht mehr, denke mir ein gotisches Schloß, Kirchen, Bürgerhäuser, Kapellen, Kremnitz, wo man im Münzamt die Gold- und Silbergulden prägte, ich höre in den Pochwerken die Pochstempel pochen, ich höre das Klingeln der Münzen, die zu den anderen Münzen fallen.
WIR WOLLTEN ALLE NACH WIEN, sagt der Vater. Franziskus verließ Kremnitz, das schon seinem Vater und dessen Vater HEIMAT gewesen war, er ging mit Frau und Kindern nach Wien, ich ziehe zwei schräge, auseinanderlaufende Linien von dem Kästchen, in welchem sein Name steht, abwärts, schreibe die Namen seiner Söhne hinein, denke mir burgenländischen Laubwald um das Kästchen mit dem Namen des unglücklichen, von Schmugglern erschossenen k. k. Waldübergehers Karl, die sanften Hügel des Rosaliengebirges, zeichne zwei weitere, wiederum auseinanderlaufende Linien von seinem Namen weg abwärts, trage die Namen seiner Kinder ein. Die Tochter nahm ein Bruder des Waldübergehers zu sich, er war Förster im Lainzer Tiergarten bei Wien, im Lainzer Tiergarten fanden kaiserliche Jagden statt, es kam vor, daß die Jäger im Forsthaus einkehrten, von der Försterin bewirtet wurden. Die Tochter Karls aus dem burgenländischen Rosaliengebirge erlebte im Forsthaus ihres Onkels den wahrscheinlich größten Augenblick ihres Lebens, an den sie noch im Alter zurückdachte, den sie ihrer Tochter so eindringlich, so anschaulich zu schildern wußte, daß diese wiederum ihrer Tochter das Erscheinen des jungen Kaisers in der Tür, den Eintritt des Kaisers in das Forsthaus, seine Kleidung, seinen Gesichtsausdruck, ja den Klang seiner Stimme noch so genau zu beschreiben vermochte, als wäre dies alles ihr selbst und erst vor ganz kurzer Zeit widerfahren.
Der Kaiser also, Franz Joseph, siebenundzwanzigjährig, betrat das Forsthaus, der Förster verneigte sich tief, die Försterin brach beim Knicks beinahe in die Knie. Franz Joseph aber sah nur die dreizehnjährige Nichte des Paares an, ging lächelnd auf sie zu und überreichte ihr seinen Säbel. Die Tochter des Waldübergehers Karl, das Waisenkind, durfte den Säbel des jungen Kaisers in Verwahrung nehmen. Ich brauche keine Lupe und keine Fotografie, um mir dieses Ereignis in allen Farben und Dimensionen vorzustellen.
Hermann, den siebenjährigen Sohn des Waldübergehers, holte ein Verwandter, ein Bäckermeister, als Lehrling zu sich in das hunderttürmige, goldene Prag. Sie haben nichts voneinander gewußt, aber sie haben zur gleichen Zeit gelebt, sie sind zur gleichen Zeit, wenn auch an verschiedenen Orten, in verschiedenen Landschaften, Kinder gewesen.
Wie Josef, der Färberlehrling in Schildberg, so hatte auch Hermann als Bäckerlehrling in Prag kein leichtes Leben. Die Mehlsäcke konnte der Kleine zwar noch nicht schleppen, die Tröge, in denen der Teig geknetet wurde, aber die Körbe mit den Broten allein schon waren schwer, die Püffe und Schläge, die er vom Meister und seinen Gehilfen, wohl auch von der Meisterin einzustecken hatte, werden zahlreich gewesen sein.
Lange vor Tagesanbruch jagte die Meisterin oder eine ihrer Mägde das Kind aus dem Bett, wenn es in einem solchen überhaupt geschlafen hat, wenn es nicht irgendwo in einem Winkel auf einem Strohsack oder auf Lumpen lag. Im Morgengrauen, wenn in der Backstube das Nötige getan war, machte sich der Junge mit Körben voll Gebäck auf den Weg durch die Gassen der Hauptstadt Böhmens, er wird nicht viel gesehen haben vom Glanz dieser Stadt, er schleppte Brot vor die Türen der Bürgerhäuser, wurde gescholten, wenn er nicht pünktlich kam, wenn er unterwegs gerastet hatte, sich um Minuten verspätete. Schließlich zog er sich, schwächlich, wie er war, beim Heben eines großen Brotkorbes einen Leistenbruch zu, wurde zum unnützen Esser, den man zur Arbeit nicht mehr verwenden konnte, den man aber, da er zur Verwandtschaft gehörte, da man ihn aus Mildtätigkeit ins Haus genommen hatte, nicht einfach auf die Straße jagen, zur Mutter zurückschicken konnte, wurde noch mehr herumgestoßen, noch öfter geschlagen, war allen im Haus und in der Bäckerei Tätigen im Wege, ein krankes, unglückliches Kind.
Wir kennen den Namen des Mannes nicht, der sich schließlich seiner angenommen, ihn aus dem Haus des Bäckers weg in sein eigenes Haus geholt, zur Schule geschickt hat. Sein Name und seine Person sind im Dunkel geblieben. Dem Bäckerjungen Hermann aber ist in Prag eines jener Wunder widerfahren, die es selten, aber doch hin und wieder gibt. Er durfte die Schule abschließen, deren Besuch man ihm ermöglichte, er wurde nach sorgfältiger Prüfung seiner Talente nach Leoben zum Studium an die Bergakademie geschickt. Er war fleißig, gewissenhaft, legte erfolgreich die erforderlichen Prüfungen ab, brachte es nach vielerlei Umwegen und Zwischenstationen zum technischen Angestellten in einem Eisenwerk im steirischen Kindberg, später zum leitenden Direktor einer neu eröffneten Feilenfabrik in Furthof.
Franziskus aus Kremnitz zeugte Karl, den Waldübergeher, Karl zeugte Hermann, Hermann zeugte vier Kinder, Helene, Marie, Friederike und Franz.
ICH MÖCHTE NOCH EINMAL NACH FURTHOF FAHREN, EINMAL NOCH, sagte der Vater. Furthof ist die Heimat seiner Mutter gewesen. Wenn man so alt geworden ist wie er, hat man bei allem, was man unternimmt, das Gefühl, es sei das letztemal.
Der Sommer in diesem Jahr war feucht gewesen, Regen im Juli, Regen im August, überall Überschwemmungen, Katastrophen. Im September war endlich die Sonne gekommen, der Herbst war warm und hell, Ende Oktober hing das Laub noch in den Bäumen, die Rasenflächen in den Parkanlagen und zwischen den Häuserblöcken der Satellitenstädte waren grün, alles war vollgesogen mit Feuchtigkeit.
Das Wetter war immer noch schön, war, wie es häufig Ende September ist, weiße Wolken zogen über den in allen Blautönen schattierten Himmel.
Wir unternahmen die Fahrt an einem Wochentag, der Vater und ich, wir fuhren auch nicht über die Autobahn, sondern über die Bundesstraße. Der Wienerwald leuchtete in allen Gelb- und Brauntönen. In Sankt Pölten zweigten wir ab.
Wir wollen zuerst nach Kilb fahren, sagte der Vater. Die Häuserfassaden des winzigen Marktfleckens waren in Sonnenlicht getaucht.
Hier hat deine Großtante gelebt, sagte der Vater und zeigte mir das Haus, ein hübsches Bürgerhaus gleich neben der Kirche. Der Vater fotografierte die Kirche, er fotografierte das Haus, er ging mit kleinen, vorsichtigen Greisenschritten hin und her, von einer Straßenseite zur anderen, er schützte die empfindlich gewordenen Augen mit vorgehaltener Hand gegen das zu grelle Licht, ließ sich Zeit mit der Einstellung der Entfernung, der Belichtung, der Blende, überlegte die Schattenwirkung.
Das Kirchenportal, der Gasthof ZUM SEIDENSCHWAN, das Tor des Hauses, in dem die Schwester seiner Mutter mit einem Mann gelebt hatte, der ONKEL PEPI hieß.
Helene, eine lebenslustige junge Frau, sagte der Vater, hierher verschlagen, MAN MUSS SICH DAS VORSTELLEN. Furthof war auch nicht größer, aber dort waren die Geschwister, dort war die Familie, dort war immer etwas los, DAFÜR HAT SCHON DIE MUTTER GESORGT.
Der Onkel Pepi, EIN GUTMÜTIGER MENSCH, Postmeister und Stationsvorsteher zugleich, die Station der Mariazellerbahn. Die Züge gingen selten, sagt der Vater, zweimal im Tag, einmal hin, einmal zurück. Wenn der Zug kam, war der Onkel Pepi im Dienst, dann setzte er die rote Kappe auf und eilte zum Bahnhof. Seine Freizeit verbrachte er im Gasthof ZUM SEIDENSCHWAN.
Helene war viel allein, sie langweilte sich, der Gemeindearzt war jung und hatte ein Motorrad mit Beiwagen.
SIE HABEN ETWAS MITEINANDER GEHABT, sagt der Vater, DER GEMEINDEARZT UND DIE TANTE HELENE. Der Onkel Pepi hat sich, wie er es endlich erfahren hat, scheiden lassen, die Tante Helene ist nach Wien gegangen, als Beamtin der Post- und Telegraphendirektion, der Sohn ist beim Vater geblieben. Ich sah zu den Fenstern des hübschen Bürgerhauses hinüber, ich versuchte mir Helene vorzustellen, von der wir mehrere Fotografien besitzen, Helene als Kind, als Mädchen, als junge Frau, als Beamtin der Post- und Telegraphendirektion, ich dachte mir ihr schönes ovales Gesicht hinter die Scheiben eines der im ersten Stockwerk gelegenen Fenster, ich sah ihr zur Krone aufgestecktes dichtes Haar, über das sie gerne seidene Schleifen knotete, den schmalen Hals im Spitzenkragen, die dunklen Augenbrauen, den schön geschwungenen, hochmütig wirkenden Mund, ich stellte mir vor, wie sie auf den Gemeindearzt wartete, ich hörte das Motorrad knattern, ich hätte gerne eine Fotografie des Gemeindearztes gehabt, doch eine solche hat es niemals gegeben, jedenfalls keine, die im Besitz der Familie war.
Die Tante Helene ist schon als Mädchen in Furthof Postbeamtin gewesen, POSTFRÄULEIN, sagte der Vater. In Kilb hat sie ihren Beruf nicht ausgeübt. In Kilb war Langeweile, war der Gemeindearzt mit dem Motorrad. ICH MÖCHTE NOCH EINMAL MIT DER MARIAZELLERBAHN FAHREN, sagte der Vater, EINMAL NOCH.
Im Frühjahr, wenn du willst, können wir fahren, sagte ich.
Wir gingen über den Platz, um das Haus herum, in welchem Helene gelebt hatte, an das Haus schloß sich ein Garten an, der Vater erkannte den Garten wieder, den Bach, der am Garten vorbeifloß. Als Sechsjähriger war er mit seinen Eltern hier gewesen und hatte seine Tante Helene besucht.
DER REIS RUDI, sagte er plötzlich, HATTE EIN DREIRAD. Kindersehnsucht, nach beinahe achtzig Jahren wieder wach geworden, niemals ganz vergessen. Der fremde Junge damals hatte ein Dreirad, er hatte keines gehabt. Altgewordene kehren in die Kindheit zurück, der Kreis schließt sich, die Kindersehnsüchte kehren wieder. Der Reis Rudi mußte, wenn er noch lebte, fünfundachtzig Jahre alt sein, vielleicht mehr.
Wiederbegegnung mit Orten, an denen man als Kind gewesen ist, später vielleicht noch ein oder das andere Mal, aber die Jahre dazwischen sind untergegangen, vergessen.
In Marktl suchten wir nach dem Haus Nummer neunzehn, in dem Hermann, der Sohn des Waldübergehers, nach seiner Pensionierung gelebt hatte. Ob der Park damals schon so gewesen sei? Die alte Linde stand sicher schon, LINDEN WACHSEN NICHT SO SCHNELL.
Der Vater fotografierte das Haus und die Linde, im Gras neben dem Weg lag ein alter Mühlstein, das Laub der Linde leuchtete gelb im einfallenden Sonnenlicht, auch die Birken vor dem Haus leuchteten.
Mittags aßen wir in dem Gasthof, der früher anders geheißen hatte und der dem Haus Nummer neunzehn gegenüberlag.
HIER HABEN MEINE GROSSELTERN OFT ZU MITTAG GEGESSEN. Statt der Funderplatten an der Wand mußt du dir eine Holztäfelung denken, sagte der Vater, dort, wo die Theke ist, wird ein Ofen gestanden sein, man sieht noch das Abzugsloch in der Wand. Und der Fußboden war auch nicht lackiert, den hat man mit Seifenwasser weiß gerieben.
Wir saßen an einem Tisch, dessen Platte mit Kunststoff belegt war, von den Fußbodenbrettern war der Lack an vielen Stellen abgetreten, die abgeblätterten Stellen waren schwarz und schmutzig, auf dem Fensterbrett lagen tote Fliegen.
DU BAUERNSAU, sagte ein Kartenspieler am Nebentisch zu seinem Nachbarn, DU VERFLUCHTE BAUERNSAU. Er trug eine schwarze Samtjacke und eine auffallend gestreifte Krawatte. Die anderen lachten.
Der Wirt fragte nach unseren Wünschen, wir bestellten das Essen. Meine Großeltern, sagte der Vater, haben hier längere Zeit gewohnt, sie waren mit dem Fabrikanten N. befreundet. Sein Sohn müßte noch leben.
Der ist schon lange tot, sagte der Wirt.
Um 1893 herum muß es gewesen sein, sagte der Vater hartnäckig. Er sprach die Jahreszahl aus, als sei es vorgestern oder gestern gewesen. Der Wirt sah ihn halb belustigt, halb erstaunt an. Die Männer am Nebentisch waren plötzlich still und drehten sich neugierig nach uns um.
Das alles betrifft mich nicht, dachte ich, als wir weiterfuhren, und es geht mich doch an. Wenn der Vater gestorben ist, wird alles, was er gewußt hat, vergessen sein.
Das Haus in Furthof lag direkt an der Straße, neben der Feilenfabrik, es war groß, einstöckig, das in zwei Stufen abfallende Dach war mit grauen Schindeln gedeckt. Zur Eingangstür führten fünf Stufen hinauf, die Tür war von einem kleinen, eisernen Balkon überdacht, der Balkon wurde von eisernen Säulen getragen.
MAN NANNTE ES DAS HERRENHAUS, sagte der Vater, hier war auch die Poststation untergebracht, hier hat die Postkutsche gehalten, sie ist von Schrambach gekommen, um ein Uhr mittags, glaube ich, von weitem hat man den Postfranzl auf seinem Horn blasen gehört.
Er ging auf die andere Straßenseite hinüber, stellte sorgfältig Entfernung, Zeit, Blende ein, fotografierte das Haus von der Vorderseite, ging um das Haus herum, fotografierte es von der Rückseite, den an die Rückseite des Hauses anschließenden, früher wahrscheinlich gepflegten, jetzt verwilderten Garten.
Hier muß es einen Springbrunnen gegeben haben, sagte er, meine Mutter hat mir davon erzählt.
An lauen Sommerabenden sei die Familie oft im Garten beisammengesessen, der Mond habe geschienen, der Springbrunnen habe geplätschert, Hermann, der Großvater, habe einen KURZEN TSCHIBUK geraucht, den Tschibuk habe er mit schwerem türkischen Tabak gestopft. KINDER, IHR WISST NICHT, WIE SCHÖN IHR ES HIER HABT, habe er oft gesagt, auch das habe ihm, dem Vater, seine Mutter berichtet. SIE HAT IMMER EIN WENIG HEIMWEH NACH FURTHOF GEHABT.
Ich suchte den Garten nach den Resten eines Springbrunnens ab, aber ich fand nichts, was auf die Existenz eines Springbrunnens in früheren Zeiten hingewiesen hätte, ich fand nur ein kleines, abgezäuntes Viereck, in dem Karotten, Petersilie und einige Krautköpfe wuchsen. HIER HAT MEINE GROSSMUTTER WAHRSCHEINLICH IHR GEMÜSE GEZOGEN. Die Familie habe einfach gelebt, sagte der Vater, zum Abendessen habe es oft STERZ gegeben, Braten nur sonntags und an Feiertagen. Amalia habe Gänse und Hühner gehalten, sie außer mit dem üblichen Körnerfutter auch mit in Milch getauchten Semmeln gefüttert, um den Geschmack des Fleisches zu verbessern. (Das SCHOPPEN der Gänse sei in ihrer Heimat, der Steiermark, nicht Sitte gewesen und habe als Grausamkeit und Tierquälerei gegolten.)
Den Pferden habe man übrigens, wenn man von einem Ausflug rascher heimkommen wollte, ebenfalls Semmeln zu fressen gegeben, diese Semmeln aber habe man in Wein getaucht.
Dem Feilenfabriksdirektor seien Wagen und Pferde zur Verfügung gestanden, oft habe man Ausflüge unternommen, man sei in das Gasthaus ZUR BRUCK gefahren, nach Marktl, Sankt Egyd, Lilienfeld, man habe Bekannte besucht, aber auch größere Fahrten unternommen, etwa nach Neuberg, Freiland oder Mariazell. Das alles wisse er, sagte der Vater, aus Amalias Tagebuch.
Nach Amalias Tod sei dieses Tagebuch unter den Erben geteilt worden und er, der Vater, habe seinen Teil gewissenhaft abgeschrieben und an die anderen Erben verschickt, seinerseits die Abschrift der anderen Teile von ihnen erbeten, aber auf seine Bitte niemals Antwort erhalten. Außer mir, sagte er, hat sich wahrscheinlich niemand die Mühe des Abschreibens gemacht. WER WEISS, OB SIE ES ÜBERHAUPT GELESEN HABEN, WAHRSCHEINLICH HABEN SIE, WAS SIE BEKOMMEN HABEN, EINFACH WEGGEWORFEN ODER VERBRANNT.
Rückwärts an den Garten schlossen sich kleine Gebäude an, Schuppen und Stall, HIER WAREN DIE KUTSCHEN UND DIE PFERDE UNTERGEBRACHT, MEINE MUTTER LIEBTE PFERDE UND HIELT SICH BESONDERS GERNE IN DER KUTSCHERSTUBE AUF, im Hintergrund stiegen die Wiesen zu einem Hügel an, auf dem Hügel begann der Wald.
HIER GING MAN ÜBER DIE ANNENHÖHE ZUR BRENNALM HINAUF. Ausflüge zur Brennalm, Schlittenpartien, Feuerwehrfeste. Am Fronleichnamstag trugen die Mädchen Blütenkränze im aufgelösten, tags zuvor mit Zuckerwasser befeuchteten und eingedrehten Haar. FRÜHMORGENS BRACHTE DIE WERKSKAPELLE MEINEM GROSSVATER EIN STÄNDCHEN.
Laientheater bei Silvesterfeiern, LEBENDE BILDER, meine Mutter und ihre zwei Schwestern sollten einmal GLAUBE, LIEBE UND HOFFNUNG verkörpern, sagte der Vater, meine Mutter sollte dabei einige Verse sprechen, verlor aber aus Lampenfieber die Sprache und brachte nur die Worte: ICH BIN DIE LIEBE heraus.
Hermann, der Sohn des Waldübergehers aus dem Rosaliengebirge, reiste nach London und brachte von dort moderne Feilenhaumaschinen mit, er stellte die Fabrik auf Maschinenbetrieb um.
Der Vater fotografierte die Feilenfabrik, er fotografierte die Haupt- und Nebengebäude, die Aufschrift über dem Portal.
Er habe nie herausbekommen können, sagte er, warum sein Großvater so früh pensioniert worden sei. In Amalias Tagebuch sei von GROSSEM KUMMER die Rede, Näheres habe wahrscheinlich in den anderen, durch die Nachlässigkeit der Erben verlorengegangenen Teilen gestanden. Er habe sich bemüht, der Sache auf den Grund zu gehen, irgend etwas müsse damals geschehen sein, wovon seine Mutter ihm nie erzählt habe, worüber sie nicht habe sprechen wollen, er habe schon vor vielen Jahren damals noch lebende Bekannte seines Großvaters nach den Zusammenhängen gefragt, aber nie die erwartete Auskunft bekommen. JETZT IST ES ZU SPÄT, sagte er, JETZT SIND ALLE, DIE ES GEWUSST HABEN, SCHON LANGE TOT, JETZT WERDEN WIR NIE MEHR ERFAHREN, WAS DAMALS GESCHEHEN IST.
Ich stand auf der Straße, vor dem Haus, beobachtete den Vater, der mit kleinen, vorsichtigen Schritten hin und her ging, ließ die Zeit zurückspringen, ein ganzes Jahrhundert zurück, dachte an jene, die in diesem Haus gelebt hatten, sah Amalia, wie ich sie von den Bildern her kannte, jung, resolut, lebenslustig und selbstbewußt, Tochter des Gastwirts und Erbpostmeisters aus Mürzhofen, die in ihrem Tagebuch gewissenhaft registrierte, wann sie Wäsche eingeweicht, Kleider zugeschnitten, Jacken genäht, Gemüse geerntet, wann sie Gäste empfangen, Besuche gemacht hat, wann sie mit den Kindern zur Kirche ging, wann sie geweint hatte und wann sie glücklich war, sah vier Kinder, drei Mädchen und einen Jungen, in einem von Ziegenböcken gezogenen Wägelchen sitzen, hörte die Kinder lachen, ließ die Zeit wieder vorwärtslaufen, das Leben dieser Kinder an mir vorbeiziehen, dachte daran, wie jedes von ihnen sein eigenes, ganz persönliches Unglück gehabt hatte.
Ich dachte daran, daß man Helene den Sohn genommen hatte, daß sie von Onkel Pepi, DER EIN GUTMÜTIGER MENSCH GEWESEN IST, aus dem Haus gejagt worden war.
Ich dachte an die schöne, unglückliche Marie, die zweitälteste der Töchter, die von einem im Haus arbeitenden Zimmermaler vergewaltigt worden war, sie mußte das Kind zur Welt bringen, es war ein Sohn, man brachte ihn sofort nach der Geburt zu fremden Leuten, für Marie war das Leben zu Ende, man war glücklich, als sich schließlich ein Mann dazu bereit erklärte, sie trotzdem zur Frau zu nehmen. Der Mann war Witwer, er war so alt wie Hermann, der Feilenfabriksdirektor, er hatte Krebs und hoffte auf Heilung im warmen Klima von Abbazia, Marie durfte ihn dorthin begleiten, Abbazia brachte jedoch, wie sich denken läßt, keine Linderung seiner Leiden, er starb wenige Jahre nach der Heirat, und Marie war wieder allein. Sie versuchte, ihrem verpfuschten Leben einen Sinn zu geben, pflegte Schwerkranke und die Kinder anderer Leute, während ihr eigener Sohn, den sie nicht sehen durfte, selbst krank war und mit sechzehn Jahren an Tuberkulose starb.
Wir besitzen eine Fotografie von Marie aus jener Zeit, große Augen in einem schmalen, immer noch schönen Gesicht, eine Schwesternhaube auf dem hochgekämmten Haar. IN TREUER LIEBE MIT EUCH VERBUNDEN WIRD SEIN UND BLEIBEN SR. MARIE.
Später trat sie in den Orden der Franziskanerinnen ein. Um für die Sünde zu büßen, die andere an ihr begangen hatten, soll sie die niedrigsten Arbeiten verrichtet haben. Beim Waschen der Steinfußböden in den Klostergängen im Winter zog sie sich ein Nierenleiden zu, an dem sie wenige Jahre später starb.
(Darüber nachdenken, von welchen Zufällen, Kleinigkeiten, unüberlegt getroffenen Entscheidungen ein Leben bestimmt wird, der Verlauf eines Lebens abhängt.
Wäre der Malergeselle damals nicht mit der jungen Marie alleingelassen worden, hätte Amalia, aber auch Hermann, der Feilenfabriksdirektor, hätten Maries Schwestern dem fremden Malergesellen nicht vertraut, wäre nur eines der anderen Familienmitglieder im Haus geblieben, hätte die Möglichkeit, dem Mädchen Marie GEWALT ANZUTUN, für den Malergesellen nicht bestanden, hätte Marie kein Kind geboren, hätte sie einen Mann ihrer Wahl heiraten können, wäre sie VIELLEICHT GLÜCKLICH GEWORDEN.
Hätten Amalia und Hermann anders entschieden, hätten sie den Sohn ihrer Tochter Marie nicht zu fremden Leuten gegeben, wäre er vielleicht ein gesunder, tüchtiger Mann geworden, hätte er vielleicht die Tuberkulose nicht bekommen, obwohl Tuberkulose damals sehr verbreitet gewesen ist. Vielleicht wäre er ein guter Schüler gewesen, vielleicht hätte man ihn zum Studium an die Bergakademie nach Leoben geschickt, vielleicht hätte er Überdurchschnittliches geleistet, vielleicht wäre er Feilenfabriksdirektor geworden.)
IN HOHENBERG KÖNNEN WIR JAUSNEN, sagte der Vater.
Wir fuhren nach Hohenberg hinüber, suchten den Gasthof DURST, fanden ihn unter anderem Namen, er hieß jetzt GASTHOF ZUM ROTEN HAHN.
Im Gasthof SINGER war ein SALETTL, sagte der Vater, IN DIESEM SALETTL WAR JEDE WOCHE JOUR FIXE, du kannst es im Tagebuch nachlesen.
Der Vater hätte gerne das Salettl gesehen, aber der Gasthof Singer war geschlossen. Die jetzige Besitzerin ist eine Wienerin, sagte der Wirt vom ROTEN HAHN, sie kommt erst gegen Weihnachten wieder. ZU WEIHNACHTEN KÖNNEN SIE DAS SALETTL SEHEN.
Vielleicht können wir von der Anhöhe hinter dem Gasthof Singer von rückwärts in den Garten und auf das Salettl hinunterschauen, sagte der Vater.
Hinter der Kirche führte ein sehr schmaler Weg auf die Anhöhe hinauf, aber er war steil und steinig. Der Vater versuchte einige Schritte, gab dann auf, wagte sich nicht weiter vor, aber auch nicht zurück. Ich bleibe hier stehen, sagte er, geh du allein weiter und sage mir dann, was du gesehen hast.
Ich wollte ihm nicht sagen, daß mir das Salettl, in dem die Urgroßmutter ihren Jour fixe gehalten hatte, eigentlich gleichgültig war, kletterte ein Stück weiter hinauf, blickte immer wieder zurück, fürchtete, der Vater könnte abrutschen, fallen, sich weh tun, am Ende den Fuß brechen, wagte es nicht, ohne das Salettl gesehen zu haben, umzukehren, sah schließlich wirklich von weitem einen geschnitzten hölzernen Giebel zwischen den Bäumen eines Gartens, aber nicht mehr, der Rest war von den Baumwipfeln verdeckt, mehr als der Giebel war nicht zu erkennen. Ich kehrte um, ging zum Vater zurück, der immer noch auf dem schmalen Weg stand und auf mich wartete.
Es hat keinen Sinn, sagte ich, man sieht nur den Giebel. Wir werden gegen Weihnachten einmal herfahren, wenn der Gasthof geöffnet ist.
Wer weiß, was zu Weihnachten ist, sagte der Vater.