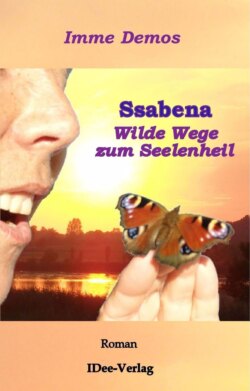Читать книгу Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil - Imme Demos - Страница 4
Aufbruch der Schale
ОглавлениеDie Sehnsucht nach meinem Ursprung begann im Grunde bereits als Kind. Genauer gesagt am Tag, an dem meine Eltern meine neue Schwester nach Hause holten. Ich war dreieinhalb Jahre alt.
Stolz trug meine Mutter das hellblaue Bündel auf dem Arm die Treppe hoch ins Bad. Auf dem Tischchen über unserer Badewanne zog sie das Baby behutsam aus. Die geröteten Pusteln in seinem Gesicht und auf seinem Körper leuchteten mir entgegen, bevor mich seine braune Hautfarbe erstaunte. Neugierig begutachtete ich das kleine Wesen.
„Mami, wie war das eigentlich, als ich aus deinem Bauch gekommen bin?“
„Du bist nicht aus meinem Bauch gekommen. Dein neues Schwesterchen auch nicht. Ihr seid aus dem Bauch von anderen Frauen gekommen. Und die wollten euch nicht, aber wir wollten euch. Deshalb seid ihr jetzt hier bei uns, bei Papi und mir.“
DONG! Die schwarze Leinwand in meinem Gehirn blitzte auf. Bilder erschienen. Diese erste Erinnerung an mein Dasein auf Erden gab den Startschuss für das Erwachen meines Bewusstseins. Der Film meines Lebens begann.
Zunächst stürzte ich in einen dunklen Abgrund der Entfremdung, voller Fragen, Zweifel und Ängste, für die ich keine Worte fand. Sobald niemand bei mir war, den ich anfassen oder mit dem ich reden konnte, hatte ich Angst. Obwohl meine Eltern abends mit uns beteten und uns lieb in den Schlaf sangen, verbrachte ich die Nächte angsterfüllt. Kaum hatten sie das Zimmer verlassen, zog ich mir die Bettdecke über den Kopf und machte mich so klein ich nur konnte. Meine Angst, entdeckt zu werden, glich eher einer Panik. Um nicht zu ersticken, baute ich mir direkt vor meinen Nasenlöchern einen Lufttunnel nach draußen. Mucksmäuschenstill wagte ich nicht mehr mich zu bewegen, bis ich in Schlaf fiel und beängstigende Träume träumte.
Noch bevor ich in die Schule kam, spürte ich, dass auf dieser Erde etwas falsch läuft, was alle Menschen betraf, selbst die Tiere und die Natur. Nur hatte ich keine Worte dafür und niemanden, der mit mir über solche Dinge sprach. Mich quälte das Gefühl, dass wir Menschen wie Schneeflocken einzeln vom Himmel fallen, ohne uns zu berühren, um am Ende einfach im Erdboden zu versinken. Das soll Leben sein? Gibt es nichts, was uns verbindet? Haben wir, außer nebeneinanderher zu existieren, nichts miteinander zu tun?
Obwohl die meisten ihre elterliche Herkunft kennen, sollte ich noch viele Menschen mit denselben Fragen treffen. Mein inneres Suchen entwickelte sich zu einem starken Trieb, der mich in fast alle Kontinente dieser Erde führte. Ich begab mich in fremde Kulturen, Religionen und Lebensformen, um herauszufinden, welcher Sinn sich hinter unserem Dasein verbirgt und vor allem, ob es ein Ende dieser treibenden, rastlosen Sehnsucht gibt und wir irgendwo einen Frieden finden, der uns erfüllt, und der bleibt!
Ohne mir im Klaren darüber gewesen zu sein, hielt ich Ausschau nach Lehrern, nach Meistern, nach Weisen, nach Antworten.
So nahmen die Dinge ihren Lauf. Gemeinsam mit meiner Adoptivschwester wuchs ich wohl behütet auf. Als Töchter aus gutem Hause mit Schwimmbad im Garten und Limousine vor der Tür spielten wir Golf und verbrachten die Ferien am Strand. Jede Woche kam ein Privatlehrer zum Klavierunterricht. Meine Eltern boten uns die besten Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit.
Dennoch schlief ich keine Nacht friedlich. Alpträume machten mir das Leben zur Hölle, gnadenlose Verfolgungsjagden von bösen Menschen. Hatten sie mich gepackt, zerriss der Schock abrupt meinen Schlaf und hallte nach bis zum Morgen. Auch am Tag ebbte der Irrsinn nicht ab. Ich nannte ihn meine Masken-Angst. Hinter jeder Tür, jedem Schrank, jeder Wand drohten Masken hervorzulugen, hinter denen sich bedrohliche Gestalten verbargen, um mir Schreckliches anzutun.
Oft war ich unglücklich und weinte, ohne zu wissen warum. Von niemandem verstanden, fühlte ich mich einsam, nicht dazugehörig. Zeitweilig plagte mich die Vermutung, behindert zu sein und keiner sagt mir die Wahrheit. Alle spielen ein Spiel und tun nur so als ob. Im Geheimen spielte ich auch manchmal – dass meine Familie ein Indianerstamm ist.
Angst haben gehörte zu meinem Leben, mit einer einzigen Ausnahme. Beim Musikmachen blieb sie fern. Dafür passierten andere unerklärliche Dinge. Wenn ich Klavier spielte, begann ich etwas um mich herum zu spüren, das in mir drin war und über mich selbst hinausging, endlos weit. Ich war Teil davon und konnte es gleichzeitig betrachten. Für das bloße Auge nicht erkennbar, sah ich es trotzdem überall fließen, um mich herum, durch mich hindurch, bis ins Universum und zu mir zurück. Die Musik glitzerte darin wie Sonnenstrahlen auf dem Wasser. Je kraftvoller mein Spiel, umso intensiver die Wellen, in denen ich mich wiederfand. Währenddessen saß ich in einer durchlässigen Kugel, nach oben hin geöffnet, wach, präsent, da! Doch kaum war der letzte Ton verklungen, setzten die Ängste wieder ein.
Eines Tages hieß es, mein leiblicher Vater sei Ausländer, ein Sizilianer. Das machte die Sache nicht gerade leichter. Wer oder was bin ich denn nun? Ich fühle mich schon immer zerrissen, ist es deswegen? Ist das bei allen Mischlingskindern so? Sollten wir nicht eher Bindeglieder sein? Wenn ich sowohl die eine Kultur als auch die andere in mir habe, kann keine davon falsch sein, sonst wäre ich zur Hälfte falsch. Demzufolge müssen beide richtig sein. Genau genommen bin ich reicher als die Einrassigen. Auf jeden Fall nahm Sizilien einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein.
Gerade volljährig geworden brach ich auf, meiner Seele folgend. Mein bester Freund begleitete mich.
Je südlicher wir fuhren, umso mehr geriet mein Inneres in Aufruhr. Bei Erreichen der Insel erblickte ich den ersten Sizilianer meines Lebens. Mein Gott, er könnte mein Vater sein, der andere mein Bruder, dieser mein Onkel, sie alle könnten meine Verwandten sein.
Aufgeregt bis in die Haarspitzen, brauchte ich mehrere Tage, um mich wieder zu beruhigen. So nah war ich meinen Wurzeln noch nie. Die Sonne, der Wind, das Zelten, die Natur, das Meer, das Licht, die Wärme, all das verkörperte die Verbindung zu meinem Ursprung. Mit jedem Atemzug sog ich diese Schwingungen ein, befüllte meine Zellen, was wirkte wie Balsam auf meine Seele. Nie wieder wollte ich innerhalb fester Wände schlafen.
Nach unserer Rückkehr bezog ich mit meinem Freund gemeinsam eine Wohnung, unser Nest, ein langersehnter Wunsch von mir, denn ich liebte ihn sehr. Ich bestand die schwierige Prüfung an der Hochschule und begann Musik zu studieren. Ich hatte allen Grund stolz und glücklich zu sein.
Dennoch hielten mich meine Ängste weiterhin fest im Griff. Sobald kein Mensch bei mir war, konnte ich mich nicht mehr vom Fleck rühren, blieb erstarrt sitzen, wo man mich allein gelassen hat, unfähig ans Telefon zu gehen oder auf die Toilette. Angst vor Maskenmenschen, die hinter Ecken lauern, vor Schlangen, die unter dem Bett hervorkriechen, vor Dingen, die sich von alleine bewegen, Schritten, die sich nähern, dem Ticken der Uhr, vor meinem eigenen Atem, vor der Stille und davor, dass gleich etwas unbeschreiblich Entsetzliches passiert. Mit all meinem Verstand konnte ich nichts dagegen tun – und ich bin nicht unintelligent. Ohnmächtig war ich den Ängsten ausgeliefert.
Singen brachte mich, ähnlich wie Klavierspielen, in Kontakt mit diesen Wellen, die durch mich hindurch bis ins Weltall reichen, deren Teil ich bin. Singen half mir, menschenleere Flure und Treppenhäuser zu überstehen, aber auch mich inmitten von vielen Menschen zu spüren. Musik machen verbindet den Menschen mit seinem Körper, seinem Geist und seiner Seele. Das war mir nicht bewusst, ich sang intuitiv.
Während eines Frühlings prangten an jeder Bushaltestelle der Stadt Plakate einer Parfumwerbung, auf denen eine Schlange um einen schönen Frauenhals lag, die nach vorne aus dem Bild herausschaute. Eine Schlange auf einem Foto zu sehen, ließ in mir ein extremes, unkontrollierbares Gefühl entstehen, als würde etwas aus meinem Körper extrahiert werden, sodass er sich zusammenzieht, bis sich die Kopfhaut kräuselt. Setzt der Schmerz ein, schüttelt er sich, lockert sich, verkrampft sich wieder bis an die Schmerzgrenze und schüttelt sich erneut, immerzu hin und her. Ich erklärte mir selbst, das sei Ekel, unaussprechlicher Ekel. Natürlich versucht man, solchen Phänomenen aus dem Weg zu gehen. In jenem besagten Frühling gelang es mir nicht, mit dem Fahrrad an den Schlangenplakaten vorbeizufahren. Ich nahm das Auto und verachtete mich dafür.
Doch selbst beim Autofahren bekam ich Angst. Vor dem, was sich unter meinem Sitz hervorwindet und vor der eisernen Faust, die hinterrücks meinen Nacken umschließt. Für den Verkehr blieb nur wenig Aufmerksamkeit übrig. Hatte ich versehentlich mal keine Angst, merkte ich nichts, fuhr abwesend und wunderte mich, wie ich von A nach B gekommen bin.
So konnte es nicht weitergehen. Die Ängste hinderten mich dermaßen an einem normalen Leben, dass ich mich entschied, ihnen die Stirn zu bieten. Um mich selbst anerkennen zu können, entwickelte ich eine Strategie: Alleine etwas unternehmen und es überleben!
Eine Seereise schien das Richtige zu sein, allein, aber mit anderen Menschen an Bord. Bei einer Schifffahrtsgesellschaft heuerte ich an.
Anstatt für meine Passage zu zahlen, arbeitete ich täglich acht Stunden an Bord, Offiziersmesse schrubben, in der Kombüse helfen, abwaschen, auf- und abdecken. Ich bediente die sieben deutschen Offiziere, in deren Händen die Leitung des Frachters lag. Der Koch, seine Frau und die einundzwanzig Matrosen waren, welch glücklicher Zufall, Sizilianer.
Diese Gelegenheit, von meinen Landsleuten ihre Sprache zu lernen, nutze ich. Mit dem Matrosen Antonio saß ich Abend für Abend an Deck, schaute über den Atlantischen Ozean bis zum Horizont und prägte mir ein sizilianisches Wort nach dem anderen ein. Die endlose Weite beruhigte mein rastloses Gemüt. Das schwimmende Gefängnis, von dem es kein Entrinnen gab, wurde zum goldenen Käfig. Umgeben von meinen Sizilianern, der Sonne, die jeden Tag heißer brannte, dem Meer, dem riesigen Himmel, den Sternen, die nachts zum Greifen nah waren, und meiner Kajüte, in der ich alleine schlief ohne Angst, war ich sehr stolz auf mich, dieses Abenteuer gewagt zu haben. Seltsamerweise spürte ich in der endlosen Weite des Meeres mehr Nähe als mitten unter Menschen.
Die Seereise führte mich an die Ostküste Brasiliens in die Hafenstadt Santos, unter Seeleuten ebenso legendär wie die Hamburger Reeperbahn.
„Die Prostituierten hier“, klärte der Chef-Ingenieur mich auf, „wissen genau, wann welches Schiff in den Hafen einläuft und welche Seemänner es mitbringt. Hat sich ein Seebär für eine der Ladies entschieden, ist sie ihm während seines Aufenthaltes nicht nur treu, sondern steht an seiner Seite wie eine Ehefrau, kocht ihm gutes Essen, sorgt sich um sein Wohl. Dafür erwartet sie, dass er jedes Mal zu ihr kommt, niemals zu einer anderen. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Keine würde es wagen, mit dem Mann einer anderen auszugehen. Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel.“
Der Chief, wie ihn alle nannten, nahm mich sogar mit zu seiner Dame nach Hause. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen staunte ich über ihr gepflegtes Englisch.
Natürlich schickten die Männer ihren Auserwählten auch von unterwegs etwas Geld. Einige der Frauen warteten darauf, irgendwann mit in die reiche, westliche Welt genommen zu werden und ein neues Leben zu beginnen. Die Verschworenheit unter ihnen faszinierte mich und ich sollte sie noch genauer kennenlernen.
Antonio lud mich zum Landgang mit den Matrosen ein. In lauer Abendluft fuhren uns zwei Taxis zu einem Tanzlokal, wo wir an einem der großen Tische Platz nahmen. Grünes Schummerlicht beleuchtete die Bar. Die Musik dröhnte. Antonio legte seinen Arm hinter mich auf die Rückenlehne der Sitzbank. Caipirinhas wurden gebracht. Ich verschwand Richtung Damentoilette.
Plötzlich baute sich eine Schwarzhaarige vor mir auf, blitzte mich wild gestikulierend aus feurigen Augen an. „Homem com barba e mina“, rief sie wütend, malte mit zwei Fingern einen Bart um ihren Mund, „homem com barba e mina, mina!“
Meinte sie Antonio? Ihr Zorn machte mir Angst. Ergeben hob ich die Hände, wendete mich um und flüchtete klopfenden Herzens zu meinem Begleiter. Außer mir vor Erregung versuchte ich, ihm die Begegnung zu beschreiben, er aber beschwichtigte. Zielstrebig sah ich die Frau zu einer Kollegin laufen. Nach kurzem, ungestümem Wortwechsel zeigte sie mit dem Finger auf mich. Die zweite Frau drängelte sich durch die Menge an die Bar zu einer dritten, flüsterte ihr ins Ohr. Beide schauten zu mir rüber. Die dritte alarmierte eine vierte, die auf der Stelle den Laden verließ. Langsam wurde mir mulmig. Ich fragte Antonio, was da los sei, ob er diese eine kennen würde. Er winkte ab, „si“ und „no“ und „no importante“. Verunsichert forderte ich ihn zum Gehen auf. Die vielen auf mich gerichteten Augenpaare waren mir unheimlich. Auf mein Drängen hin bahnten wir uns einen Weg zum Ausgang.
Drei Häuser weiter in Glorias Bar stießen wir auf den Chief mit seiner Dame. Großzügig lud er uns zu einer Runde Caipirinha ein und verabschiedete sich alsbald.
Knapp eine Minute später stand er wieder an unserem Tisch, berichtete besorgt, vor der Tür sei eine betrunkene Brasilianerin, die wüsste, dass Antonio und ich in dieser Bar säßen. Offenbar handelte es sich um die eifersüchtige Schwarze aus dem Tanzlokal. Das Gesicht wolle sie mir zerschneiden.
Die Männer gingen hinaus, um sie zu beruhigen.
Auf den Schrecken hin tranken wir einen letzten Caipirinha und brachen auf.
Im selben Moment, als ich die Straße betrat, schüttete mir jemand ein Glas Whisky ins Gesicht. Das Zeug brannte in den Augen, ich konnte nichts mehr sehen, hörte aber, wie meine Feindin blitzschnell das Glas an der Hauswand zerbrach, um mit spitzen Scherben auf mich loszugehen. Geistesgegenwärtig packte mich Barbesitzerin Gloria hinten am Kragen, zog mich zurück in ihre Bar, während die Männer mit der wilden Furie rangen. Mütterlich wischte mir Gloria den Whisky aus den Augen. Irgendjemand rief die Polizei, die sogar prompt erschien. Im Polizeiwagen wurde ich zum Schiff gefahren.
Ich erhielt Ausgangsverbot, solange wir im Hafen von Santos lagen. Die Frauen bildeten schnell eine Informationskette, und jede, die mich in der Stadt anträfe, egal ob Tag oder Nacht, würde mich ganz einfach umbringen.
„Sie fragen nicht, sie töten gleich“, erklärte der Polizist auf Portugiesisch.
Ich verstand und blieb an Bord.
Wie gerne hätte ich das Land ausgekundschaftet. Irgendwo hinter der Stadt, jenseits der Berge beginnt der Regenwald, in dem die Indios wohnen. Urnatur, Dschungel und Naturvolk zogen mich magisch an. Am liebsten wäre ich in den Urwald hineingekrochen, um mit echten Indianern zu leben – mein Kindertraum. Bei ihnen musste doch so was wie eine Essenz des Lebens zu finden sein, zumindest eine Lebensform, die unserer wahren menschlichen Natur entspricht. Ich hasste die Zivilisation.
Zwei Wochen später lief das Schiff in den Hafen von Buenos Aires ein, Hauptstadt Argentiniens. Enorm gespannt war ich auf diese Stadt, in Erwartung einer unbekannten, südamerikanischen Welt. Doch bis auf die Taxis sah es hier genauso aus wie in Berlin oder Paris. Meine Gier nach Neuem wurde noch nicht erfüllt. Oder suchte ich nach etwas Altem?
Zu Hause fiel ich sofort wieder in meine Ängste.
Aus Verzweiflung wandte ich mich an einen Psychoanalytiker, nahm nun zweimal die Woche an einer Gruppensitzung teil. Doch anstatt dass die Ängste verflogen, bekam ich ein neues Symptom hinzu. Eine Kommilitonin erzählte mir von der Idee, so viel zu essen, wie man Lust hat, sich anschließend auf der Toilette den Finger in den Hals zu stecken und alles wieder auszuspucken, damit man nicht dicker wird.
Dieses Gespräch ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Laufend musste ich daran denken, wie das ist, ganz viel zu essen und hinterher alles wieder auszuspucken.
Und dann kam der Tag, ich war allein zu Hause, meine Gedanken kreisten pausenlos unruhig um dieses Thema, wurden schnell und schneller, mir sauste das Hirn. Händeringend lief ich im Flur auf und ab, nicht in der Lage mich zum Stillstand zu bringen. Innerer wie äußerer Amoklauf. Unaufhaltsam stieg die Lautstärke im Kopf an, bis ich es nicht mehr ertrug und abrupt stehenblieb. Ich hatte mich entschieden. Nichts konnte mich mehr halten. Der Moment war gekommen, ich probierte es aus und blieb daran hängen wie ein Fisch an der Angel.
Ein Zwang entwickelte sich, eine Sucht, die mich in ihrem Teufelskreis gefangen hielt, sogar einen Namen hat. Bulimie. Niemand durfte davon erfahren.
Gezwungenermaßen führte ich ein Doppelleben. Ich schämte mich vor mir selber. Mit Vernunft und Verstand war da nichts zu machen. Immer wieder packte mich diese dunkle Unruhe, bis die Gedanken so schnell rasten, dass ich es einfach tat, damit wieder Ruhe im Kopf ist.
Frühkindliche Störung lautete die Diagnose! Ich führte alles auf meine Adoption zurück, weil meine Mutter mich am Tag meiner Geburt verlassen hat. Ein irreparabler Schaden. Auf ewig geprägt schien es mein Schicksal, mich durchs Leben zu quälen, scheinbar verrückt zu sein.
Beim innersten Eingemachten hört die Kompetenz der Psychologie offenbar auf. Was für eine Erkenntnis!
Die Ängste und die Bulimie waren nur Symptome. Aber für was genau? Welche Ursachen verbargen sich dahinter? War es überhaupt möglich, dass es für mich Heilung gab? Wie sollte sie aussehen, auf welcher Ebene sollte sie stattfinden?
Als ein Schamane mir später einmal sagte: „Du bist nicht nur Kind deiner Eltern. Du bist auch Kind von etwas Drittem, Kind einer höheren Macht. Deine Eltern kommen auch daher“, löste das Tränen der Erleichterung aus. Nun war ich nicht mehr eine einzelne, zusammenhanglose Schneeflocke, sondern kam dort her, wo alle herkamen. Aus der Kraft, die uns beatmet, die jegliches Leben hervorbringt, die dafür sorgt, dass der Mond nicht vom Himmel fällt und die Sonne jeden Morgen aufgeht. Plötzlich fühlte ich mich nicht mehr einsam, sondern verbunden mit allem.
Verbundenheit war von jeher mein innigster Wunsch gewesen, ohne den Begriff dafür gehabt zu haben.
„Jeder Mensch ist verbunden, sonst würde er nicht atmen. Das, was uns beatmet, ist das, wo wir herkommen“, offenbarte der Schamane.
Dieses Wissen ist nicht neu, und es mit dem Verstand nachzuvollziehen vielleicht nicht schwierig. Wenn aber mein Bewusstsein nicht davon durchdrungen ist, nützt mir das Wissen nichts.