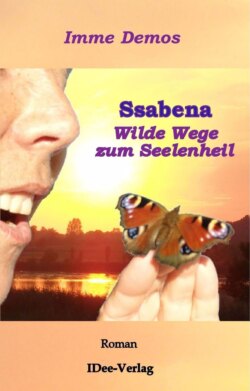Читать книгу Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil - Imme Demos - Страница 8
Sinneswandel
ОглавлениеIch hatte das Herumstreunen satt, fühlte mich einsam, sehnte mich nach Vertrautheit, nach Familienleben mit festem Freundeskreis, nach dem Gefühl von Sicherheit. Mittlerweile kannte ich eine Menge Leute hier, hatte auch zu einigen engere Verbindung, aber eben keinen Partner. Ich wünschte mir einen israelischen Mann, durch den ich reinwachsen würde in diese Gesellschaft, anwachsen an die israelische Denke und Mentalität, einer von dieser großen Sippe werden und daraus Stabilität beziehen. Die Juden sind nicht nur so stark wegen ihres Glaubens, sondern vor allem wegen ihres Gefühls von Zusammengehörigkeit. Einheit macht stark. Ich möchte zu einer Einheit gehören.
Gefrustet ging ich in eine Diskothek, vielmehr in einen Privatclub von renommierten Stammgästen. Ich kam da nur rein, weil ich ich war, die deutsche Sängerin der Lichtband.
Dieser Abend nun sollte mein Leben verändern. Vergeblich suchte ich ein mir bekanntes Gesicht.
Auf dem Weg zum Ausgang wurde ich von einem Amerikaner aufgehalten. „Ich komme gerade aus Los Angeles. Nach fünf Jahren bin ich die erste Nacht wieder hier, komm, trink einen Tequila mit mir.“
Ich trank einen Tequila mit ihm, auch einen zweiten und einen dritten. Seine vier Freunde kamen hinzu. Einer von ihnen war Mexikaner. Sie hatten die Reise gemeinsam angetreten. Gentlemanlike ließen wir uns volllaufen. Gegen Morgen verlor ich das Bewusstsein, erinnerte mich noch, dass ich mit den Fünfen in einen Mercedes gestiegen bin, dann wurde es dunkel um mich.
Ich erwachte in einem Raum, nicht wissend, wo ich bin, lag auf einem Bett, die fünf Männer um mich herum. Allesamt hatten sie ihre Hosen heruntergelassen, spielten mit ihren Gliedern und geilten mich an. Träumte oder wachte ich? Dann begriff ich. Schlagartig klar richtete ich mich auf und sagte entschieden, ich möchte bitte sofort nach Hause und sie sollten sich unterstehen, mich anzurühren. Sie lachten und machten sich daran, mir die Hose auszuziehen. Nur der Mexikaner blieb cool. „Lasst sie in Ruhe!“ sagte er und packte den einen am Arm. Aber schon hatten die anderen meine Unterhose zerrissen. Wild wehrte ich mich, strampelte mit den Beinen.
Der Mexikaner zog sie von mir ab. Gemeinsam schafften wir es, die Kerle zu beruhigen. Am Ende entschuldigte sich der eine sogar bei mir und bat sich aus, mich mit seinem Mercedes nach Hause fahren zu dürfen. Es wäre nur ein Witz gewesen. Sehr witzig.
Wie konnte ich nur in eine derartige Situation geraten? Endlos erschrocken über meine Leichtfertigkeit beschloss ich in derselben Nacht, nach Deutschland zu fliegen und mir ein Auto hier herzuholen. Nie wieder werde ich mit irgendjemandem mitgehen oder mitfahren, nie wieder wird irgendwer mich nach Hause bringen, nur noch ich mich selbst.
Ich war bereit mich abzunabeln.
Am folgenden Tag ging ich zu Zvika, um mit ihm darüber zu sprechen, was in der vergangenen Nacht geschehen ist und zu welchem Schluss ich gekommen bin.
Bevor ich ihm von meinem Erlebnis berichten konnte, erzählte er: „Gestern sind fünf Freunde von mir aus Amerika hier angekommen. Ich habe sie ein paar Jahre nicht gesehen. Ich kenne sie aus meiner Zeit in Los Angeles und den einen aus Mexiko. Das sind verrückte Kerls. Sie haben mich vorhin gerade aus ihrem Hotel angerufen. Nach dem langen Flug haben sie sich die Hucke voll gesoffen und sich mit einem Mädchen vergnügt. Sie haben sich einen Männerspaß gemacht.“
Ich befürchtete, mit seinen Freunden bereits Bekanntschaft gemacht zu haben. Wie peinlich! Zvika wusste nicht, dass ich dieses Mädchen war, er musste es auch nicht wissen. Aber ich hielt das Gefühl nicht aus, so etwas erlebt zu haben, diese Spannung in mir, ich musste es ihm erzählen. Mit hochrotem Kopf, voller Scham gestand ich. „Zvika, dieses Mädchen war ich.“
Jäh riss er den Kopf herum, schaute mich ungläubig an. „No, das kann nicht sein. Marlisa. Du? Das warst du? Tssss -- .“ Er schüttelte sein Haupt. „Weißt du“, begann er entschuldigend, „sie sind nicht schlecht. Ich kenne sie. Sie haben gestern einfach mit geballter Manneskraft über die Stränge geschlagen. Nur mit einem dummen Mädchen kann man so etwas machen. Aber doch nicht mit dir.“
„Zvika, ich werde nach Deutschland fliegen, mir ein Auto kaufen und damit hier herfahren. Das habe ich mir überlegt, das will ich machen. Dann braucht mich niemand nach Hause zu bringen. Ich bin unabhängig und treibe mich nicht mehr so viel herum. Das fühlt sich gestandener an, häuslicher.“
„Mach das!“
Gesagt, getan.
Nach neun Monaten Israel, Wüste und glühender Sonne kam mir Deutschland öde vor, einsam und leblos.
Neben der Freude, Familie und Freunde wiederzusehen, nahm ich statt alter Vertrautheit etwas Neues in mir wahr. Mein erweiterter Horizont hatte meinen Blick auf die Welt verändert.
Das Auto fand ich sofort, ein weißer Kombi mit schwarzen Ledersitzen. Für die hinteren Fenster nähte ich Vorhänge, falls ich in dem Wagen einmal schlafen sollte.
Zwei Wochen später packte ich meine Nähmaschine und mein Saxophon in den Kofferraum und verabschiedete mich von meiner Mutter mit den Worten: „Ich fahre wieder nach Hause.“
Ja! Elat war nun mein Zuhause. Ich freute mich riesig darauf, hatte Sehnsucht nach meinem Leben in Israel. Ohne Straßenatlas fuhr ich los, immer der Sonne nach.
Im Hafen von Venedig lernte ich Zachi kennen, Zacharias, Israeli, lebte in Deutschland und arbeitete in der Firma seines Schwiegervaters. Der Mann faszinierte mich. Wie konnte man freiwillig in Deutschland leben, wenn man die Wahl hat, in Israel zu leben? Ich interviewte ihn, er gab bereitwillig Auskunft.
„Weißt du, ich kenne die ganzen Vorzüge, die Israel hat, das schöne Leben, die Leichtigkeit der Menschen. Es stimmt, in Israel hat der Alltag etwas sehr Besonderes, das findest du nirgends auf der ganzen Welt. Aber ich sehe auch die Nachteile, die Armee zum Beispiel. Ich will nicht in die Armee, ich will nicht kämpfen. In Israel weißt du nie, wann der nächste Krieg ausbricht. Ich will Familie haben, Kinder. Mit denen würde ich niemals in Israel leben. Deutschland ist zwar düster und schwerfällig, aber irgendwie auch einfach. Da geht alles nach Plan, und die Deutschen halten sich auch daran. Es ist nicht so unruhig. Du hast deine Arbeit und alles ist friedlich. Die Deutschen sind lieb, naiv und ordentlich, nicht so laut und ungestüm wie die Israelis. Nein wirklich, Deutschland hat auch seine Vorteile.“
Gemeinsam reisten wir weiter. Er kannte die Strecke. In Griechenland wechselten wir die Fähre, um das Mittelmeer zu überqueren. Täglich machten wir Halt auf einer Insel, Kreta, Rhodos, Zypern. Jeden Tag wurde die Luft fühlbar wärmer. Am siebten Tag erreichten wir den Hafen von Haifa. Die Zollabwicklungen erledigt, fuhren wir nach Israel rein, ich hinter ihm her. In Tel Aviv verabschiedeten wir uns. Er wollte mich in Elat besuchen kommen.
Die letzten fünf Stunden fuhr ich alleine weiter, einmal senkrecht von Norden nach Süden durch das Land. Was war ich stolz, mit meinem eigenen Auto durch mein Israel zu fahren. Als ich das Radio einschaltete, begrüßte mich der Sprecher: ,Shalom kol Israel’, Frieden ganz Israel. Mein Herz schwoll an vor lauter euphorischer Ergriffenheit. Ich hatte es geschafft, zumindest bis hierher. Ich war so dankbar und glücklich über das Gefühl, wieder zu Hause zu sein.
Ein paar Tage später kam Raven zu mir. „Ich werde nach Griechenland gehen, ich war lange genug hier, ich will mir noch andere Teile der Welt ansehen, vielleicht komme ich später noch einmal zurück. Du kannst die Wohnung behalten. Hier sind die Papiere. Miete überweist du auf dieses Konto, hundert Dollar pro Monat. Das ist die Bankrate für die Abzahlung der Wohnung. Miete an sich hat er nicht genommen. Dafür sollte ich die Wohnung in Ordnung halten. Und das hier ist die Stromabrechnung, alles in Hebräisch, kann ich auch nicht lesen, aber ich habe mir gemerkt, was ich machen muss. Wenn du immer pünktlich überweist, wirst du keine Schwierigkeiten haben. Wenn die Gasflaschen leer sind, musst du anrufen, sie bringen dir neue.“
„Ich habe kein Telefon.“
„Dann geh bei ihnen vorbei. Das ist dieser kleine Laden hinter Ya’alderoma, weißt du?“
„So ungefähr, ich werde es schon finden. Wem gehört die Wohnung eigentlich?“
„Einem jungen Israeli namens Dror. Sein Vater hat sie für ihn gekauft. Sie waren neue Einwanderer und haben die Wohnung vom Staat günstig bekommen. Dror ist jetzt schon über ein Jahr in Thailand, keine Ahnung, wann er zurückkommt. Er hat nicht ein Mal geschrieben. Vielleicht bleibt er dort. Er wollte für ungefähr ein Jahr reisen. Falls er kommt, bestelle ihm einen schönen Gruß von mir. Viel Spaß noch hier. Bye!“
Nun hatte ich ein Auto, eine Wohnung und war auf bestem Wege, genauso zivilisiert zu leben wie damals in Deutschland. Nur ein Telefon fehlte noch. Im Moment brauchte ich nicht wirklich eins. Unerreichbar sein hat auch etwas Befreiendes an sich. Nichts Unangenehmes konnte auf diesem Weg zu mir ins Haus dringen. Geschützt wie im Mutterleib.
Das Auto führte zu einer enormen Steigerung meiner Lebensqualität. Ich fuhr, wann und wohin ich wollte, zu abgelegenen Stränden, in die Wüste hinein, zu Freunden, zur Arbeit.
Ich hatte es gut, ich hatte es wirklich gut, - - - und doch konnte ich nicht normal essen. W A R U M ? Was brauchte ich denn noch? Was gab es denn überhaupt noch zu brauchen?
Der englische Barmann Mike sprach mich an: „Ich habe gehört, du hast ein Zimmer frei, kann ich mich bei dir einmieten? Ich muss da raus, wo ich jetzt bin.“
Die Situation kenne ich. Vor kurzem erging es mir ebenso. Jetzt hatte ich nicht nur ein Apartment, sondern zusätzlich Ravens Zimmer mit dem großen Doppelbett, eingebautem Kleiderschrank und dem kleinen Nachttisch. Ich benutzte es nie, betrat es nicht einmal. Ein Israeli würde daraus Geld machen. Ich verdiente genug, das war es nicht. Ich wollte einfach erfahren, wie es ist, ein Zimmer zu vermieten, bin noch nie Zimmervermieterin gewesen.
„Ich komme auch nur zum Schlafen!“, fügte er aus großen Kulleraugen lächelnd hinzu. Mike war ein großer kleiner Junge mit lockigem Haar, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, Ausländer und Nicht-Jude wie ich. Fühlte sich europäisch an, familiär.
„Okay, für fünfzig Dollar im Monat kannst du das Zimmer haben. Wie lange willst du bleiben?“
„Das hängt davon ab, wann du mich rausschmeißt“, grinste er.
Er kam, war kaum zu Haus, ich bekam ihn tagelang nicht zu Gesicht. Er zahlte seine Miete nicht, stattdessen pumpte er mich um Geld an. Wenn er da war, ließ er seine Sachen überall liegen. Ich hatte einen Fehler gemacht. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ich wollte ihn wieder loswerden.
„Mike, wenn du was anderes zum Wohnen finden könntest, wäre das prima.“
„Jaja, ich habe schon etwas an der Hand, ich muss nur noch mit dem Mann reden.“
Ein Monat verging.
„Mike, wie sieht’s aus?“
„Ja, ich hab schon was, ich muss das nur noch abklären, der Typ ist immer nicht da. Sobald es fest ist, lass ich es dich wissen.“ Dann war er wieder für ein paar Tage verschwunden.
Als ich vom Strand zurückkehrte, entdeckte ich beim Aussteigen, dass mein Küchenfenster offen stand. Ich hätte schwören können, es war geschlossen, bevor ich ging. Zwei Stufen auf einmal nehmend hastete ich die Treppe hoch, schloss auf und trat ein. Verwundert sah ich einen Mann auf meinem Sofa sitzen, klein, drahtig, aus schmalen Augen schaute er mich an.
„Wer bist du?“, fragte ich ihn.
„Ich bin Ilan und du?“
„Ich bin Marlisa. Was machst du hier?“
„Ich will zu Mike. Man sagte mir, dass er hier wohnt. Ist das richtig?“
„Er ist mal hier und mal nicht hier, seine Sachen sind hier. Ich weiß nicht, wann er kommt. Wie bist du hereingekommen?“
„Durch das Küchenfenster.“
„Es war zu. Wie hast du es aufgemacht?“
„So!“, er machte eine geheimnisvolle, hebelartige Bewegung und guckte wie ein Zauberer.
„Warum hast du nicht vor der Tür gewartet?“
„Ich wollte eben rein.“
„Woher kommst du?“
„Aus dem Gefängnis.“
„Wie aus dem Gefängnis …?“
„Ja, wirklich, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Heute ist mein erster freier Tag. Ich fühle mich wie neugeboren“, er strahlte übers ganze Gesicht.
„Wie lange warst du drin?“
„Ein Jahr --- viel Zeit.“
„Was hast du denn verbrochen?“
„Ist nicht wichtig“, abwehrend hob er seine Hände, drehte das Gesicht beiseite. „Keine Angst. Ich habe niemanden umgebracht oder vergewaltigt. Ich bin okay.“
Er sah extrem konzentriert aus. Sein Körper bestand aus geballten Muskelpaketen. „Wieso hast du solche Muskeln?“
„Willst mal anfassen?“ Stolz hob er einen Arm in die Luft.
Ich ging zu ihm und fasste einen der vorstehenden Muskelstränge an. „Boah, die sind ja hart wie Stein.“
Er zog seine Hosenbeine hoch, streckte mir seine Wade hin. „Schau hier! Die Beine auch. Ich habe alle möglichen Muskeln trainiert. Weißt du, wenn du so lange in einer Zelle hockst, dann musst du dir schon was einfallen lassen, um nicht verrückt zu werden. Ich habe Sport gemacht. Jeden Tag habe ich stundenlang Liegestütze und so Sachen gemacht, was man eben in einem kleinen Raum machen kann. Du kannst jeder Zeit mit deinem Körper spielen, verschiedene Muskeln anspannen, auch im Sitzen, auch im Liegen, anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Ich musste mich einfach beschäftigen, sonst wäre ich durchgedreht. Jetzt bin ich topfit, mein Körper und mein Geist.“
„Willst du einen Kaffee?“
„Nein danke, ich muss jetzt los. Ich komme ein anderes Mal wieder.“
„Dann wartest du aber bitte, bis ich komme und gehst durch die Tür.“
„Mach ich. Lehitra’ot, bye.“
Ich beschloss, Tel Aviv zu erkunden.
Eine einsame Straße, die Arawa, führte von Elat etwa zweihundert Kilometer schnurgeradeaus Richtung Norden. Die Wüste berauschte mich nach wie vor. Ich konnte es kaum fassen, ich durchquerte tatsächlich mit meinem eigenen Auto den Negev, fuhr wie in Trance, befreit von allem. Konnte ich mich denn nur in der Wüste frei fühlen?
Als sich die Straße teilte, trieb es mich spontan rechts ab Richtung Totes Meer. Mal sehen, was es damit auf sich hat.
Auf dem Vorplatz parkte nur ein einziges Auto. Im Wagen zog ich mich um, stieg im Bikini aus und ging hinunter ans Wasser. Das Tote Meer breitete sich ruhig vor mir aus. Die andere Uferseite, nicht weit entfernt, gehört Jordanien. Etwas war hier anders als sonst. Der Sound. Von dem Pärchen, das sich weit hinten leise unterhielt, konnte ich jedes Wort vernehmen. Die Stimmen waren unglaublich präsent. Diesen Effekt kenne ich aus Musikstudios, wo man die Präsenz einer Stimme hervorheben kann. Live habe ich das noch nie gehört. Die Welt klingt hier anders als überall woanders. Wir befinden uns in einem Tal am Wasser unterhalb des Meeres-spiegels. Das Tote Meer ist der tiefste Punkt der Erde.
Ehrfürchtig machte ich einen Schritt ins Wasser. Warm. Langsam ging ich vorwärts. Als das Wasser bis unterhalb meiner Knie stieg, konnte ich nicht mehr weitergehen. Trotz meines Körpergewichts wollte das Wasser meine Füße nicht bis auf den Grund lassen. Der hohe Salzgehalt gab dem Körper Auftrieb. Ich strengte mich richtig an, um vorwärts zu kommen, doch das Wasser drängte die Beine wieder an die Wasseroberfläche, sodass ich schließlich hinfiel. Nun lag ich. Der Bauch hing nach unten, Hände und Füße ragten aus dem Wasser. Den Kopf hielt ich hoch. Je tiefer ich meine Hände unter Wasser tauchte, umso mehr Auftrieb bekamen meine Ellenbogen. Drückte ich meine Füße unter Wasser, kam mein Po hoch. Der ganze Körper ist nicht unter Wasser zu kriegen, nur einzelne Teile. Schwimmen unmöglich, so sehr ich es auch probierte, keine Chance. Aber ich konnte meinen Körper zum Wackeln bringen, schaukelte so lange hin und her, bis ich mich mit einem Schwung drehte und schwupp – lag ich auf dem Rücken wie ein Käfer, Po nach unten, Hände und Füße über Wasser. Ich kicherte vor mich hin. Das war ja nicht zu glauben. Die Gesetze der Schwerkraft schienen hier aufgehoben. Ich befand mich zwar nahe am Ufer, aber wie sollte ich denn da hinkommen? Sich einfach hinstellen und aus dem Wasser rauslaufen, daran war überhaupt nicht zu denken, obwohl es hier so flach war, dass ich locker hätte stehen können. Selbst der stärkste Mann könnte sich hier nicht hinstellen. Man bekommt sozusagen kein Bein an den Boden. Lachend wackelte und schunkelte ich mich irgendwie so weit, dass ich mit einer Hand den Boden unter mir berühren konnte. Dafür stemmte sich der Bauch aus dem Wasser, aber immerhin konnte ich mich auf diese Weise dicht genug an den Strand ziehen, um mich hinstellen und rausgehen zu können. Schnurstracks begab ich mich zu dem kleinen Kiosk.
Schmunzelnd hatte der Verkäufer mich beobachtet.
„Gib mir ein Bier, bitte.“
Wortlos reichte er mir die Dose.
Sogleich war ich mit meinem Getränk wieder im Meer. Auf dem Wasser liegend, die Bierdose in der Hand, die sengende Sonne über mir, genoss ich diesen außergewöhnlichen Zustand.
„Dieses ist mein letztes Bier!“, sagte ich laut. Im Stillen gab ich mir selbst das Versprechen, künftig auf Alkohol vollkommen zu verzichten, machte ein kleines, inneres Ritual daraus. Anschließend stieß ich feierlich mit mir selber an und kam darüber zu meinem größten Wunsch. Leise betete ich: „Lieber Gott, bitte mach, dass ich ganz normal essen kann wie die anderen Menschen. Ich werde dir für immer dankbar sein und dich auch um nichts mehr bitten, lass mich nur normal essen können.“ Die Augen geschlossen, schickte ich diese Bitte ins Universum.
Fast eine halbe Stunde lang wusch ich mir unter der Dusche gründlich das Salz vom Körper. Meine alte, abgeschuppte Haut wurde weggespült.
Wie neugeboren stieg ich in mein Auto und fuhr geradewegs in die Hauptstadt Israels, Tel Aviv.
In einer Seitenstraße fand ich eine Bleibe, eine moderne Jugendherberge nahe der Haupteinkaufstraße Dizengoff. Auf dem Hof konnte ich mein Auto abstellen und von hier aus die Stadt zu Fuß abmarschieren.
Ein neues Gefühl zu mir und meinem Leben stellte sich ein, ich nahm mich und die Welt anders wahr, als wäre ich durch die Waschung und das Ritual im Toten Meer dichter an mich selbst herangerückt, als wäre ein Vorhang weggefallen, als könne ich klarer sehen. Ich schwang in einer anderen Grundfrequenz, war höher gestimmt.
In einer kleinen Boutique fand ich passende Kleidung für mich, zwei schwingende Röcke und drei Blusen. Mittlerweile war ich so dünn geworden, meiner Meinung nach konnte ich es mir jetzt leisten, eng anliegende Sachen zu tragen. Eleganter, weiblicher Look, das gefiel mir. Mein hartes Schwarz-Weiß-Rot verwandelte sich in weiche Pastelltöne. Ich wollte einfach nur schön sein wie die vielen verheirateten Israelinnen, nicht mehr einsamer Paradiesvogel. Unbewusst trieb mich die Sehnsucht nach meiner eigenen Weiblichkeit.
Aufgrund meiner inneren wie äußeren Wandlung änderten sich meine Einladungen.
Zu Pessach wurde ich offiziell von Isaaks Familie eingeladen. Sie wollten mich deutsche Nichtjüdin teilhaben lassen an ihrem religiösen Fest. Eine hohe Ehre für mich.
Isaaks betagte Eltern begrüßten mich herzlich, aber nicht überschwänglich, und geleiteten mich an die feierlich gedeckte Tafel. Alle setzten sich, auch Isaaks jüngere Schwester, die mir mit offenem Herzen begegnete. Die Kerzen leuchteten. Eine Zeremonie begann. Der Vater sang hebräische Worte und klang wie alle Pastoren, wenn sie Liturgien singen, unabhängig von der Sprache. Vor ihm kleine Tellerchen mit verschiedenen Kräutern. Während des Gesangs, nahm er einige Blätter von dem ersten Kraut zwischen zwei Fingerspitzen, um sie danach wieder zurückzulegen. Erneut erhob er die Stimme, griff bedächtig nach dem zweiten Kraut, hielt es in der Luft, besang es und legte es zurück in das Schälchen. Gleichermaßen verfuhr er mit den anderen Kräutern. Zu gerne hätte ich die Worte verstanden.
Isaak öffnete seine Thora, die Bibel der Juden, und begann daraus vorzulesen. Zwischendurch sang er einige Verse. Ich staunte über den langhaarigen, verwegenen Isaak, der jetzt fein angezogen wie ein braver Junge mit klarer Stimme Kirchenlieder sang. Thema war das jüdische Volk, das auserwählte, ihre Geschichte und ihr Glaube. In der Religion löst sich Persönlichkeit offenbar auf.
Die nächste Einladung, vom Besitzer des Einkaufszentrums, führte mich an einem Schabbat in die Synagoge. Schon auf dem Vorplatz des kleinen Gebäudes machte sich, wie bei allen Gotteshäusern dieser Welt, eine gewisse Ehrfurcht breit. Festlich gekleidete Menschen in der Morgensonne, leise spielende Kinder. Hin und wieder kamen Gläubige heraus oder gingen hinein.
Ich betrat die Synagoge durch den mir zugewiesenen Eingang und befand mich im hinteren Abteil für die Frauen. Ein schleierartiger Vorhang fiel von der Decke herab bis zum Boden, teilte den Raum in zwei Hälften. Dahinter durchscheinend sah ich die Reihen betender Männer, die sich gemeinsam verbeugten. Vorne sprach und sang der Rabbi. Seine Stimme drang durch den Schleier. Die Atmosphäre war von religiöser Tiefe getränkt, wie es bei solchen Zeremonien der Fall ist. Heilig, aber irgendwie auch schwer. Das merkte ich, als ich wieder hinaustrat ins Freie, in den Sonnenschein. Ich bedankte mich für die Einladung und fuhr wieder nach Hause, in meinen eigenen Tempel.
Zuhause verbrachte ich jetzt mehr Zeit als früher. Salomon besuchte mich fast jeden Tag. Rituell rauchten wir zur Begrüßung, tranken Tee und palaverten. Das gab mir Ruhe. Wenn er wieder ging, konnte ich gut mit mir alleine bleiben.
Ich begann zu malen. Seit meiner Kindheit hatte ich nicht mehr gemalt und doch immer Sehnsucht danach gehabt. Erstaunliche Bilder brachte ich hervor, wuchs über mich selbst hinaus, erlebte, dass eine Malerin in mir steckte. Auch das Schreiben fing ich an. Dinge, die mich bewegten, drückte ich auf Papier aus. Die Nähmaschine inspirierte mich, wunderschöne Kleider und Röcke zu nähen. Meine Kreativität kannte keine Grenzen.
Meist zu fasziniert von meiner Beschäftigung, dachte ich nicht an Essen. Doch gelegentlich brach der alte Zwang durch. Dann fuhr ich zum nächsten Laden, deckte mich ein mit Keksen und anderen Leckereien und machte zu Hause ein Festessen daraus. Anschließend spuckte ich alles wieder aus. Ich beachtete diesen Zwang so wenig wie möglich. Der Vorgang spielte sich routinemäßig ab und hinterher dachte ich auch nicht weiter darüber nach. Wie eine unangenehme Pflicht, die man absolviert ohne große Emotionen. Danach konnte ich wieder machen, was ich wollte.
Ich fühlte mich auf dem Höhepunkt meiner Entwicklung. Endlich lebte ich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich war so gut wie angstfrei. Ich sah so aus, dass ich mich wohl fühlte in meinem Körper, so mager, wie ich immer sein wollte. Ich trug die Kleidung, die mir am besten stand. Hatte die angenehmste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Lebte in der sonnigsten, schönsten und günstigsten Wohnung von Elat, dem besten Platz der Welt. War unabhängig, konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich war so sehr eins mit mir selber und meinem Leben wie nie zuvor, hatte an mir gearbeitet und meine Möglichkeiten voll ausgeschöpft.
Ich fühlte mich reif für eine weitere Veränderung.
Nur der Richtige konnte meinen Zustand noch toppen.