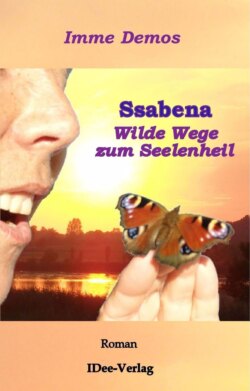Читать книгу Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil - Imme Demos - Страница 6
Einzug ins gelobte Land
ОглавлениеWir schrieben das Jahr 1988. Es war Januar. Winter in Deutschland. Nass. Kalt. Grau.
Eine freie Woche lag vor mir ohne Auftritte oder Studiotermine. Die Sehnsucht nach Wärme lockte mich ins Reisebüro. Verschiedene Last-Minute-Angebote standen zur Auswahl, Portugal/Algarve, Griechenland/Kreta, Kanarische Inseln, Israel/Tel Aviv – stopp! Wo liegt das eigentlich genau? In Vorderasien. Da müsste es orientalisch zugehen, das reizte mich. Ich buchte und ging nach Hause meinen Rucksack packen.
Am nächsten Nachmittag fand ich mich in Tel Aviv wieder. Hier sah es genauso westlich aus wie in Europa. Die Menschen trugen Blue Jeans, Kopfhörer im Ohr, kauten Kaugummi, der Verkehr lärmte wie in jeder Großstadt. Ohne Umschweife fragte ich den nächst besten Israeli, wo denn etwas Altes, Verschleiertes zu finden sei.
„Go to Jerusalem“, war die Antwort.
Am Kiosk holte ich mir einen Stadtplan. Tel Aviv sah darauf so klein aus, als könne man es zu Fuß durchqueren. Vergnügt spazierte ich zur Central Bus Station und setzte mich in den Bus nach Jerusalem. Von meinem Fensterplatz aus beobachtete ich die Szenerie. Gegenüber wartete ein Grüngekleideter mit einer Angelrute in der Hand. Seltsam, laut Plan ist kein See in der Nähe.
An unserer ersten Haltestelle entdeckte ich wieder jemanden mit Angelrute. Der Bus hielt, der Grüne stieg ein. Jetzt erkannte ich es: Die Angelrute war gar keine Angelrute, sondern ein Gewehr. Die Waffe im Arm setzte sich der Soldat neben mich. Der Lauf zeigte auf meine Rippen. Schon etwas befremdlich. Auf der anderen Straßenseite erblickte ich eine Familie. Der Mann trug die Einkaufstasche, Sohn an der Hand, Frau schloss gerade die Haustür auf, in Soldatenuniform gekleidet, ein Maschinengewehr über ihrem Rücken. Aha. Alltag in einem bedrohten Land. Ein gewöhnungsbedürftiger Anblick.
„Where you go?“, sprach der Soldat mich unvermittelt an. Das war zwar kein korrektes Schul-Englisch, aber ich verstand ihn ja.
„Ich suche was Altes, Ursprüngliches, Echtes, Originales“, versuchte ich zu erklären.
Er riet mir in die Old City von Jerusalem zu gehen, die Altstadt. Dort gäbe es auch eine Jugendherberge.
Nach zwei Stunden Fahrt erreichten wir Jerusalem. Die Central Bus Station liegt in der New City. Ich erfragte meinen Weg vorbei an modernen Einkaufsläden zum mächtigen Jaffa-Gate, einem der vier Tore zur Altstadt, schritt hindurch und betrat eine andere Welt.
Kleine Gassen schlängelten sich durch das uralte Gemäuer, teilweise mit den alten Steinen bogenförmig überdacht. Die Mauern gingen eine in die nächste über. Vor kleinen, grün oder blau gestrichenen Haustüren tranken Araber ihren Tee, um die Köpfe die kennzeichnenden Arafat-Tücher. Einzigartige Atmosphäre, sehr intensiv. Meine Zellen begannen zu vibrieren. Diese uralten Steine erweckten den Eindruck, als sei hier eben noch Jesus entlang gegangen. Ich spürte förmlich seine Fußtritte auf dem Pflaster und hörte das leise Rauschen seines Gewandes an den Mauern vorbeistreifen. Ein Araberjunge kam mir entgegen. Auf dem Holzkarren, den er vor sich her schob, stapelten sich frisch gebackene Sesamküchlein, die vor Honig trieften und eine schmale, klebrige Spur auf dem Steinboden hinterließen. Ich konnte nicht widerstehen. Für einen Schekel kaufte ich ihm eins ab. Wie köstlich! Ja, dies war das Land, in dem Milch und Honig flossen.
Die verwinkelten Gassen, mal breiter, mal schmaler, bildeten an Kreuzungen kleine Plätze. Abbiegungen, enge Seitengässchen, führten manchmal weiter, endeten gelegentlich auch einfach vor einer Mauer. Schräg gegenüber öffnete sich eine pastellgrüne Holztür im Gestein. Eine schwarz gekleidete Frau mit einem Schleier vor Mund und Nase lugte hervor, blickte mich ungeniert eindringlich an. Kräftiger Kajal um die Augen betonte ihren stechenden Blick, der mir durch Mark und Bein fuhr. Blitzartig drehte ich um und schlenderte auf der Hauptgasse weiter.
Am nördlichen Ausgang der Old City gelangte ich wieder an ein großes Tor, das Damaskus-Gate. Ein älterer Araber hinter einem Holzstand verkaufte Postkarten an Neuankömmlinge. Ein Junge bot trockene Sesamringe an. Zwei Soldaten lehnten, ins Gespräch vertieft, an einem Torbogen im Schatten. Noch wollte ich die Altstadt nicht verlassen, machte kehrt. Außer mir, keine weiteren Touristen. Ich war allein mit ein paar Arabern, einigen Soldaten und Kindern, die durch die Gassen liefen oder kleine Köstlichkeiten feilboten. Vollkommen fasziniert verlor ich das Bewusstsein für die Zeit, fühlte mich zweitausend Jahre zurückversetzt.
Vor einem Hauseingang parkte ein Teewagen mit dem größten, silbern glänzenden Samowar, den ich je gesehen habe. Kein Mensch in der Nähe, die Haustür geöffnet, versuchte ich im Vorbeigehen einen Blick ins Innere des Hauses zu erhaschen, aber es war zu dunkel drinnen. Meine Augen, eingestellt auf die grelle Sonne, konnten nichts erkennen. Unauffällig ging ich weiter.
In einer Nische stand eine Gruppe von Soldaten. Sie riefen mir was Hebräisches zu, ich verstand kein Wort.
Die nächste Gasse lag größtenteils unter gewölbtem Steindach. Darunter war es dunkel und kühl. Ein betagter Araber saß allein neben einem gezimmerten Stand mit Arafat–Tüchern und handgemalten Bildchen von Old Jerusalem. Auf einem Tischchen wartete ein geöffnetes Backgammon Spiel. Gemächlich schlurfte ein zweiter Mann hinzu und setzte sich auf den wackeligen Holzstuhl. Wortlos begannen die beiden zu spielen.
Als ich um die letzte Ecke des langen Ganges bog, erstreckte sich vor mir ein großer Platz voller Menschen, begrenzt durch eine hohe Mauer mit einer Absperrung davor. Nur wer jüdischen Glaubens war, durfte hinter die Absperrung, die die Fläche in eine rechte und eine linke Hälfte aufteilte. Links ausschließlich Männer, die dicht vor der Mauer ihre Köpfe hoben und senkten, dabei murmelten oder sangen, rechts die Frauen, die dasselbe taten. Ich befand mich an der berühmten Klagemauer.
Auf der Seite der Männer führte ein Tor in das Innere des Steinpalastes. Das Tor stand offen, aber drinnen war es dunkel, ich konnte nichts erkennen und hatte auch keine Idee, was sich Geheimnisvolles dahinter abspielen könnte.
Alle anwesenden Männer trugen eine Kipa auf dem Hinterkopf, diese halbe Mütze, die von einer Haarnadel gehalten wird. Nur die Gestalten in schwarzen Anzügen mit langem Gehrock bedeckten ihr Haupt mit hohen Hüten, unter denen zu beiden Seiten des Gesichts Schillerlocken herabhingen. Ihre schwarz umrandeten Brillen mit den extrem dicken Gläsern sprangen ins Auge. Das kam wohl vom vielen Thora Lesen, so heißt das hebräische Haupt-Gebetsbuch. In der jüdischen Religion gibt es mehrere Bücher.
Die Menschen vor der Absperrung waren nicht zum Beten hergekommen, sie warteten auf die Betenden.
Auf der anderen Seite des Platzes führten breite Treppenstufen hoch zu einem Wachhäuschen für israelische Soldaten. Tag und Nacht hielten sie Wache, um eventuellen Aufruhr zwischen Juden und Arabern sofort einzudämmen. Von dort oben hatten sie den gesamten Platz im Überblick.
Hinter der Klagemauer erhob sich die in der Sonne glänzende, goldene Kuppel des Felsendoms, der Al-Aqsa-Moschee, eines der ältesten Heiligtümer des Islam. Von hier aus soll Mohammed, der islamischen Tradition nach, die Himmelfahrt angetreten haben und seine Begegnungen mit den früheren Propheten des Judentums, auch mit Jesus.
Ich setzte mich auf eine der Stufen, sah dem Schauspiel zu und sog den Klang ein.
Stundenlang bewegte ich mich nicht von der Stelle. Die Altstadt von Jerusalem war ein ganz besonderer Platz, Brennpunkt großer Weltreligionen, die auf diesem Planeten vorherrschen. Juden wie Moslems sehen sie als Hauptsitz ihrer Glaubensrichtung an. Dafür kämpfen sie, opfern ihre Kinder, ihre Großmütter, ja sich selbst.
Ist euer Gott denn so klein, frage ich, dass er eine Stadt braucht? Gott ist doch größer als die ganze Welt. Ist unter dem Begriff Gott nicht die Energie zu verstehen, die alles Leben und diesen Planeten erschaffen hat? Ist es nicht lächerlich, zu meinen, dieser mächtigen Kraft müsse man einen Sitz zuordnen? Welcher sollte denn passend für sie sein? Ist nicht jeder Platz, den Menschen sich ausdenken, zu klein und nicht an der richtigen Stelle? Oder umgekehrt: Ist Gott nicht überall, allgegenwärtig und in jedem Haus zu Hause? Ist nicht jeder Platz, jeder beliebige Punkt der Schöpfung, der rechte Ort?
Als die Dunkelheit hereinbrach, ging ich nach oben. Die Soldaten im Wachhäuschen interessierten sich für mich und ich mich für sie. Einige von ihnen sprachen englisch.
Der erste hieß Moshe, zu deutsch Moses. Den nächsten nannten sie Avi, Kurzform von Avraham, zu deutsch Abraham. Der dritte wurde Jossi gerufen, israelischer Spitzname für Josef, der vierte war David, wie der gleichnamige König, der einst in diesem Tempel herrschte, dessen letzte Grundmauer die Klagemauer ist.
Ich war mir nicht sicher, ob sie sich einen Scherz mit mir erlaubten. Die hießen ja immer noch alle wie vor zweitausend Jahren. War bei denen die Zeit stehengeblieben?
Sie erzählten mir von Moses, vom Stammvater Abraham und von den anderen Figuren, die ich aus der Bibel kannte. Das Witzige war, sie sprachen von diesen Menschen so wie ich von meinem Onkel oder von meinem Urgroßvater. Für sie ist die Bibel nicht ein Buch über eine andere Zeit, nein, es ist das Buch ihrer Vorfahren, ihrer Historie. Sie fühlen ihre Verwandtschaft mit den biblischen, israelitischen Stämmen. Die Monumentalfilme, die uns im Westen zu Ostern und Weihnachten einen kleinen Einblick geben von dem, was sich damals in diesem Teil der Welt zugetragen hat, sind jedem Israeli präsent, als wäre es gestern gewesen. Ihre Geschichte beziehen sie mit in den Alltag ein. Jedes Jahr essen sie eine Woche lang ungesäuertes Brot, ähnlich unserem Knäckebrot, um sich an die Zeit ihrer vierzigjährigen Wüstenwanderung zu erinnern. Jährlich feiern sie Sukkot, das Laubhüttenfest, an dem jeder eine kleine Hütte aus Palmwedeln vor seinem Haus aufbaut, um sich daran zu erinnern, wie sie einst während der Wanderschaft in Laubhütten lebten. Bis heute lassen sie den letzten Bissen eines Mahls auf dem Teller liegen als Symbol: Für den nächsten, der an diesen Rastplatz kommt, ist noch Essen da. Man hat an den, der nach einem kommt, gedacht. Eine menschliche Geste, die ihren Zusammenhalt und ihre Sorge um- und füreinander zeigt. So gilt es in Israel als höflich, wenn du nicht alles aufisst, während es in Deutschland ein Lob an die Kochkunst der Hausfrau ist, wenn du deinen Teller ratzekahl leerputzt.
Die israelischen Kinder müssen ihre Geschichte nicht wie wir aus Büchern, von Lehrern oder Eltern erfahren, sie leben sie. Anhand der Feste wissen sie genau, was wann vorgefallen ist. Jedes Kind lernt die eigene Geschichte am Leben selbst, und alle identifizieren sich damit. Unsere deutsche Geschichte kenne ich, weil ich in der Schule Geschichtszahlen auswendig lernen musste und weil meine Eltern und Großeltern hin und wieder vom Krieg erzählten. Außer dass wir dankbar sein sollten, wie gut wir es heute haben, hatte ich zu der ganzen Angelegenheit keinen Bezug, weder zu Kaiser Wilhelm noch zu den Nationalsozialisten. Wenn von denen die Rede war, wurde es sowieso immer dubios. Die verschiedenen kleinen und großen deutschen Reiche hatten mit mir weiter nichts zu tun.
Durch den Schamanen erfuhr ich später von auswendig lernen und inwendig lernen. Die Israelis lernen inwendig. Jeder von ihnen trägt einen roten Faden in sich, anhand dessen er sein Leben, seine Vorgeschichte, seine Stammeszugehörigkeit bis an den Ursprung verfolgen kann. Das will ich auch! Beneidenswert. Ich kannte nicht einmal meine Eltern. Wünschte von ganzem Herzen, dass Gott mich hätte als Israeli zur Welt kommen lassen. Es muss sich wunderbar anfühlen, wenn du einen Ursprung hast, den du kennst und fühlst, und neben dir Menschen, denen es genauso geht.
Jedes Kind in Israel weiß, wo es weltpolitisch steht. Von Feinden umringt. Das wachste Volk, das ich jemals erlebt habe, alle ihre Antennen ständig ausgefahren. Geistige, soziale und genetische Verbundenheit untereinander, wie ich sie nirgendwo fand, einzigartig in ihrer Art. Eine einzige Großfamilie. Und Israel ist ihr Zuhause. Wie gern hätte ich zu ihnen gehört. Zudem betrachten sie ihr gesamtes Dasein als ein von Gott gesegnetes, sie stehen in permanenter Verbindung zu Gott, den sie Eloim nennen. Ich weiß, wir alle stehen in permanenter Verbindung zu dem, was uns geschaffen hat, allein durch unseren Atem, dazu muss man nicht Jude sein. Aber wie ihr Bewusstsein im alltäglichen Leben von der Anwesenheit des Schöpfers, egal, wie man ihn nennt, durchdrungen ist, wie lebensnah sie mit und durch Gott sind, beeindruckte mich zutiefst. Welche Kraft geht daraus hervor! Israelis erfinden Innovationen auf allen Gebieten, bringen Denker wie Einstein und ausgezeichnete Musiker hervor. Selbst wenn man nichts über sie weiß, spürt man es doch, wenn man im Land ist. Es ist das, was sie ausstrahlen, das, was in der Luft liegt, was du wahrnimmst, wenn du dich unter ihnen bewegst.
Die Verbundenheit dieser Menschen mit ihrem Land, ihrer Geschichte, mit Gott und mit sich selbst, zog mich als Suchende natürlich an wie sonst nichts. Anfangs wusste ich nicht, was mich zu ihnen hinzog, ihre Anziehungskraft fesselte mich nur maßlos.
Bis nach Mitternacht blieb ich bei den Soldaten, dann trat ich den Rückweg in die Jugendherberge am Jaffa-Gate an.
Am nächsten Tag durchkreuzte ich das christliche Viertel. Breitere Gassen, neuere Fassaden. Ich fand die Via Dolorosa, die Straße des Schmerzes, die Jesus seinen letzten Gang entlanggegangen ist, als er das Kreuz auf dem Rücken trug und die Dornenkrone auf dem Kopf. Im Nachhinein wurde zu seinen Ehren an dieser Stelle eine Kirche errichtet.
So langsam hörte die Bibel auf, für mich nur ein Buch mit einer unglaublichen Geschichte zu sein. Jesus Christus war für mich bislang ungefähr so real gewesen wie Ali Baba, aber mein Gefühl zu diesem Wesen änderte sich während meines Aufenthaltes hier. Es wurde konkreter.
Den Rest des Tages verbrachte ich an der Klagemauer, saß einfach nur da, schaute dem Kommen und Gehen zu, ließ meine Gedanken schweifen.
Hier begann ich zum ersten Mal, den fortlaufenden Strom meiner eigenen Gedanken zu beobachten. Hier wurde mein Beobachter geweckt. Hier wollte ich für immer bleiben – eigentlich in diesem Bewusstseinszustand, doch das konnte ich nicht ausdrücken. Also verband ich meinen innersten Herzenswunsch mit diesem Ort.
Abends in der Herberge machte ich Bekanntschaft mit einem jungen Engländer namens Matthew. Er war mit seinem Motorrad hier hergekommen und wollte am folgenden Tag nach Bethlehem fahren. Ich bat ihn, mich mitzunehmen, er willigte ein.
Bethlehem liegt nicht weit von Jerusalem entfernt. Noch vor Mittag trafen wir ein.
Zu meiner Überraschung sah der Ort heruntergekommen aus, ärmlich. Die Straßen aus Schotter, die Häuser, aus Lehm gebaute Vierecke mit Löchern statt Fenster, die Wände teils schief, teils bröckelig. Nur ein paar finster dreinblickende Araber. Etwas Bedrohliches lag in der Luft.
Wir fuhren ins Zentrum zu Jesus’ Geburtskirche.
Im Innern folgten wir der Treppe in das kühle, hallende Kellergewölbe. In einer Aushöhlung im alten Gemäuer steht eine Krippe mit Stroh. In mehreren Sprachen ist zu lesen, dies sei nicht der Originalschauplatz von Christi Geburt, sondern eine Nachbildung, der echte Stall mit der Krippe soll aber nicht weit von hier gewesen sein. Das Bethaus wurde erst wesentlich später erbaut.
Wie ich hier so stand mit meinen gesammelten Eindrücken der letzten Tage wurde mir mit einem Mal bewusst, die Bibel ist nicht nur eine Geschichte, sondern enthält Wahrheit. Über Einzelheiten und Interpretationen kann man sich bestimmt streiten, aber eines ist sonnenklar: Jesus hat es gegeben. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut und zwar ein ziemlich außergewöhnlicher. Er ist hier geboren, hat hier gelebt, anders gesprochen und andere Dinge getan als andere und hat die Menschen damals so sehr mit seinem Denken, Sprechen und Handeln beeindruckt, dass sie bis heute nicht aufhören, über ihn zu berichten und zu schreiben. Dass er Gottes Sohn gewesen sein soll, will ich gar nicht in Frage stellen. Das wirft aber neue Fragen auf: Welcher Mensch ist nicht Gottes Sohn? Wer oder was ist überhaupt Gott? Ist der, der die Christen erschaffen hat, derselbe wie der, der den Moslems das Leben gegeben hat? Ist es derselbe, der den Juden den Atem eingehaucht hat? Viele Kriege sind Religionskriege. Wie wäre es, wenn man den Begriff Gott einfach mal in Frage stellt. Nicht Gott, nur den Begriff. Den haben doch die Menschen erfunden. Wenn die Menschheit nun ausstirbt, gibt es dann keinen Gott mehr? Wenn keiner ihn mehr so nennt? Oder ist Gott vielleicht sowieso etwas, das in keinen Begriff passt? Ist es nicht eine Energie, die Kraft, die alles Leben hervorruft? Nun, das könnte man naturwissenschaftlich oder physikalisch belegen. Wie allerdings will man den Atem nachweisen, die Herkunft, den Ursprung des Atems? Da scheint mir doch etwas Größeres, Unbegreiflicheres dahinter zu stehen. Das ist so, wie es ist. Das ist keine Sache des Glaubens. Ob nun Allah, Jehova oder Christus der Richtige ist, wer will das beurteilen und nach welchen Kriterien überhaupt? Ob der Koran, die jüdische Thora oder die Bibel das richtige Buch ist, an das wir uns zu halten haben, um in Frieden miteinander zu leben, ist auch fraglich. Wie viel Leid gab und gibt es im Namen der Religion? Was für den einen richtig ist, ist es für den anderen noch lange nicht. Ist das Richtige nicht das, was zum Frieden führt, zu Harmonie? Was in uns bestimmt eigentlich, welche Aussage und welches Handeln das richtige ist? Gibt es da überhaupt eine Allgemeingültigkeit? Die zehn Gebote reichen scheinbar nicht aus. Sie lassen zu viele Lücken. Nimm nur das Gebot, jeder sollte seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Viele Menschen hassen sich selbst. Und nun?
Trotz aller geistiger Bewegung meldete sich der Hunger. Der Körper hat seine eigenen Gesetze. Ohne Nahrung kein Leben.
Wir traten aus der Kirche und peilten ein Straßencafé an.
Am Tresen standen einige ältere Männer und tranken ihren Tee. Auf dem Tresen befand sich ein großes Blech mit etwas drauf, das mir sehr attraktiv erschien. Eigentlich hätte ich es für einen ganz normalen Blechkuchen halten können, nur diese Farben konnte ich nicht zuordnen. Der Untergrund, ungefähr ein Zentimeter dick und schneeweiß, darüber eine noch mal so dicke Schicht in orange, und das Ganze lag in einem triefenden Sud. War das nun süß oder salzig? Ich bestellte ein Stück davon. Matthew wollte nur einen Kaffee.
Instinktiv setzten wir uns, von den wenigen Gästen mit einer Mischung aus Argwohn und Neugier beäugt, in den Innenraum. Normalerweise kamen Touristen in Reisebussen her, blieben als Gruppe zusammen, nicht vereinzelt wie Matthew und ich. Wir könnten für die Israelis arbeitende Spione sein. Man ließ uns nicht eine Sekunde aus den Augen.
Der Wirt brachte einen Teller der bunten Speise. Mein erster Bissen lüftete das Geheimnis. Die weiße Schicht, Schafskäse, das Orangefarbene, Karotte, das Triefende, honigartiger Sirup, ich hatte es mit süß-salzig zu tun. Höchst interessante Mischung, die gut mundete.
Nach unserer kurzen Rast stiefelten wir zurück zu Matthews Motorrad, stiegen auf und rollten auf eine der abgehenden Straßen zu. Da sich der Kirchplatz auf einer Anhöhe befand, verlief die von einer dicken Schotterschicht bedeckte Straße ziemlich steil bergab. Matthew fuhr sehr langsam und achtsam. Ich dachte, hoffentlich legen wir uns hier nicht hin, da passierte es auch schon. Das Vorderrad verlor seine Bodenhaftung, Matthew bekam die Maschine nicht wieder ins Gleichgewicht. Im Zeitlupentempo fielen wir auf den Schotter, rutschten noch ein wenig bergab und kamen zum Stillstand. Schöne Bescherung! Matthew trug vernünftige Lederkleidung, die ihn schützte. Der Motor des Motorrads lief noch. Meine dünne Leggins war über dem linken Knie aufgerissen, Blut floss heraus. Mit zitternden Beinen stand ich auf, erschrocken, obwohl der Fall beinahe vorauszusehen gewesen war. Ich hätte absteigen sollen, als ich die steile Schotterstraße sah und in mir diese Bedenken spürte. Warum habe ich nicht auf mich gehört? Unbewusst hatte mich der verengte Zugang zu meiner Intuition daran gehindert, sofort zu reagieren.
Wir besahen uns mein Knie. Die rote Leggings zerfetzt, die Haut völlig aufgeschrabt, Kieselsteine richtig tief ins Fleisch reingedrückt. Mein Knie war voller Steine. Hilflos guckten wir uns um. Wie sollte mich hier einer verarzten können?
Ein Mann kam auf uns zu, ein rettender Engel, von Gott gesandt. Er sprach arabisch mit uns, zeigte auf ein Haus schräg unterhalb der Unfallstelle.
Ich verstand keins seiner Worte, aber ich verstand, dass wir in dem Haus einen Arzt finden würden. Ein wenig mulmig wurde mir schon. Hatten die überhaupt eine Betäubungsspritze oder ging es hier ohne ab? Nur Mut, da muss ich jetzt durch.
Matthew stützte mich, bis wir das Haus erreichten. Wir klopften an, und es wurde uns aufgetan. In der Tür erschien ein Mann in einem weißen Kittel. Wortlos wies er mich an, ihm zu folgen. Er führte mich zu einer Liege hinter einem Vorhang und deutete mir an, mich hinzulegen. Zu meiner Überraschung war es hier drinnen blitzsauber wie in einer deutschen Arztpraxis. Ich legte mich hin und überließ mich meinem Schicksal. Der Arzt gab mir eine Betäubungsspritze und machte sich daran, die Wunde zu säubern. Fast eine Stunde lang prokelte er konzentriert mit einer Pinzette in meinem Knie herum und pulte sorgfältig einen Kieselstein nach dem anderen aus dem Fleisch. Danach nähte er mir die zerfetzte Haut zu, verband alles fein säuberlich und reichte mir die Hand zum Abschied. Ich öffnete meine Handtasche, um mein Portemonnaie zu zücken, aber der kleine Arzt winkte energisch ab. Mit einer scheuchenden Handbewegung drängte er uns zur Tür. Ich hatte keine Chance, ihn zu bezahlen, er wollte es partout nicht. So dankte ich ihm noch einmal herzlich und wir verließen sein Haus.
Zurück in Jerusalem beschlossen wir, bei der erstbesten Möglichkeit ein Glas Wein zu trinken.
In einer der Gassen fanden wir eine geöffnete Tür im Gemäuer. Nichts ließ erkennen, dass man hier einkehren konnte. Doch schon tauchte ein älterer Araber vor uns auf, machte eine Handbewegung, als ob er trinken würde und hob fragend die Augenbrauen. Auf unser Nicken hin deutete er mit einer einladenden Geste auf die kleine Holztür. Ich war gespannt, wie es dahinter aussieht.
Nachdem meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich auf dem Boden eine Art Sitzecke aus Matratzen erkennen, über denen Teppiche lagen. Große Kissen mit orientalischen Mustern dienten als Rückenlehne. Auf dem langen, nicht mehr als zwanzig Zentimeter hohen Tisch standen Kerze und Aschenbecher. Der Steinfußboden war derselbe wie in der Gasse. Fenster hatte der Raum keine. Der Mann winkte uns durch die nächste Tür.
Überrascht betrat ich einen Innenhof, ein Patio. Blaues Licht schimmerte auf eine Bar und drei Tische mit Holzstühlen drumherum. Palmenwedel schützten tagsüber vor der Sonne. An einem der Tische nahmen wir Platz. Der alte Mann kam mit einer Flasche Wein in der Hand, die er uns fragend unter die Nase hielt. Er sprach zwei Brocken Englisch und war sehr stolz darauf. Wir nahmen den Wein, der Alte zog sich zurück.
„Ich möchte hier für immer sein, ich will hier leben“, eröffnete ich das Gespräch.
„Wie kannst du so was nach drei Tagen sagen?“, fragte Matthew.
„Das weiß ich nicht, ich fühle etwas, das ich noch nie im Leben zuvor gefühlt habe, und es ist sehr stark. Dieser Ort zieht mich so unwahrscheinlich an, ich will hier sein, hier leben und bleiben, nirgendwo anders.“
Er hob die Augenbrauen. „Ich stimme dir zu, Jerusalem, speziell die Altstadt, ist wirklich sehr spezifisch, aber hier zu leben würde ich mir doch reichlich überlegen.“
„Das werde ich.“
Noch war es mir zu schwierig in Worte zu fassen, was ich hier eigentlich wollte. Ich wusste nicht, dass ich auf der Suche war und was ich überhaupt suchte.
Die folgenden Tage lief ich von morgens bis abends kreuz und quer durch die Altstadt, blieb hier stehen, dort sitzen, unterhielt mich mit den Soldaten und horchte dabei in mich hinein, ob ich wirklich hier wohnen möchte. Alles in mir sagte Ja, ich vernahm kein einziges Nein.
Nach einer Woche flog ich wieder nach Hause.
Ich ging zu meinen Bands und in die Studios und verkündete allen: „Ich bin nur noch bis zum Sommer hier, danach ziehe ich nach Israel!“
Sie waren erstaunt, bewunderten meinen Mut und freuten sich mit mir.
Ein halbes Jahr nahm ich mir Zeit, mich zu verabschieden – von allem.
Eine Band engagierte mich als Keyboarderin und Sängerin für TV-Auftritte. Ich bekam den ganzen Ablauf hinter den Kulissen mit und stellte fest, auch beim Fernsehen wird alles nur halb so heiß gegessen wie gekocht. Traf viele berühmte Leute. Sie waren genauso nett wie die Leute vor den Bildschirmen. Letztlich tat jeder nur seine Arbeit.
Ob ich nicht lieber in Deutschland bleiben möchte und Karriere beim Fernsehen machen?
Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Nein, so aufregend ist das auch nicht. Ich wollte was anderes, ich wollte nach Israel, das Leben live erleben.
Doch ich überprüfte mich auch weiterhin. Es tauchten Fragen auf. Wo will ich wohnen? Wovon will ich leben? Will ich meine vermeintliche Sicherheit in Deutschland tatsächlich aufgeben für etwas absolut Unsicheres?
Ich schrieb einen Brief an die israelische Botschaft in Bonn, erkundigte mich, ob es mir als Europäerin gestattet sei, in Israel eine Wohnung zu mieten, und ob ich dort arbeiten dürfe.
Die Antwort des Botschafters war mir nicht aufschlussreich genug. So kam ich zu der Überlegung, noch einmal nach Israel zu fliegen, um einen Teil der Fragen zu klären.
Im April saß ich wieder im Flieger.
In Tel Aviv fragte ich mich durch zu einer Musikagentur. Eine Sekretärin wies mich in einen Raum, in dem ein Mann hinter einem riesigen Schreibtisch voller Papierkram telefonierte, seine weißen Hemdsärmel hochgekrempelt. Ich hörte zu, wie er ins Telefon sprach.
„Ken.“ Pause. „Ken.“ Pause. „Ken ken.“ Pause.
Ich überlegte, was das wohl heißen mochte.
„Ken ken“, sagte er jetzt wieder.
Es klang so, wie wir Deutschen am Telefon ja sagen oder jaja. Ist ja ein komisches Ja, so hart am Anfang des Wortes und so kurz am Ende. Danach sprach er in ganzen Sätzen. Unmöglich, auch nur ein einziges Wort vom nächsten zu unterscheiden, wo eins anfängt, und wo es aufhört. Ein Redeschwall mit vielen kehligen ch-Lauten, sehr hart im Sound. Diese Sprache werde ich lernen. Durch einen Geistesblitz erkannte ich, Sprache lerne ich wie Musik, Bedeutung von Wörtern merke ich mir wie Akkorde, als Gefühl, in Form von hell oder dunkel, auch richtungsweisend, gebend oder nehmend.
Nachdem er aufgelegt hatte, stellte er sich höflich vor und fragte auf israelisch eingefärbtem Englisch, was ich wolle, er sei der Manager.
„Ich bin Musikerin, Gesang und Piano. Ich möchte in Israel leben, am liebsten in Jerusalem, welche Arbeitsmöglichkeiten gibt es hier für mich?“
„Ich werde dich bekannt machen mit Orit. Sie hat beim letzten Grand Prix mitgemacht. Sie wird dir weiterhelfen können. Morgen kommt sie hierher.“ Zuversichtlich nickte er.
Am folgenden Tag traf ich Orit, eine Frau mit Klasse. Auf Anhieb verstanden wir uns wie zwei Schwestern. Sie war ungefähr so alt wie ich und kam gerade vom Jazz-College in Boston. Orit nahm mich unter ihre Fittiche.
„Ich weiß, was du willst, und ich weiß, was du kannst“, sagte sie bestimmt, „aber das geht nicht in Jerusalem. Nach Jerusalem kommen nur Touristen in Reisegruppen, um sich die biblischen Stätten anzusehen. Die gehen abends nach ihrer Rundreise in ihr Hotel. Maximum spielt noch ein Barpianist, und dann ist Feierabend. Da ist nicht genug Arbeit für dich. Du musst nach Elat gehen. Kennst du Elat?“
„Nein, wo liegt das?“
„Am südlichsten Punkt Israels, unten am Roten Meer. Ein süßer, kleiner Touristenort, der das ganze Jahr über Saison hat. In der Wüste ist es immer warm. Selbst die Israelis verbringen dort ihren Urlaub. Da ist eine Menge los, viele Hotels, Nightclubs, Bars, Diskotheken, und überall wird Live-Musik gemacht. Das ist das Richtige für dich. Es gibt immer Arbeit. Ich schreibe dir die Telefonnummer von Raffael auf. Er ist Bandleader der führenden Band am Ort und hat immer gut zu tun. Mein Freund Aviel spielt bei ihm den Bass. Ich werde ihn anrufen, um dich anzukündigen. Wann fährst du hin?“
„Gleich morgen“, entgegnete ich ohne Zögern.
Ich schlief noch eine Nacht in der Jugendherberge und machte mich am nächsten Morgen auf den Weg nach Elat, ungeheuer gespannt auf die Wüste.
Nach zwei Stunden Busfahrt wurde die Landschaft zunehmend karger, dezimierte sich auf vereinzelte Sträucher. Bald war kein einziges Grün mehr zu sehen. Der Negev ist keine Sandwüste wie die Sahara, sondern Steinwüste. Am Rande des breiten Tales, welches wir durchquerten, türmte sich zu beiden Seiten hohes Felsgestein auf. Gebannt starrte ich aus dem Fenster.
Mitten im Nichts hielt der Bus an einer einsamen Zapfsäule und einem Restaurant. Alle Reisenden stiegen aus, kauften sich Getränke, gingen zur Toilette. Sie wussten, dies ist der einzige Stopp auf der gesamten Strecke. Als ich aus dem Bus trat, war ich überwältigt von dem heißen Wüstenwind, der wie ein überdimensionaler Fön am Horizont heiße Luft über das Land pustete. Wie konnte Wind so heiß sein? Phänomenal, unfassbar. Was für ein Gefühl! Ich schloss die Augen und verharrte, versuchte dieses Gefühl für immer in mir zu verankern. Oder war es umgekehrt? War es schon immer in mir verankert gewesen und ich erinnerte es erst jetzt? Der heiße Wüstenwind kam mir plötzlich so bekannt vor, so vertraut. Ein uriges Gefühl tat sich in mir auf, ähnlich wie das, was ich wahrnahm, als ich dem Alligator gegenüber stand. Das kam aus einer anderen Welt oder aus einem anderen Leben.
Nach zwanzig Minuten ging es weiter auf der einzigen Straße nach Süden. Kaum Verkehr. Ich sah die ersten Beduinen meines Lebens, ihre offene Behausung. Schwarzes Zelttuch als Dach und Wand, um Sonne und Wind abzuhalten. Davor standen zwei von oben bis unten in Schwarz gehüllte Frauen und drei Männer in Braun mit Turbanen auf ihren Köpfen. Einige spärlich bekleidete Kinder liefen umher. Nicht weit vom Zelt graste eine Herde Ziegen. Ich versetzte mich in ihre Lebenssituation. Wie lebt es sich wohl hier? Von morgens bis abends dem Wüstenwind ausgesetzt zu sein. Gehen die Kinder in eine Schule? Was lernen sie? Was wissen sie? Bestimmt nicht das, was wir wissen, aber garantiert eine Menge, von dem wir überhaupt nichts wissen. Sie müssten eigentlich wissen, was das Leben ist, sie haben nichts anderes, keinerlei Zerstreuung. Was essen sie? Woher bekommen sie Wasser? Wo kaufen sie ein? Arbeiten sie? Wie verdienen sie ihr Geld? Kommen sie jemals weg von hier? Haben sie Freunde? Wo wohnen die und wie besuchen sie sich? Wie waschen sie sich? Während sich die Fragen in mir häuften, verschwand die Beduinensippe aus meinem Blickfeld.
Die zauberhaften Felsformationen zogen mich wieder in ihren Bann. Wir kamen in eine geradezu utopische Landschaft mit zig kleinen Tafelbergen aus weißem Gestein so weit das Auge reicht, alle gleich hoch, als hätte der liebe Gott mit einem Riesenmesser einmal waagerecht hindurch sämtliche Spitzen abgeschnitten. Atemberaubend! Die Wüste ist voller Schönheit. Beim Anblick der uralten, kahlen Felsen schwindet das Zeitgefühl. Wenn Gott irgendwo wohnt, dann muss es hier in der Wüste sein. Die Atmosphäre ist geradezu himmlisch.
Plötzlich leuchtete in der Ferne mitten im endlosen Hellbeige ein grüner Fleck. Das muss eine Moshav sein, ein Landwirtschaftsbetrieb. Dort machen sie ein Stück Wüste urbar und bauen Avocados, Auberginen und Melonen an, die wir in Deutschland im Supermarkt kaufen können. Was für ein weiter Weg.
In der glühenden Abendsonne tauchten die ersten Häuser auf. Fremdkörper. Zivilisation. Schade. Natur pur hat sich besser angefühlt.
Wir fuhren in den Ort hinein bis zur Hauptbushaltestelle, wo etliche Menschen auf die Ankunft des Busses mit seinen Fahrgästen warteten.
„You need a room?“ Brauchst du ein Zimmer? Alle fragten und riefen durcheinander.
Nein danke, ich wollte erst mal ankommen und gucken, wo ich hier gelandet bin, schnallte meinen Rucksack um und bahnte mir meinen Weg durch die Menge.
Zahlreiche Läden, Kiosks und Cafés an der Straße, die steil bergab führt. Unten glitzert das Wasser. Gegenüber türmen sich die Berge Jordaniens über Akaba auf, der Stadt am Roten Meer, die Lawrence von Arabien einst über die Berge kommend eingenommen hatte. Das Felsengebirge leuchtet in der untergehenden Sonne rot, wirft sein Licht zurück auf das Meer, welches dadurch seinen rötlichen Schimmer erhält. Daher der Name Rotes Meer. Wie wunderhübsch das aussieht!
Verzaubert ging ich an den Strand, setzte mich in den Sand und sog alles in mich ein, die Luft, die Berge, das Meer, die Palmen, die Lichter, die fremden Laute um mich herum, und ich genoss das Dasein. Mit dem Untergehen der Sonne stellte der Wind sein heißes Gebläse ein. Die Luft kühlte kein bisschen ab. Völlig gefesselt verharrte ich eine gefühlte Ewigkeit.
Der Mond ging auf. Ich holte meinen Schlafsack raus und legte mich in den Sand.
Was für ein Sternenhimmel! So viele Sterne, viel, viel mehr als man in Deutschland selbst im Winter sehen kann. Hier verbringe ich meine erste Nacht. Kann es einen besseren Platz geben?
Geld, Papiere und Ticket legte ich in den Schlafsack ans Fußende, meinen Kopf auf den Rucksack. Zum Bersten glücklich schlief ich ein.
Die Hitze der Sonnenglut weckte mich am frühen Morgen. Offensichtlich war ich nicht die einzige, die diesen Schlafplatz gewählt hatte. Ich entdeckte noch einige andere Strandschläfer, packte meine Sachen und ging über die Straße hoch ins Tourist-Center, um an einer schönen Ecke einen Kaffee zu trinken. Froh, hier zu sein, ließ ich mich treiben.
Später rief ich bei Raffael an, niemand ging ans Telefon.
Die meiste Zeit verbrachte ich am Strand.
Eine Gruppe Jungs lungerte unter einer Palme herum. Wir kamen ins Gespräch. Allesamt trugen sie biblische Namen. Shlomo, Samuel, erzählte mir von seiner Zeit beim Militär.
„Ich war im Libanon. Es war schrecklich, die Schießereien und all das, die Schreie, die Kinder. Du musst schießen oder du wirst erschossen. Also habe ich geschossen, habe jemanden erschossen. Bin fast verrückt geworden. Da habe ich zu ihnen gesagt: ,Lasst mich gehen, ich kann das nicht, ich werde wahnsinnig.' Da haben sie mich nach Hause gelassen.“
Verwundert blickte ich ihn an. „Wie alt bist du?“
„Neunzehn.“
Eigenartig, einen jungen Menschen vom Krieg reden zu hören, das kenne ich nur von Vätern und Großvätern.
Ich ging schwimmen. Meine wasserdichte Geldbörse ließ ich absichtlich zurück. Wenn Shlomo keinen Menschen töten kann, wird er sicherlich auch nicht stehlen. Und wenn einer der anderen Jungs Geld von mir nehmen will, wird Shlomo ihn sicher daran hindern. Es musste so sein, ich wollte unbedingt, dass es so sei. Nur ein paar Schekel im Portemonnaie, ließ ich es darauf ankommen. Ich wollte vertrauen. Als ich aus dem Wasser kam, waren die Jungs weg, mit ihnen meine Börse.
Ärgerlich. Ich war naiv. Man kann wohl niemandem trauen.
Das Vertrauen hatte ich lediglich an der falschen Stelle gesucht.
Was ist Vertrauen eigentlich genau? Und woher kriegt man das?
Am letzten Tag vor meiner Rückreise bekam ich endlich Raffael ans Telefon.
„Komm heute Abend zum Club Med. Dort haben wir eine Show. Hinterher können wir reden.“
In meinen schicksten Sachen erschien ich im jüdisch französischen Hotel Club Méditerranée.
Die Show hatte internationale Klasse, hebräische Songs, die neuesten Welthits, Begleitung einer schwarzen Sängerin aus Amerika. Sofort stellten sich Vertrautheitsgefühle ein, dieses Metier kannte ich. Ja, in dieser Band würde ich gerne mitspielen.
Anschließend ergab sich ein kurzes Gespräch mit dem Bandleader Raffael. Er begutachtete mein Äußeres und fragte: „So, du willst in meiner Band spielen?“
„Ja.“
„Ich könnte noch eine Keyboarderin gebrauchen“, überlegte er. „Wann willst du einsteigen?“
„Im Juli.“
„Bringst du dein Keyboard mit? Was für eins hast du?“
Ich nannte ihm die Marke.
„Gut, bring es mit. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns im Juli.“
Das war's. Das kürzeste Vorstellungsgespräch, das ich je hatte. Keine weiteren Fragen nach meiner Ausbildung oder meiner bisherigen Berufserfahrung, kein Vertrag, kein Wort über Geld, nichts. Na gut, wenn das hier so ist, spiele ich nach euren Spielregeln. Kann ich dem Raffael denn nun vertrauen, dass er mich im Juli auch wirklich einsetzt? Diese Frage ist nicht beantwortbar. Ich muss es darauf ankommen lassen, habe eh keine andere Wahl.
Ich flog nach Deutschland, brach meine Zelte ab, verkaufte mein Auto, gab mein Klavier in Zahlung, löste meine Wohnung auf und verabschiedete mich von allen Freunden und Arbeitsstätten. Meine Freunde bedauerten mein Weggehen.
Zum Traurigsein war ich viel zu erregt über meine Entscheidung zu gehen und voller Vorfreude auf mein neues Leben in Israel. Ganz auf sich gestellt zu sein, die Sprache nicht zu beherrschen, das Leben dort nicht zu kennen, das Neue, die Unsicherheit, all das berauschte mich. Indem ich alles Vertraute hinter mir ließ, sah ich eine Chance, wieder normal essen und angstfrei leben zu können. Ich hatte das Gefühl, ich werde neu geboren und adoptiere mich diesmal selbst. Ich gab mir auch einen neuen Namen, nannte mich Ssabena, mit scharfem S, ohne zu wissen, was das bedeutet, aber es fühlte sich gut an, in Übereinstimmung mit etwas tief in mir drin.
Am ersten Mittwoch im Juli landete ich in Tel Aviv.
Mit einer kleinen Inlandsmaschine flog ich weiter Richtung Elat. Wie im Traum glitt ich über die Wüste Negev hinweg, sah wie das Grün langsam vom Erdboden schwindet und zunehmend nackte Felsen die Landschaft bestimmen, wie sich die Wadis durch die Berge schlängeln, unvermittelt die Tafelberge auftauchen. Ich stellte mir vor, dort unten als Beduine auf einem Kamel entlang zu reiten, jeden Berg, jeden Vorsprung zu kennen, zu wissen, dass hinter fünf weiteren Felsen ein vereinzeltes Bäumchen steht, unter dem meine Freunde wohnen.
Überraschend tauchte ein strahlend blauer Klecks auf, als hätte der liebe Gott einmal auf die Erde gespuckt. Das zwischen den endlosen Beigetönen unwirkliche Blaue war das Tote Meer. Wie klein! Da möchte ich auf jeden Fall mal rein.
Östlich davon erstrecken sich die wunderschönen, rötlichen Berge bis weit nach Jordanien hinein, südlich verläuft das Gebirge entlang der saudi-arabischen Küste bis nach Jemen. Das Tote Meer war einst mit dem Roten Meer verbunden. Auseinanderdriften der afrikanischen und arabischen Erdplatten sowie fortschreitende Verdunstung haben die Trennung bewirkt. Vor meinem inneren Auge hatte ich einen Überblick darüber, wie vor Jahrmillionen dieser Teil der Welt ausgesehen haben muss und wie er sich mit der Zeit verwandelte. Mir war, als hätte ich die Weltkugel von einem Raumschiff aus betrachtet, von viel höher, als Flugzeuge je fliegen, und als wäre ich durch die Geschichte der Erde gereist.
In Elat haute mich die Hitze des Wüstenwindes schier um, für einen Europäer unvorstellbar, das muss man erlebt haben.
Der winzige Flughafen liegt mitten im Ort. Von der Maschine aus geht man zu Fuß die paar Meter zum Flughafengebäude, das kleiner ist als jedes deutsche Bürohaus.
Aus einer Telefonzelle rief ich Raffael an, er war zu Hause. „Komm mit dem Taxi zu eintausendfünf auf drei, das ist Orits Adresse, ich bin gleich da.“
Was ist denn das für eine Adresse? Kein Straßenname? Nun gut, wir werden sehen.
Ich setzte mich ins Taxi und nannte die Zahlen. Der Fahrer wunderte sich kein bisschen, fuhr sofort los. Nach fünf Minuten waren wir am Ziel. Am Gebäude stand 1005, an einer der Türen eine 3, Orits Eingang. Ich klingelte, sie öffnete.
„Hallo, how are you, nice to see you, wie schön, dich wiederzusehen“, erfreut breitete sie ihre Arme aus, um mich herzlich zu drücken, „komm rein, trink erst mal was, in Elat musst du viel trinken. Jetzt im Sommer musst du vier bis fünf Liter Wasser am Tag trinken, sonst trocknest du aus. Trink immer, auch wenn du nicht durstig bist.“ Besorgt drückte sie mir ein Glas Wasser in die Hand. „Weißt du, wenn du feststellst, dass dir schwindelig wird oder übel, und das, weil du zu wenig getrunken hast, ist es meist schon zu spät. Dann ist ein Teil von dir bereits mit Flüssigkeit unterversorgt, da hilft dann nicht schnell viel trinken, das ist sogar gefährlich, nein, Schluck für Schluck musst du dich wieder auffüllen. Und du musst ins Krankenhaus an den Tropf. Es ist schon passiert, dass Leute hinterher einen Finger nicht mehr bewegen konnten oder meschugge geworden sind im Kopf. Das sind Folgen von der Austrocknung, also denk daran, immer trinken.“
Erste Einweisung in die Lebensführung hier. Vielen Dank.
Mit Orit, mütterlich und schwesterlich zugleich, fühlte ich mich wohl.
Gerade hatte ich mein Glas ausgetrunken, klingelte es an der Tür. Zwei jugendliche Typen kamen herein, einer mit Gitarre über der Schulter, der andere klein und unscheinbar.
„Das ist Isaak, er spielt bei uns Gitarre, das ist Radshif, er ist ein großartiger Schlagzeuger“, stellte Orit sie vor, „und das ist Marlisa aus Deutschland.“
Die beiden grüßten mich nickend, gingen an mir vorbei ins Wohnzimmer und begannen wortlos ihre Instrumente aufzubauen.
Ich wartete ab. Mein Keyboard sowie eine kleine Kiste mit Bühnenkleidung sollten in den nächsten Tagen im Hafen von Haifa eintreffen.
Orit wies auf das Keyboard längs zur Wand: „Setz dich da ran, du kannst spielen, wenn du willst, es ist meins. Ich gebe dir gleich ein Mikrofon.“
Erneut läutete die Türklingel. Zwei Männer traten ein. Raffael kam auf mich zu und reichte mir die Hand.
„Hi Marlisa, du bist also hier. Montag haben wir einen Job im Hotel Neptun. Ich will, dass du da mitspielst. Also lass uns jetzt proben. Was hast du so drauf an Titeln?“
Ich nannte einige.
„Okay, Smooth Operator von Sade passt gut in unser Programm, damit fangen wir an. Das ist Aviel, er spielt den Bass.“
Aviel reichte mir die Hand, blickte mich warm an. „Herzlich willkommen in unserer Band“, sagte er liebevoll lächelnd und stöpselte seinen Bass ein. „Welche Tonart?“
„D-Moll“, antwortete ich.
„Okay“, kam von Raffael, „let’s start. One - two - three - four.“
Los gings. Ein kleines bisschen aufgeregt war ich schon bei diesem Debüt.
Als der Song zu Ende war, blickte Raffael mich angenehm überrascht an. „Es gefällt mir, wie du singst, wirklich gut. Lass uns einen anderen Song machen, ich will hören, wie du die zweite Stimme drauf hast.“
Raffael war zufrieden. Musik machen mit mir funktionierte mit Leichtigkeit.
„Kannst du hebräisch?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Das musst du lernen. Wir singen auch ein paar israelische Lieder, ich will, dass du da mitsingst. Orit wird dir helfen mit der Aussprache.“
Konzentriert arbeiteten wir bis zum Abend. Wenn ich einen Titel nicht kannte, spielten sie ihn mir vor, ich schrieb die Harmonien auf und war sofort in der Lage mitzuspielen.
Zwischen zwei Liedern kam Isaak auf mich zu, wollte hinter mir vorbei zur Toilette gehen. Da ich dicht an der Wand saß, war dort wenig Platz. Ich weiß nicht, warum er nicht außenrum ging. Mit ungemein süffisantem Lächeln grinste er breit: „Can you take your ass away, baby?“ Kannst du deinen Hintern da wegnehmen, Süße?
Wie durfte ich das denn nun verstehen?
Das war das einzig Private, was während der Probe gesprochen wurde.
„Mit dir ist gutes Arbeiten“, lobte mich Raffael, „morgen proben wir ein paar andere Songs, und dann machen wir Pause bis Montag. Hast du was zum Anziehen für die Bühne? Stimm dich mit Orit ab, damit ihr zusammenpasst. Bye, see you tomorrow!“ Weg waren sie, nur Aviel blieb.
„Hast du Hunger? Du musst hungrig sein! Komm, iss etwas!“, forderte Orit mich auf.
Wir gingen in die Küche. Sie holte einige Sachen aus dem Kühlschrank und stellte sie auf den Tisch. Nichts davon kannte ich. Die Paste in dem großen Plastikbecher sah aus wie braune Mayonnaise, die kleinen, dunkel lila leuchtenden Dinger auf dem Teller waren wahrscheinlich sauer. Die runden, flachen Teile identifizierte ich sofort als Brot.
„Eat, iss!“
Ich wusste nicht so recht, wie ich vorgehen sollte. Auf dem Tisch lagen weder Messer noch Gabel noch Teller.
Orit bemerkte mein Zaudern, sie lachte. „Ah, du kennst das nicht. Nimm eine Pita, so nennen wir dieses kleine Fladenbrot. Reiß ein Stück ab und ziehe es durch den Chumus, so.“ Sie machte es mir vor.
Ich machte es ihr nach. „Mmh, lecker, woraus besteht Chumus?“
„Das sind pürierte Kichererbsen mit etwas Knoblauch, Petersilie und Zitronensaft. Man serviert es eigentlich auf einem flachen Teller, gießt Olivenöl darüber und streut Chilipulver darauf, aber ich bin jetzt zu faul. Weißt du, mein Volk ist vierzig Jahre lang durch die Wüste gezogen, bevor es hier in Israel ankam. Da war es notwendig, ein schnelles Mahl zubereiten zu können, das man ohne viel Geschirr essen kann. Wo hätten wir denn das alles abwaschen sollen für die vielen Leute? In der Wüste überlegst du dir zweimal, wofür du das Wasser, das du hast, verwendest. Außerdem ist das Essen gesund. Das Brot macht dich satt, die Kichererbsen enthalten sehr viel Eisen und andere Mineralien und die Auberginen sind voller Vitamine und gut aufzubewahren, weil sie sauer eingelegt sind. Dies ist typisches Israeli-Essen wie bei euch Sauerkraut und Würstchen. Sprech ich das richtig aus? Sauerkraut und Würstchen?“
Nun musste ich lachen. Nach ihrem zweijährigen Amerika-Aufenthalt sprach sie deutsch mit amerikanischem Akzent. „Ziemlich gut, nur rollen wir das r nicht so wie die Amis, sondern so“, ich machte es ihr vor.
„Ah, so sprechen auch einige Israelis das r aus. Das kann ich auch. Eigentlich bin ich gar keine Israelin, ich bin Ägypterin. Sieh dir meine helle Haut an. Und den Schnitt meiner Augen. Daran erkennst du meine ägyptische Herkunft. Mein Nachname ist Moawad. Das ist ägyptisch. Die Israelis waren doch früher bei den Ägyptern viele Jahre als Sklaven, bevor Moses sie herausgeführt hat. Da passierte es schon mal, dass sich ein Ägypter in eine schöne, israelische Sklavin verliebte und mit ihr ein Kind zeugte. Einer meiner vielen Vorfahren war auf jeden Fall Ägypter, und ich bin stolz darauf.“
„Ich bin eigentlich auch keine richtige Deutsche“, vertraute ich ihr an, „ich bin halbe Italienerin, mein Vater ist Sizilianer.“
„Wow, also sprichst du italienisch?“
„Nein, ich kenne ihn nicht. Ein bisschen Italienisch habe ich gelernt, aber richtig gut kann ich es nicht.“
„Willst du deinen Vater nicht kennenlernen?“
„Ja klar, aber das ist nicht einfach, ich weiß nicht einmal, wie er heißt. Wo soll ich da anfangen zu suchen?“, erklärte ich bedauernd.
„Das ist schade“, stimmte Orit mir zu. „Komm, wir gehen ins Wohnzimmer zu Aviel, er sitzt dort allein.“
Wir gingen rüber und erzählten Geschichten aus unseren Leben.
An der Wand des Wohnzimmers lief ein Tier hoch. Etwa zwanzig Zentimeter lang und durchsichtig wie ein Wattwurm.
„Iiih!“, schreckte ich auf, „was ist das?!“ Ich hatte es in meinem Leben bislang nicht geschafft, mich mit allen Tieren anzufreunden, Kriechtiere ekelten mich immer noch. Dieser hier sah interessant aus, und solange er nicht meint, über mich rüberkrabbeln zu müssen, habe ich auch nichts gegen ihn.
„Das ist ein Gecko, sie tun nichts, keine Angst“, sagte Orit nüchtern.
„Laufen die immer in Häusern an Wänden hoch?“, fragte ich, um mich auf das, was auf mich zukommt, einstellen zu können.
„Normalerweise leben sie draußen, aber hin und wieder kommt einer rein. Sie haben Saugnäpfe an den Füßen, sie können auch an der Decke entlanggehen. Es sind hübsche Tiere und sie sind nützlich, da sie die Insekten wegfangen. Ich mag sie.“
„Na ja, hübsch sind sie, aber nicht so unbedingt mein Fall.“ Ich schämte mich ein wenig für meinen Ekel. Vor zehn Jahren wäre ich schreiend aus dem Haus gerannt und nicht wieder reingekommen, so phobisch war ich gewesen. Gott sei Dank hatte sich diese Angst in der Zwischenzeit zur ganz normalen Gänsehaut zurückgebildet, das war doch schon ein kleiner Fortschritt. Davon erzählte ich Orit nichts, ich wollte mich nicht lächerlich machen. Außerdem fand ich es völlig unnatürlich, sich vor schlangenartigen Kriechtieren zu ekeln, das passte so gar nicht zu meinem Wunsch nach erdverbundenem Indianerleben. Pech, in diesem Fall konnte ich meine Erwartungen an mich selbst nicht erfüllen.
„Wo schläfst du heute Nacht? Hast du schon einen Schlafplatz?“, fragte mich Orit zu fortgeschrittener Stunde. Noch ehe ich antworten konnte, schlug sie vor: „Du kannst hier bleiben, wir haben ein Zimmer frei, da kannst du erst mal wohnen, bis du was anderes gefunden hast. Komm mit, ich zeige es dir.“
Prima, ich hatte ein Bett. Sogleich breitete ich meinen Schlafsack darüber aus. „Danke, Orit.“
Sie drückte mich. „Good night, sweet dreams.“
„Was heißt gute Nacht auf Hebräisch?“
„Laila tov.“ Sie sprach das tov mit einem weichen stimmhaften w am Ende aus.
Das klang sehr schön. Ich sagte es ein paar Mal vor mich hin. „Ist Laila nicht ein Name?“
„Ja, es ist ein arabischer Name, viele Mädchen heißen so.“
„Dann heißen sie ja Nacht.“
„Wenn ein Mädchen mitten in der Nacht geboren wurde oder wenn sie schön ist wie die Nacht, ist Laila doch ein passender Name, findest du nicht?“
Damit ging sie und ich blieb allein in dem leisen Surren der Klimaanlage.
Was für ein Tag! Ich hatte es tatsächlich geschafft. Ich war hier, ich war in Israel. Ich wurde freundlich aufgenommen und hatte Arbeit. Kann ein Mensch sich mehr wünschen?
Überglücklich schlief ich ein.