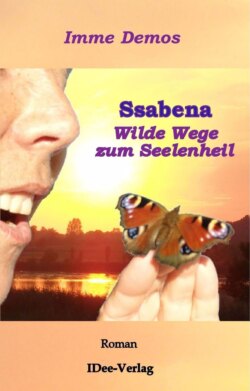Читать книгу Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil - Imme Demos - Страница 7
Anders geht auch
ОглавлениеAm Montagabend fuhren Orit und ich ins Hotel Neptun. Die Jungs von der Band waren schon da, mit Ausnahme von Raffael. Radshif und Isaak würdigten mich keines Blickes. Radshif saß am Schlagzeug. Er blickte so düster, wie ich noch nie zuvor einen Menschen habe blicken sehen. Um seinen Kopf herum sah ich eine große, schwarze Wolke. Es war der Schatten in seinem Energiesystem, den ich unbewusst wahrnahm.
Ein fremdes Gesicht erschien auf der Bühne.
„Das ist Shish“, stellte Orit ihn vor, „er spielt die Posaune.“
Shish reichte mir die Hand, sah mich aus großen Kinderaugen verzückt an, schien Gefallen an mir zu finden.
Ich wunderte mich, dass ein Posaunist mitspielt.
Raffael kam mit einem Keyboard für mich. Wir machten kurzen Soundcheck für einen Open-air-Auftritt zum Barbecue. Hübsch gedeckte Tische am Hotelpool, in der Mitte ein langer Buffet-Tisch. Langsam füllte sich der Platz mit vornehm gekleideten Gästen. Ich beobachtete die Szenerie, ließ mir den warmen Wüstenwind über die Haut streichen und genoss den sternklaren Himmel über mir. So angenehmes Arbeitsklima hatte ich noch nie.
Die Show verlief großartig. Bei den israelischen Liedern drückte Raffi mir einen Schellenring in die Hand. Somit konnte ich auf der Bühne bleiben und das Publikum betrachten. Die Leute kannten die Lieder, sangen und klatschten mit, einige tanzten dazu, aber anders als bei den Disco-Hits. Sie tanzten folkloristisch und es waren zuerst Männer, die auf die Tanzfläche traten, bevor sich einige Frauen hinzugesellten. Fühlte sich so an, als würden sie sich alle untereinander kennen und hätten sich verabredet, heute hier gemeinsam Party zu machen, eine herrliche Stimmung unter dem Himmelszelt.
Nach zwei Stunden war Schluss. Die Gäste verschwanden. Radshif und Isaak fingen mit dem Abbauen an. Shish lobte meinen Gesang und mein Keyboardspiel. Orit und Aviel gingen nach unten zum Buffet.
„Come, let’s eat.“ Komm, lass uns essen. Raffael zeigte auf das Buffet, das sie für uns Musiker stehenließen, während die Tische bereits abgeräumt wurden.
Eine beleibte Dame kam, nahm meine Hand und zog mich an ihren fülligen Busen. Sie schwärmte: „Marlisa, du warst so wundervoll. Ich habe die ganze Show gesehen. Du bist wahrhaft eine Bereicherung für Raffis Band. Ich war schon so gespannt auf dich. Als mein Sohn mir erzählte, er hätte eine Sängerin aus Deutschland, habe ich gleich gesagt, ihr müsst euren ersten Auftritt mit ihr bei mir im Neptun-Hotel machen, darauf bestehe ich. Komm, mein Mädchen, du musst hungrig sein, komm, hier gibt es leckeres Essen, nimm dir alles, was du willst.“ Sie führte mich zum Buffet und ließ mich dort allein.
Neugierig betrachtete ich die Speisen. Den Chumus in der flachen Schale erkannte ich wieder, den Rest nicht. Ich nahm mir einen Teller, füllte von allem auf, was mich ansprach und setzte mich zu Orit an den Tisch.
Bald saß die ganze Band um den Tisch herum, wir aßen gemeinsam.
„Das eben war Raffis Mutter Sarah. Sie ist hier sozusagen der Chef“, klärte Orit mich auf.
„Ach so“, nickte ich verstehend.
„Was heißt das, ach so, das sagst du öfter?“, fragte Orit.
„Das heißt soviel wie aha, verstehe. Was ist das hier auf meinem Teller, das so ähnlich aussieht wie Chumus?“
„Das ist Techina, arabisch, gestoßene Sesamkörner mit Knoblauch und Zitrone, wir essen es gerne zusammen mit Chumus.“
„Und dieser köstliche Salat hier?“
„Das ist Auberginensalat.“
„Aber der schmeckt so besonders, wie kommt das?“
„Die Aubergine wird zuerst über dem Feuer geröstet, bis man die verkohlte Haut vom Fleisch abziehen kann. Das Fleisch ist durch das Feuer weich geworden und du brauchst es nur noch mit Mayonnaise zu vermengen, etwas Knoblauch dran, fertig ist der Salat.“
Ach so, der Rauchgeschmack war also das Besondere.
Eine wunderschöne Frau in einem hübschen Kleid trat an den Tisch. Sie war hochschwanger und hielt einen kleinen Jungen von zwei bis drei Jahren an der Hand.
„Hallo“, sagte sie mit einem müden Lächeln. Die Hitze musste ihr in ihrem Zustand zu schaffen machen.
Radshif sprang sofort auf. „Ich komm schon“, sagte er zu ihr und zu Raffael gewandt: „Wann ist unser nächster Gig?“
„Mittwoch im King Salomon“, antwortete Raffi.
„Kann ich meine Cases hier lassen?“
„Okay.“
Radshif brachte die Schlagzeugkoffer in das Hotel, kam nach kurzer Zeit wieder heraus, nahm das Kind auf den Arm, die Frau an die Hand und sagte: „Lass uns gehen.“
Wie kam ein so hässlicher Kerl an so eine hübsche Frau? Und ein Kind hatte er auch schon. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Wir anderen saßen noch eine Weile beisammen, bevor wir den Rest von der Bühne räumten.
Raffael verkündete mir: „Mittwoch sind wir im King Salomon, ich hole dich und Orit mit dem Van ab. Bye.“
Orit und Aviel fuhren mit dem Taxi nach Hause, ich ging zum Strand, noch ein wenig die warme Luft genießen.
Fantastisch, wie die Luft in der Nacht glühte. Ein anderes Klima als in Spanien oder Florida, Wüstenklima eben. So dermaßen trocken, dass man trotz Hitze nicht schwitzt.
Noch lange saß ich am Strand und schaute auf das Rote Meer, bis ich mir ein Taxi nach Hause nahm.
Tagsüber waren Orit und Aviel nicht da, Stunden um Stunden verbrachte ich am Strand. Endlich Licht und Wärme satt.
Bei Orit fühlte ich mich bereits wie zu Hause.
Doch nach einer Woche teilte sie mir mit, ich könne nicht mehr bei ihr wohnen.
„Aviel fühlt sich nicht wohl und mein Vermieter sieht es auch nicht gern, du musst dir etwas anderes suchen. Ich werde dir helfen. Ruf doch mal bei Radshifs Frau an. Sie bekommt ein Baby und wird sich sicher freuen, jemanden im Haus zu haben, der ihr helfen kann. Außerdem wird sie deine Miete gut gebrauchen können. Ihr Name ist Peggy.“ Schon hatte sie den Telefonhörer in der Hand und wählte. Sie übergab mir das Telefon, noch bevor ich eine Frage stellen konnte.
„Hallo Peggy, hier ist Marlisa, die neue Sängerin aus Deutschland. Wir haben uns im Hotel Neptun kurz gesehen.“
„Hi“, kam es teilnahmslos zurück.
„Bislang habe ich bei Orit gewohnt, aber das geht nicht mehr. Sie empfahl mir, dich zu fragen, ob ich mich bei dir einmieten kann?“
„Das passt im Moment nicht. Es wird Radshif auch nicht gefallen. Tut mir leid, du wirst etwas anderes finden. Bye.“ Aufgelegt.
„Das war keine gute Idee, wie bist du überhaupt darauf gekommen?“, wollte ich von Orit erfahren.
„Ich habe gehört, dass Radshif mal wieder von zu Hause abgehauen ist, und da dachte ich, Peggy braucht bestimmt Unterstützung. Die beiden streiten sich viel und er verschwindet dann einfach, schläft am Strand. Das macht ihm nichts aus. Er ist Inder, weißt du, er war ein Junky, als er hier ankam. Ich glaube, er hat immer noch Probleme. Er ist ein bisschen verrückt, aber er ist der beste Schlagzeuger, den ich kenne.“
„Und nun?“
„Weiß ich auch nicht, ich werde mich umhören. Geh in die Stadt und hör dich um, irgendwo wird schon ein Zimmer frei sein, frag doch mal Sarah. Ich muss jetzt los, bye, Marlisa.“
Etwas bedripst saß ich da. Na gut, mal sehen, wohin das Schicksal mich verschlägt.
Frischen Mutes ging ich am nächsten Morgen in die Stadt, gönnte mir erst einmal ein schönes, großes Eis.
„Weißt du zufällig, wo jemand ein Zimmer frei hat?“, fragte ich den Eisverkäufer.
Er sprach kein Englisch, aber das Wort room war hier jedem bekannt. Lächelnd deutete er mir an zu warten, indem er seine Handfläche nach oben drehte, alle Finger an den Daumen legte und die Hand leicht auf und ab schüttelte, die typische Handbewegung der Israelis für ,Warte!’ Der Alte ging aus dem Laden und kam nach zwei Minuten zurück mit einem Mann im Schlepptau. Der sprach mich gleich auf Englisch an: „Du suchst ein Zimmer? Ich habe eins. Du kannst bei mir im Haus wohnen. Ich bin sein Schwager“, auf den Alten zeigend. „Komm heute Nachmittag, dann fahren wir hin, willst du noch ein Eis?“
„Nein, vielen Dank. Wann heute Nachmittag?“
„So um fünf.“
Ich lief nach Hause meinen Rucksack packen.
Punkt fünf war ich zurück. Der Alte lächelte erfreut. Seine braunen Zähne wurden sichtbar. Mit Selbstverständlichkeit drückte er mir ein Eis in die Hand und winkte ab, als ich bezahlen wollte.
Über eine Stunde wartete ich, bis mein neuer Vermieter endlich auftauchte.
„Komm!“, sagte er nur.
Ich folgte ihm zum Parkplatz in einen teuren Wagen. Der Mann sah gut angezogen aus.
In seinem Apartment, großzügig und ordentlich, führte er mich in eins der Zimmer. „Hier kannst du wohnen.“ Diskret verließ er den Raum.
Er würde mir schon noch Bescheid geben, wie viel Miete er haben wollte.
Eine gehäkelte Tagesdecke zierte das große Bett. Auf der Kommode glänzten mehrere Parfumflakons. Freudig begann ich meine Sachen auszupacken. Der Kleiderschrank war voller Damenwäsche. Plötzlich hörte ich im Flur eine Frauenstimme. Sie klang ziemlich aufgebracht. Der Mann verteidigte und erklärte. Sie wurde immer lauter. Meine Zimmertür ging auf, die Dame überschüttete mich mit einem hebräischen Wortschwall. Ich verstand zwar nichts, aber mir dämmerte, meine Anwesenheit war nicht erwünscht.
Sie ging, er kam. „Entschuldigung, tut mir wirklich leid, aber du kannst hier nicht wohnen. Sie will es nicht. Komm mit, ich fahre dich zurück.“
Na sowas! Ich weiß zwar nicht, ob die Dame seine Frau war oder seine Geliebte, noch ob sie überhaupt hier wohnt. Auf jeden Fall hatte sie zu sagen. Offensichtlich hat er sie nicht gefragt, ob sie damit einverstanden ist, dass er vorübergehend einen Gast bei sich aufnimmt. Wahrscheinlich waren die Sachen im Zimmer ihre.
Ich packte wieder ein und fuhr mit dem Mann zurück zur Eisdiele. Er sprach kurz mit dem Alten. Der schenkte mir ein weiteres Lächeln und der Schwager erklärte: „Du kannst bei ihm wohnen, er nimmt dich nachher mit. Er heißt Nachum, er ist okay, tschau.“
Geduldig wartete ich noch zwei Stunden, bis Nachum mir anzeigte, ihm zu folgen.
Wir stiegen in einen klapperigen Lieferwagen und fuhren einige Häuserblocks weiter zu seiner Wohnung.
Das Zimmer, in das er mich bat, war mit einem breiten Bett ausgestattet, einer Kommode und einem Kleiderschrank. Er machte eine einladende Handbewegung und neigte den Kopf. Aha, hier sollte ich also schlafen. Es roch etwas muffig und war nicht so sauber wie bei seinem Schwager, aber es war ein Schlafplatz.
Nachum ging wieder.
Das Alleinsein nutzte ich, um mir die Wohnstätte anzuschauen. Weder Tapeten noch Teppiche noch Gardinen. Die Wände weiß gestrichen, Fußböden gefliest. Kühlschrank mannshoch mit großem Gefrierfach, fast leer. Volle Mülltüte in der Ecke. Augenscheinlich gab es keine Frau in diesem Haushalt. Ich sann noch ein wenig vor mich hin und ging schlafen.
Mitten in der Nacht wurde ich geweckt. Jemand stieg zu mir ins Bett. Es war Nachum. Erschrocken richtete ich mich auf.
„Dis my bed“, sagte er und kümmerte sich nicht weiter um mich, drehte sich zur Seite und holte aus seinem Nachtschrank ein eigentümliches Gerät heraus, eine Art Pfeife. Eine gewöhnliche Halbliterflasche mit ein wenig Wasser drin, auf halber Höhe war ein Stück schwarzer Gummischlauch steil durchs Plastik gesteckt, oben ins offene Ende des Schlauches ein kleiner, eiserner Pfeifenkopf reingedrückt, mit Tesafilm befestigt und abgedichtet. Aus der Schublade nahm er ein zusammengeknülltes Stück Papier, das er auf seinem Bauch behutsam auseinanderfaltete. Von dem Tabak darin stopfte er eine geringe Menge, die zwischen Daumen und Zeigefinger passt, in den Pfeifenkopf. Mit einem Feuerzeug in der Rechten setzte er die Flasche schräg an den Mund, zündete den Tabak an und sog währenddessen tief ein, so dass der Tabak erst langsam anbrannte, bis er glühte, um dann als Asche mit einem ffffffopp durch den Schlauch ins Wasser zu fallen. Den Rauch behielt er eine Weile in seinen Lungen, bevor er ihn mit einem kräftigen Stoß in die Luft blies wie eine Dampflokomotive. Er hustete fürchterlich. Nachdem er sich beruhigt hatte, starrte er einen Moment lang verträumt an die Wand. Dann drehte er sich zu mir um. Ich schüttelte den Kopf.
„Dis Hashish“, flüsterte er mit verschwörerischem Blick. Auffordernd hob er die Pfeife in meine Richtung. „Dis good“, bestätigte er, das sei gut.
Ich wollte trotzdem nicht, schaute aber interessiert zu.
Er nahm noch einen kräftigen Zug. „I work bakery.“
Also sprach er doch ein wenig Englisch, wenn auch gebrochen. In einer Bäckerei arbeitet er. Morgens muss er sehr früh aufstehen, abends bringt er frisches Brot mit nach Hause.
Als er seine Hand auf meine Schulter legte, wusste ich sofort, was er von mir wollte, schüttelte den Kopf, legte seine Hand zurück und sagte entschieden: „No!“
Er zuckte mit den Achseln, verzog sein Gesicht, legte sich auf die Seite und schlief ein.
Am Morgen war er weg. Barfuß tapste ich durch die Wohnung. Im Wohnzimmer stand nichts außer einem Stuhl und einem runden Tisch mit überfüllten Aschenbechern und ein paar benutzten Gläsern, teilweise noch gefüllt mit einer orangefarbenen Flüssigkeit. Limonadeplastikflaschen auf dem Fußboden verstreut, Decken und Schlafsäcke auf den Fliesen, wer mochte hier wohl schlafen?
„Dis my workers“, löste Nachum später das Rätsel. Die Arbeitskräfte der Bäckerei schliefen bei ihm. „Dis my bakery.“ Es war seine Bäckerei. Er war der Chef und seine Leute schliefen bei ihm im Wohnzimmer auf dem Fußboden. In Deutschland unvorstellbar.
Die Jalousien waren heruntergezogen, Fenster leicht geöffnet, eine Klimaanlage rauschte leise, alles war friedlich still.
Die Geräusche, die von der Straße zu mir hereindrangen, lockten mich raus. Ich wollte hinein in das Leben da draußen, neue Sachen entdecken, Dinge kennenlernen, von denen ich vorher nichts ahnte, mir alles angucken, war neugierig auf jeden Menschen, auf jede Begegnung, wollte wissen, wie sie leben, wollte erleben, dass es anderes gibt als das, was ich kannte und dass anderes auch funktioniert. Ich wollte in ihre Häuser und in ihre Köpfe hinein, ihre Lebensweise und ihre Mentalität ergründen.
Jeden Tag zog ich in die Stadt, an den Strand, beobachtete Menschen, was sie ausstrahlten, wie sie sich gaben. An jedem Tag redete ich mit mehr Menschen über Gott und die Welt als in Deutschland in einem ganzen Jahr. Ich sprach mit jedem, der mit mir sprach und ging auch mit jedem mit.
Begeistert nahm ich die Einladung eines älteren Mannes an, mir die Timna-Säulen draußen in der Wüste zu zeigen, entzückt von der Vorstellung mit einem Auto in die Wüste zu kommen, weg von der geteerten Piste die kleinen Sandwege entlang zwischen die Felsen in ein Wadi zu fahren.
Da der Mann keinerlei Englischkenntnisse besaß, lernte ich meine ersten hebräischen Worte und stellte fest, das Erlernen einer Sprache ist am leichtesten beim Leben in dem entsprechenden Land. Ich merke mir die Wörter automatisch, weil ich sie im lebendigen Kontext erfahre statt aus dem Buch.
Knapp dreißig Kilometer in die Wüste rein hielt er vor den monumentalen Steinsäulen und stellte den Motor ab. Wir stiegen aus, waren allein hier, fernab jeglicher Zivilisationsgeräusche. Um uns herum nur Steine und Felsen, über uns der wolkenlose, strahlend blaue Himmel. Kein Lüftchen regte sich. Totenstille. Das Gleißen der Sonne, diese Helligkeit, das bloße Bare vereinnahmten mich. Mit Leib und Seele spürte ich das Wesen der Wüste, tauchte förmlich darin ein. Ihre Stille rührte die Stille in mir an. Ihre Helligkeit rührte die Helligkeit in mir an. Ihre Bloßheit rührte die Bloßheit in mir an. Dies Stück karger, elementarster Natur warf mich auf mich selbst zurück, auf mein nacktes Dasein. Die Wüste lenkt mit nichts ab, macht die essentiellen Bedürfnisse des Menschen wieder bewusst. Essen. Trinken. Schlafen. Auf Toilette gehen. Und atmen.
Ich bekam nicht genug vom Leben, streifte Tag und Nacht durch den Ort, an die Strände, in die Diskotheken, um am frühen Morgen die weiße Sonne hinter den jordanischen Bergen aufgehen zu sehen.
Im Sommer ist es in der Wüste durchgehend heiß, selbst nachts kühlt es nicht ein Grad ab. Das macht die Nächte fast unwirklich. Der heiße Wüstenwind weht tagsüber nahezu ununterbrochen, zum Sonnenuntergang beruhigt er sich meistens.
Weiterhin suchte ich ein Zimmer zur Miete, fragte jeden, den ich kennenlernte, nach einem Hinweis.
Ja, da hätte jemand ein Zimmer für mich im Haus seiner Schwester. Sein Name war David.
Am darauffolgenden Tag packte ich meinen Rucksack, verabschiedete mich von Nachum und lief zu Davids Haus.
Der wollte abends mit mir zu seiner Schwester fahren. Zwischenzeitlich bot er mir einen Drink an. Wir quasselten auf Englisch über alles Mögliche, bis er kurzerhand entschied, Tanzen zu gehen, seine Schwester sei noch nicht da.
Gegen morgen kamen wir zurück. Er bot mir seine Wohnzimmercouch zum Schlafen an, wir würden morgen zu seiner Schwester fahren. Ich legte mich hin, er ließ mich in Ruhe.
Anderntags setzte er mich auf dem Weg zur Arbeit am Strand ab. Wir verabredeten uns abends in seiner Wohnung.
Er war schon da, als ich kam, sagte, er hätte mit seiner Schwester telefoniert und die hätte leider doch kein Zimmer frei, es täte ihm leid, ich könne weiterhin auf seiner Couch schlafen, bis ich etwas anderes gefunden habe.
Also machte ich mich wieder auf die Suche, fragte jeden Taxifahrer, jeden Kioskbesitzer, jeden Bademeister. Niemand wusste etwas, doch alle versicherten mir, dass es nicht schwierig sei, in Elat ein Zimmer zu finden, es gäbe immer eines, nur in Stoßzeiten sei es schwierig.
Zu Festen wie Pessach, das Fest des ungesäuerten Brotes, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, kommen so viele Israelis aus dem Norden nach Elat, dass nicht nur jedes Zimmer, sondern jedes Bett belegt ist. Ein einzelnes Bett wird für hundert Dollar vermietet. Bewohner von Elat ziehen teilweise für diese eine Woche zu Verwandten in den Norden, um ihre Betten zu vermieten. Kein Mensch in Deutschland würde auf die Idee kommen, sein Bett zu vermieten, aber hier ist alles anders.
Von irgendwoher hatte ich auf einmal eine Telefonnummer in der Hand. Es hieß, eine junge Mauritierin möchte ihr Zimmer aus finanziellen Gründen mit jemandem teilen.
Nach mehreren Versuchen sie zu erreichen, hatte ich Glück.
Sie arbeitete in einem der Hotels und teilte sich mit einer Arbeitskollegin ein Zwei-Zimmer-Apartment.
In ihrem Zimmer gab es zwei Matratzen und einen Schrank. Um Platz zu schaffen, würden die Matratzen tagsüber aufrecht an der Wand lehnen. Küche und Bad werden gemeinschaftlich genutzt. Zweihundert Dollar wollte sie dafür haben. Ich stimmte zu und zog sofort bei ihr ein.
Wir sahen uns nur selten, sie arbeitete viel, ich war Tag und Nacht unterwegs. Trafen wir zusammen, fragte ich sie aus über das Leben auf Mauritius, einer Insel im Indischen Ozean, östlich Südafrikas. Nie zuvor hatte ich einen Menschen aus Mauritius kennengelernt und noch nie hatte ich diese Hautfarbe gesehen.
Zwei Wochen wohnte ich bei ihr, bis sie kundgab, dass ihr finanzieller Engpass vorbei sei und sie ihr Zimmer wieder für sich haben möchte, es sei doch etwas eng für zwei Personen. Aber ich könne selbstverständlich bleiben, bis ich was gefunden habe.
Wieder auf der Suche nach einer Bleibe.
Trampen war damals in Israel üblich. Als besondere Ehre galt es, Soldaten mitzunehmen. Soldaten gehörten zum Alltag, sie gingen überall Patrouille, in der Einkaufszone, auf der Straße, sogar am Strand. Gelegentlich sah man einen Soldaten und eine Soldatin Hand in Hand gehen, jeder ein Gewehr über dem Rücken, beide leicht bekleidet, oder beim Engtanz in der Diskothek, eng umschlungen, beide bewaffnet. Sie haben den Partner und die Waffe im Arm, scheinbar selbstverständlich. Wenn sie im Dienst sind, legen sie das Gewehr nicht aus der Hand. Sie sind überall und immer im Dienst. Wo sie auftauchen, verbreiten sie ein Gefühl von Sicherheit und Schutz. Sie haben ihre Augen nach allen Seiten ausgerichtet und sind umfassend ausgebildet. Wenn nicht gerade im Einsatz, sind sie mehr als der gute Polizist, Freund und Helfer. Sie sind Sanitäter, Transporteure, Mechaniker, fragen weder nach Geld noch nach Papieren. Sie helfen, wo Hilfe gebraucht wird, bringen das alltägliche Leben an der Stelle in Gang, wo es stockt inmitten der Bevölkerung, sodass ich mich hier sicherer fühle als in Deutschland. Kinder werden besonders beschützt. Jeder Erwachsene fühlt sich für jedes Kind verantwortlich. In Friedenszeiten sind alle froh, dass Frieden ist. Sie sind pragmatisch, denken und handeln nah am Leben. Der Friede scheint hier besonders friedvoll.
Ich gewöhnte mir an, zur Arbeit zu trampen, mit meinem Keyboard unterm Arm, das Raffi netterweise aus Haifa abgeholt hat. Meistens nahmen Männer mich mit, die mein Instrument vorsichtig in den Kofferraum hoben. Sie wollten wissen, wer ich bin, kannten mich nicht am Ort. Ich radebrechte mein erstes Hebräisch über meinen Namen und meine Herkunft, nutzte jede Möglichkeit, Hebräisch zu verstehen oder zu sprechen. Ich war hier die Sängerin der La’akat ha’or, der Band des Lichts. Jeder kannte die Band. Sie war sehr angesehen. Meist trugen die Männer, die mich mitgenommen hatten, mein Keyboard stolz bis zur Bühne und einige von ihnen kamen abends elegant gekleidet zur Show.
Ein vornehmer Herr lud mich ein, spontan Gast auf seiner Yacht zu sein, er würde sie mindestens zwei Wochen lang nicht brauchen und stelle sie mir zur Verfügung.
Ich willigte sofort ein und zog am nächsten Tag um auf seine Yacht.
Sein Neffe erwartete mich dort. Er machte klar Schiff, die letzten Arbeiten an Bord, gab mir einen Zettel mit der Telefonnummer seines Onkels Benni, dem die Yacht gehörte, und verschwand.
Nun wohnte ich auf einer Yacht. Ein Platz für meinen Koffer, einer für mein Keyboard und ein Schlafplatz für mich!
Von hier aus ging ich zur Show oder an den Strand, hierhin kehrte ich müde vom vielen Herumlaufen zurück. Hier war jetzt mein Zuhause.
Raffael kam nach einem Auftritt mit einer Beschwerde zu mir, ganz aufgebracht: „Du bist mit Arabern am Strand gesehen worden. Das geht nicht. Du bist Mitglied meiner Band und darfst dich nicht mit Arabern abgeben.“
„Welche Araber meinst du?“
„Na, diese Jungs, irgendwelche Jungs, Araber eben. Du bist gesehen worden“, warf er mir vor.
„Raffi“, vertraute ich ihm an, „ich weiß nicht mal, welcher von euch Araber ist und welcher nicht. Für mich seht ihr alle gleich braun aus.“
Verständnislos guckte er mich an. „Du siehst keinen Unterschied zwischen Israelis und Arabern?“ Den Kopf schüttelnd zischte er pfeifend Luft durch die Zähne. „Die sehen doch komplett anders aus. Wenn du das nicht siehst, hast du ein Problem. Lös es! Und gib dich nicht mit Arabern ab!“, befahl er scharf und ging.
Unerhört. Ich darf nicht sprechen, mit wem ich will? Ich bin schließlich Deutsche und muss Araber nicht ablehnen. Für mich sind sie genauso Menschen wie Israelis. Ich kann sie ja nicht mal auseinanderhalten, es sei denn, sie tragen ein Arafat-Tuch. Ansonsten kann ich keinen Unterschied feststellen. Alle haben dunkle Haut, dunkle Augen und sprechen eine mir unbekannte Sprache. Erst später lernte ich sie zu unterscheiden anhand ihrer Ausstrahlung, ihrer Art sich zu bewegen, ihrem Aussehen.
Meine Neugier allerdings überwog meinen Gehorsam, und so ließ ich mich auf den schmächtigen Tommy ein. Obwohl Araber, war er nicht Moslem, sondern Christ, mit einem unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus. Jesus war sein Lieblingsthema.
Tommy wirkte ganz verloren hier. Adoptiert wie ich, fühlte er sich auch genauso an. Noch nie hatte ich ein ausländisches Adoptivkind kennengelernt. Da gibt es etwas, das sich nur bei Adoptivkindern so anfühlt, und das ist offenbar unabhängig von Rasse oder Religion.
Selbstverständlich begleitete ich ihn zur christlichen Herberge, sprach mit dem holländischen Pastor, begegnete Christen aus aller Welt, sang und betete mit ihnen, um herauszufinden, ob in dem Glauben, in dem sie ihr Heil gefunden haben, auch für mich das Heil liegen könnte.
Natürlich ging ich auch mit in sein Zuhause. Er lebte zusammen mit mehreren Hotelarbeitern in einem Raum oben über einer Ladenzeile; das Zimmer abgedunkelt, auf den Betten der Kameraden Kleidungsstücke, alles etwas heruntergekommen, aber weitestgehend ordentlich. Einer der Jungs war anwesend.
„Dies ist Marlisa. Das ist Jim aus England. Er ist mein bester Freund, das musst du wissen, Marlisa.“
Er stellte einen schmalen Tisch zwischen zwei Betten. „Sitz“, forderte er mich höflich auf und zeigte mit der flachen Hand auf das eine Bett, „ich mache uns einen Tee."
Der untersetzte, kräftige Jim holte von irgendwoher eine Kerze. „Gib mir dein Feuerzeug!“
Ich kramte mein Feuerzeug hervor.
Europäer fühlen sich irgendwie vertraut an.
Jim erhitzte das Ende der Kerze und ließ das flüssige Wachs auf den Holztisch tropfen.
„Leg doch was drunter“, riet ich ihm typisch deutsch.
„No, no, das ist okay“, erwiderte er ruhig, drückte die Kerze in das Wachs und zündete sie an. Dann machte er sich daran, eine Zigarette aus seinem losen Tabak zu drehen.
Der Schein der Flamme tauchte den Raum in warmes Licht.
„Also, Marlisa, für wie lange bist du hier?“, fragte der blonde Jim.
„Ich weiß nicht.“
„Ja ja, wir wissen nie, wohin Gott uns führt.“
Tommy kam mit dem Tee herein. „Ich wünschte, ich wäre in England. Ich träume jeden Tag davon, in England zu sein“, schwärmte er, während er die kleinen, dampfenden Gläser mit dem Goldrand auf dem Tisch abstellte.
„Warum?“, wollte ich wissen.
„England ist mein Traumland. Ich würde dort gerne für immer wohnen. Ich bete zu Gott, jeden Tag. Ich bete, dass ich dort studieren darf.“ Ganz beseelt von dem Gedanken leuchteten seine schwarzen Augen von innen heraus.
Ich nippte an meinem Tee. „Mmmh, schön süß.“
„Auf die Süße des Lebens“, prostete Tommy uns zu. „Wir brauchen die Süße des Lebens wie die Biene den Nektar.“ Er beugte sich ein wenig zu mir vor. „ Und du, Marlisa, was betest du?“
Die Frage überraschte mich.
„Ich will für dich beten. Jim, wollen wir für sie beten? Für ihre Seele?“
„Ja, gerne. Nur noch meine Zigarette aufrauchen.“
„Lass dir Zeit.“ Er schaute in meine Augen. „Marlisa hat bis heute Zeit gehabt. Gott hat auf sie aufgepasst.“
Jim rauchte auf und faltete seine Hände. Auch Tommy faltete seine Hände. Tiefe Ergriffenheit machte sich breit.
So etwas erlebte ich zum ersten Mal. Jemand betete für mich. Kein Pastor, sondern ganz gewöhnliche Menschen. Tommy sprach leise und inbrünstig. Sie beteten für meine Gesundheit, mein Wohlergehen, auf dass ich die Wege, die vor mir liegen, klar erkennen und mutig beschreiten würde und dass Gott mich von der Last meiner Einsamkeit befreien möge.
Tränen drückten von innen durch meine geschlossenen Augenlider, ich ließ ihnen freien Lauf. Feierlicher hätte es in keiner Kirche dieser Welt zugehen können, als hier in diesem Arbeiterzimmer mit Menschen, mit denen ich nicht reden sollte.
Nachdem er fertig gesprochen hatte, schniefte ich noch einen Moment.
„Danke“, sagte ich schlicht und ging raus, das Bad suchen.
„Links“, hörte ich Tommys Stimme.
Ich fand, was ich suchte.
Auf der Toilette putzte ich mir die Nase. In das Spülen hinein vermeinte ich plötzlich Stimmen zu hören. Ich betrat den Flur. Die Stimmen wurden lauter. Wird da gestritten? Als ich die Tür zum Zimmer öffnete, sah ich Tommy mit einem Messer über Jims Hals fahren. Jim schnellte zurück.
„Bist du verrückt geworden?“, brüllte er erschrocken auf.
Tommy stand in Kampfhaltung vor Jim und keuchte. „Nein! So nicht, mein Freund!“
Jim war in die Ecke auf das Hochbett geflüchtet.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Vor Schreck schlug mein Herz bis zum Halse. Hatten diese beiden nicht eben noch für mich gebetet?
Tommy legte das Messer auf den Tisch. „Bist du okay?“, fragte er Jim.
Der wischte sich mit der Hand über den Hals. „Fuck, man, ich blute.“
Tommy war sofort bei ihm. „Komm.“
Jim wehrte mit der sauberen Hand ab. „Ist schon gut, schon okay. Mir ist nichts passiert.“
Tommy klopfte ihm auf die Schenkel. Jim klopfte Tommy auf die Schulter.
Verständnislos guckte ich von einem zum anderen. „Was …?“, begann ich.
Jim hob abwehrend die Hand. Er wollte kein Wort darüber verlieren.
Die Verwirrung dieser emotionalen Wechselbäder in den Gliedern verließ ich die beiden.
Jim sah ich nie wieder.
Tommy und ich trafen uns ab und zu. Wir sprachen nie über diesen Vorfall, liefen in der Stadt umher, saßen irgendwo auf einer Mauer und sprachen über Gott und seinen Sohn.
Tommy war so zart, so mitfühlend. Ich hatte mich ein bisschen in ihn verliebt. Manchmal dachte ich sogar, ich würde ihn lieben. Obwohl er so anders war, war er irgendwie auch genauso wie ich. Ich fühlte etwas in ihm, das ich von mir selbst kannte. Das verband mich mit ihm.
Eines Tages gestand er mir, er hätte schon mal einen Menschen getötet.
„Im Krieg“, unterstellte ich.
„Nein, nicht im Krieg. Im normalen Leben.“
„Das glaube ich dir nicht.“
„Doch“, versicherte er, „es ist wahr. Ich habe ihm mit einer Sichel den Schädel gespalten. So.“ Er machte eine kräftig zuschlagende Bewegung in der Luft, sodass ich begann ihm Glauben zu schenken.
„Wieso hast du das gemacht?“
„Wir hatten Streit und er hatte es verdient.“
Ich schüttelte meinen Kopf. „Was sagt denn Gott dazu?“
„Der hat mir verziehen. Gott sei Dank.“
Ich staunte.
„Niemand weiß es“, verriet er mir, „es ist lange her, damals in Petach Tikva in Tel Aviv.“
Ich war erschrocken, nicht nur über Tommy, nein, auch über mich selbst. Liebte ich einen Mörder? Ging das überhaupt? Kann man einen Mörder lieben?
Für lange Zeit sah ich ihn nicht.
Ein knappes Jahr später erzählte mir jemand, Tommy sei zum Studieren in England. Ich freute mich mit seiner Seele.
Mit der Band kam ich in viele Hotels. Einer der Hotelchefs offerierte, bei ihm im Privathaus oben in der Stadt zu gastieren. Es war an der Zeit, die Yacht zu verlassen. So zog ich mit meinen Habseligkeiten ins Nobelviertel von Elat.
Spät abends kam der Chef von der Arbeit heim. Als erstes schaltete er den Fernseher an. Laut lief ein Film in englischer Sprache mit hebräischen Untertiteln. Sofort startete ich den Versuch, die Buchstaben der Hieroglyphen-Schrift zu identifizieren. Von rechts nach links erkannte ich mein erstes hebräisches Wort, das Wort ani, zu Deutsch ich oder ich bin. Im Deutschen gibt es ich separat von ich bin. Im Hebräischen sind ich und ich bin dasselbe, grammatikalisch wie inhaltlich, es gibt dafür nur ein Wort. Eine Person wird nicht getrennt von ihrem Sein. Das bedeutet, die Körper-Ebene und die geistige Ebene sind eine Einheit. Das fühlt sich richtig an und gut. Dadurch entsteht ein Gefühl von Verbundenheit. Mit allem. Mit allem Sein.
Auf einmal tätschelte der Hotelchef meine Wange. Verlangend drehte er sich zu mir hin.
Eindeutig schüttelte ich den Kopf.
Er verließ das Zimmer, nahm seinen Schlüssel vom Tisch und ging ohne ein Wort aus der Wohnung.
Ich sehnte mich nach eigenen vier Wänden.
Doch vorerst begegnete ich Zoltan, einem ungarischen Juden, der stolz erzählte, er sei gerade aus Europa gekommen, wo sie eine neue Oper uraufführten, Das Phantom der Oper, und er hätte davon sogar eine Aufnahme mit nach Israel gebracht.
Es bewegte mich, wie er von hier aus die fortschrittlichen Europäer betrachtete. Seinen Abstand zu den Europäern konnte ich nachfühlen. Dadurch bekam ich selber einen Abstand zu Europa, zu meiner Herkunft. Dieser Abstand eröffnete mir eine neue Sicht auf die europäische Kultur und ihren Zusammenhang mit anderen Kulturen. Dies eröffnete mir eine neue Sicht auf mich selbst innerhalb des Weltgefüges. Eine neue Identifikation kam hinzu, wo ich mich weder als Deutsche noch als Italienerin empfand, sondern als Europäerin, Vorstufe zur Weltbürgerin.
Zoltan war von Tel Aviv an das Rote Meer geschickt worden, um einen Bauauftrag zu leiten. Seine Firma hatte ihm vorübergehend ein Apartment zur Verfügung gestellt, zu groß, um es allein zu bewohnen. Ich bezog eins der leerstehenden Zimmer. Im Gegenzug kochte ich für ihn und machte den Haushalt.
Raffael wohnte nicht weit entfernt. Zum nächsten Auftritt sollte ich mit ihm zusammen fahren.
Im Fahrstuhl erteilte er mir den Befehl: „Du musst deine Beine rasieren.“
„Wieso?“
„Niemand hier hat unrasierte Beine, das sieht doch nicht schön aus“, urteilte er.
„Bei uns rasieren sich die Frauen ihre Beine nicht“, verteidigte ich mich. Damals war das so auf dem Lande.
„Du bist hier in Israel und es kann nicht angehen, dass Publikum zu mir kommt und mich darauf anspricht. Also mach dir die Haare ab!“
Man sah mir doch an, dass ich nicht Israelin bin, warum sollte ich mich so geben wie sie. Sie sollten lieber akzeptieren, dass eine Deutsche nun mal anders aussieht.
Ich sträubte mich, hatte aber wohl keine Wahl.
In einer der vielen Strandbars stand Raven hinterm Tresen, ein beleibter Australier mit langen, dünnen Haaren und Tätowierungen auf seinen massigen Oberarmen.
Spontan fragte ich ihn: „Ich suche eine Wohnung, weißt du irgendwas?“
„Ja, mein Mitbewohner zieht demnächst aus, um nach Thailand zu gehen. Du kannst das Zimmer haben, so lange du willst, ich bin sowieso nur zum Schlafen da.“
Drei Wochen später zog ich bei Raven ein in ein kleines, gemütliches Zimmer im letzten Wohnblock am Rande der Siedlung. Vor meinem Fenster erstreckte sich die Wüste bis zum Horizont. Herrlich. Wundervoll. Monatelang umhergezogen, hier und da gewohnt. In fünf-sechs-sieben, so lautete meine neue Adresse, durfte ich endlich bleiben.
Ich war glücklich über mein neues Zuhause und glücklich mit meiner Arbeit! Im Abendkleid auf einer Hotelterrasse Musik machen, am Strand, in halboffenen Bars oder Clubs zum Tanz aufspielen ist mehr Vergnügen als Arbeit. Nach dem Auftritt geht man ins Rote Meer schwimmen oder fährt zum nächsten Treff.
Für Bulimie war seit meiner Ankunft in diesem Land keine Zeit geblieben, das Leben hatte mich zu sehr in Anspruch genommen. Ich wagte zu hoffen, dass es damit nun vorbei sei. Doch obwohl ich alles hatte, was ich mir vorstellen konnte, ein schönes Nest, wunderbare Arbeit, Wärme satt, Licht satt, Aufregung und Abenteuer ohne Ende, meldete sich dieser Zwang wieder. Warum nur? Was wollte ich noch? Was gab es denn noch zu wollen? Was braucht der Mensch, um in Harmonie mit sich selbst zu leben? Wonach sehnte sich meine Seele? Warum gab sie keine Ruhe?
Ich fand keine Antworten.
In meinem Zuhause gab es für mich nichts. Nichts zu tun. Nichts zu leben. Wenn ich keinen Auftritt hatte, lief ich einfach los durch den Ort Richtung Strand.
Oft kam ich gar nicht bis dahin.
Jemand hielt mit dem Auto neben mir.
„Hallo. Ich bin Mario. Ich war gestern Abend bei eurer Show. Spitzenmäßig! Ich bin gerade auf dem Weg in die Marina, unser kleiner Hafen. Wir wollen mit ein paar Freunden rausfahren aufs Meer. Willst du mit? Mein Freund Noam kommt auch mit. Er hat dich gestern Abend gesehen. Er möchte dich kennenlernen. Komm mit uns! Wir machen ein bisschen Party. Es gibt Trinken und zu Essen und Musik haben wir auch an Bord.“
Ich ging mit, lernte Noam kennen, fuhr anschließend mit zu Mario nach Hause, wo bis zum nächsten Morgen weitergefeiert wurde. Die ganze Nacht über kamen weitere Gäste. Ein dunkelbrauner Jossi mit schwarzem, krausem Haar redete und trank mit mir, bis er mich mittags nach Hause fuhr.
Künftig hielt Jossi jedes Mal an, wenn er mich im Ort sah, nahm mich mit zum Essen, Freunde besuchen oder mit in sein Haus. Auf seine Villa war er besonders stolz, er hatte sie selbst gebaut. Oben im Zimmer zur Dachterrasse rauchte er seine Wasserpfeife, während ich gebannt lauschte.
Jossi ist in Jemen aufgewachsen, am Fuße eines Berges, ohne fließend Wasser und Strom. Das einzige Fortbewegungsmittel war ein Esel, auf dem jedoch nur der Vater reiten durfte.
„Ich hatte nicht einmal Schuhe“, erzählte er, „ich bin immer barfuß gelaufen. Als ich acht war oder elf, kam ein Reiter auf einem Pferd zu unserem Haus. Er sprach mit meinen Eltern. Daraufhin packten sie ein paar Sachen zusammen und gingen mit mir in das nächste Dorf. Dort war wieder dieser Reiter. Er hatte ein Sprachrohr. Er sammelte Menschen ein. Wir gingen weiter zum nächsten Dorf. In jedem Dorf schlossen sich uns mehr Leute an. Ich fragte meine Eltern, wo wir hingingen, meine Mutter sagte: ,Nach Israel’. Ich wusste nichts von Israel. Ich hatte ja nicht einmal gewusst, was hinter dem Berg vor unserem Haus ist.“ Jossi lachte. „Am Ende waren wir viele Menschen. Wir sind ein Jahr gelaufen, ein ganzes Jahr. Wir sind zu Fuß über das Gebirge gelaufen bis nach Aden. Plötzlich stand ich vor einem Wasser, das kein Ende hat, dem Meer. Darauf schwamm ein riesengroßes Haus. Da sollten wir alle reingehen. Ich wusste nicht, dass das ein Schiff ist, ich hatte nie eins gesehen. Ich ging mit den anderen auf das Schiff und fuhr über das Meer. Als wir in Israel ankamen, sah ich zum ersten Mal Autos, Flugzeuge. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Meine Mutter kommt bis heute nicht damit klar. Sie lebt abgeschieden in einem kleinen Apartment in der Nähe von Tel Aviv und geht nur raus, wenn sie muss. Bis heute backt sie ihr Brot selber. Ich habe heute mehrere Häuser, meine eigene Baufirma, fahre Auto, alles. Aber eines ist aus der Zeit geblieben. Wenn du mir heute erzählst, ich kann zum Mond fliegen – ich würde es glauben. Alles ist möglich. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist machbar.“
Jossi war ein Mensch aus der Steinzeit in die Neuzeit versetzt, ein Verbindungsglied zwischen Urzeit und heute. Intuitiv suchte ich bei ihm nach altem, überliefertem Wissen, was der Modernen verlorengegangen ist. In Jossi sah ich eine Chance, die Verbindung zu meinem eigenen Ursprung zu finden. Wir philosophierten über das Dasein, das Menschsein, die Religion, Gott.
Die Gespräche waren hochinteressant, bewirkten jedoch keine Veränderung in mir. Nach wie vor konnte ich nicht normal essen, meine Wohnung nicht mit Leben ausfüllen, nur nutzen, um dort ungestört ins Klo zu spucken und anschließend in Schlaf zu fallen.
Zum kleinen Hafen zog es mich immer wieder hin. Meine besondere Liebe galt den vielen Holzschiffen, gebaut wie die alten Piratenschiffe, die ich aus Filmen meiner Kindheit kenne. Auf jedem Boot wohnte ein Skipper, der das Schiff bewachte, in Stand hielt und für Cruises vermietete, Mini-Kreuzfahrten. Zehn, zwanzig oder mehr Personen werden vier Stunden lang hinaus aufs Rote Meer gefahren, entlang der jordanischen Grenze bis kurz vor das ägyptische Gewässer. Nach dem Schnorcheln und Tauchen gibt es Essen. Ein Barbecue-Grill hängt außenbords. An Deck steht ein einladender Tisch mit Chumus, Pita, Salaten und verschiedenen Weinsorten. Lautsprecher hängen in den Masten, auf dem Kajütsaufbau wird getanzt und gesungen.
Das möchte ich gerne mal miterleben.
Ein Skipper rief mir zu, ich solle doch an Bord kommen.
Beschwingt ging ich auf das Schiff. Mit Englisch und meinem noch geringen Wortschatz Hebräisch verständigte ich mich blendend. Wir sprachen über Land und Leute. Freunde kamen, tranken Tee, gingen wieder. Gegen Abend erschien der Bootsbesitzer in Begleitung einiger Kumpane. Einem zuvorkommenden Herrn namens Salomon hatte ich es besonders angetan. Mehrfach in Deutschland gewesen, sprach er ein paar Brocken Deutsch.
„Besuch mich morgen in meinem Büro“, lud er mich ein.
Die Männer rauchten Haschisch, wie ich es schon bei Nachum gesehen hatte. Sie boten mir die Wasserpfeife an. Ich lehnte ab, sie redeten mir zu, bis ich beschloss, die Erfahrung zu machen, was es damit auf sich hat – zog und musste ordentlich husten. Lustig wurde ich. Bald lachte ich, ohne zu wissen worüber. Die Männer hatten ihren Spaß. Erinnerten sich an die Zeit, als sie das erste Mal rauchten und auch so viel lachen mussten. Einer sagte: „Ich wünschte, ich könnte auch noch mal so schön stoned sein wie du. Aber ich rauche jetzt seit vierzig Jahren jeden Tag, da wird man nicht mehr so stoned. Körper und Geist gewöhnen sich daran.“ Wieder und wieder reichten sie mir die Pfeife, amüsierten sich königlich, wie ich zunehmend die Kontrolle über mich verlor.
Weit nach Mitternacht sagte Salomon, er würde mich jetzt nach Hause fahren. Wir verließen das Schiff. Leicht schwankend redete und lachte ich überschwänglich laut.
Umsichtig nahm er mich beiseite, flüsterte: „Nicht jeder muss wissen, dass du geraucht hast. Sei einfach ganz normal. Hast du das Gefühl, du zitterst? Zittern deine Hände?“
„Ja.“
„Nimm deine Hände hoch und schau sie dir an.“ Einfühlsam wartete er ab, bis ich es tat. „Siehst du? Deine Hände zittern nicht. Außen bist du ganz ruhig, nur in dir drin fühlt es sich wie Zittern an. Trag nicht dein Inneres nach außen, bleib nach außen hin ganz normal, niemand muss um dein Inneres wissen.“ Wohlwollend brachte er mich nach Hause.
Ich war perplex. Nie hatte ich mir so direkt Gedanken gemacht über innen und außen. Aber jetzt konnte ich den Unterschied ganz deutlich fühlen, als hätte ich mich neu entdeckt.
Von nun an traf ich ihn häufiger. Mein erster Gast, den ich zu Hause empfing, seit ich in diesem Land wohnte. Bei ihm beklagte ich mich darüber, dass ich meine Beine rasieren sollte.
Ruhig und fürsorglich wie ein Vater sprach er zu mir: „Kennst du das Sprichwort: Wenn du in Rom bist, sei ein Römer?“
„Nein.“
„Es ist wahr. Wenn du irgendwo fremd bist, ist es besser für dich, so zu sein wie die Menschen, die dich umgeben. Du wirst sonst Schwierigkeiten haben, und das ist nicht schön. Hier rasieren sich alle Frauen die Beine, also tu es einfach auch und du hast kein Problem.“
Salomon wurde mein Freund und Ratgeber in allen Lebenslagen. Er ist Beduine, lebensnah, einfach und menschlich. In seiner Gegenwart fühlte ich mich anders als mit jedem anderen Menschen auf der Erde. Salomon strahlte etwas ganz Bestimmtes aus, das ich nicht in Worte fassen konnte. Unendlich viele Geschichten aus aller Welt hatte er zu erzählen, gespickt mit allgemein gültigen Wahrheiten.
„Weißt du, die Menschen haben was Gutes und was Schlechtes in ihrem Leben. Dann gehen sie fort, weil sie das Schlechte nicht mehr wollen. Am nächsten Ort finden sie wieder Gutes und Schlechtes. Sie gehen wieder weg, sie wollen nur Gutes, aber sie finden immer wieder auch Schlechtes. Die meisten wissen nicht, dass es in ihnen drin ist. Jeder Mensch hat Gut und Böse in sich, das sind Himmel und Hölle oder Gott und Teufel oder die helle und die dunkle Seite. Wichtig ist, welche Seite dich gerade regiert. Tust du gut, kommt gut zurück, tust du schlecht, kommt schlecht zurück. Manchmal tust du gut und kommt schlecht zurück, dann hast du dir dein Gegenüber vorher nicht richtig angeschaut.“
Niemand hat je so zu mir gesprochen.
„Fehler musst du machen, wie willst du sonst lernen? Du hörst nie auf zu lernen. Und der Witz ist, am Ende sterben wir doch alle dumm. Ja! Egal wie viel wir lernen und schon wissen, es ist immer nur ein Bruchteil dessen, was es überhaupt zu wissen gibt. Was wir nicht wissen“, mit seinem Arm machte er eine weltumfassende Bewegung, „bleibt immer viel mehr als das, was wir schon wissen“, ehrfürchtig beugte er sich zu mir herüber und senkte die Stimme, „verstehst du? Am Ende sterben wir alle dumm. Selbst, wenn du denkst“, er fing an zu lachen, ließ sich in die Lehne fallen, „selbst wenn du denkst, du bist der verrückteste Mensch auf der Welt, kannst du sicher sein, es hat schon mal jemanden gegeben, der war verrückter als du.“ Offen blickte er mich an. Ich fühlte mich verstanden und erleichtert. „Für dich ist es neu, es ist aber schon vor dir da gewesen, du hast es nur bislang nicht mitbekommen. Alles war vor dir da.“ Das Gesicht verziehend hob er die Achseln. „Was? – Dachtest du, du wärst so groß?“, blies den Rauch gen Himmel und schaute ihm nach. „Ich muss in den Sinai“, schwenkte er um. „Ich fahre mit Shimon und zwei australischen Mädchen, May und Hazel. Ich habe einmal ein Boot gebaut, ein kleines Boot. Da war ich noch jung. Ich habe es mit meinen eigenen Händen erbaut.“ Stolz formte er mit seinen Händen ein Boot mit einem kastenförmigen Aufsatz in der Luft. „Es war mein erstes. Mit einem kleinen Motor, weißt du? Damit bin ich immer aufs Rote Meer zum Fischen gefahren. Das ist der beste Platz der Welt. Wenn du einfach weg willst von allem und deine Seelenruhe haben, dann fahr hinaus aufs Meer, geh fischen. Und abends, wenn die Sonne hinter die Felsen sinkt und sich das leuchtende Rot über das Meer und die Berge ergießt“, seine Stimme wurde bedächtig, „legt es sich auch über deine Seele.“ Hingabevoll strich er sich über die Brust. „Das ist Balsam für deine Seele. Du fühlst die Allmacht Gottes“, setzte er ehrerbietig hinzu.
Endlich sprach jemand das aus, was ich in mir wahrnahm. Man kann eine höhere Macht spüren, von der Natur bis zum Universum. Die Gegenwart einer namenlosen Macht ist fühlbar!
Wenn Salomon über Seele und Bewusstsein redete, dachte ich über kein Problem nach, war im Jetzt, war dabei, wach, präsent. Es waren Bewusstseinszustände, nach denen ich mich sehnte, keinerlei äußeren Dinge.
Salomon fuhr mit mir ein paar Kilometer außerhalb des Ortes auf den nahe gelegenen Berg Mount Joash. Oben angekommen stiegen wir aus, hielten die Nasen in den herrlich warmen, samtigen Wind, wie er nur in der Wüste zu finden ist. Der prächtige Überblick über den Negev und den Sinai, das Rote Meer, die Berge Jordaniens und die Küste Saudi-Arabiens verschlug mir den Atem. Dieses wundervolle Felsengebirge mit seinen Farbstrukturen in rot, braun, grau, beige, wie es sich über Millionen von Jahren übereinander schichtete und auftürmte, ist grandios. Pure, gewaltige Schönheit drückt einem die Brust zusammen. Man kommt sich so unendlich klein und unwichtig vor. Kraftvoll und still stehen die Felsen da in ihrer Unumstößlichkeit. Und wie weit sie sich erstrecken. Sehnsucht zog durch mein Herz. Ich wünschte ein Vogel zu sein, hier rüber zu fliegen, ein Beduine zu sein, durch ein ausgetrocknetes Flussbett zu wandern. Wie sich das wohl anfühlen mag, außerhalb der Zivilisation zu leben?
Von hier oben überblickte ich einen ziemlich großen Teil des Globus. Das nackte Gebirge durchzieht mehrere Länder, felsig, hart und wunderschön. Wie das Leben. Selten hatte ich mich so wohl gefühlt mit mir selber. Die Wüste versetzte mich in Meditation und Faszination, Zustände, nach denen mich dürstete. Salomon erging es ebenso. Meditation und Faszination zu teilen ist umso unglaublicher.
„Lass uns gemeinsam in den Sinai fahren“, schlug er vor.
Es wurde der Tausendundeine-Nacht-Trip.
Die Grenzkontrollen nahmen einige Stunden in Anspruch. Besonders auf ägyptischer Seite waren die Kontrolleure misstrauisch und angespannt. Zwischen Zoll-Häuschen und Pass-Häuschen schickten sie uns hin und her, um etwas abzustempeln oder eine Gebühr zu kassieren. Ausgiebig durchsuchten sie unseren Wagen und den Kofferraum. Schließlich ließen sie uns passieren.
Noch nie war ich über Taba hinausgekommen. Jetzt konnte ich endlich sehen, wie es weitergeht. Schon immer wollte ich wissen, wohin die Wege führten, schon immer überall hinter blicken.
Traumhaft erstreckte sich vor mir die Wüste Sinai. Wie wundervoll es hinter jedem Felsen aussieht. Eine blaue Lagune, von hohen Felsen umschlossen, mit einem kleinen Durchgang zum Meer, leuchtete zu uns herüber.
Wir hielten an einem Aussichtspunkt mit Einblick in ein Wadi, das nur Einheimische als Weg erkennen, tranken Wasser und rauchten, bevor wir unsere Fahrt durch die Wüste fortsetzten. In meiner Vorstellung kletterte ich an jedem Felsen hoch, ritt in jedes Wadi hinein, flog durch jede Schlucht hindurch. Gebannt von dieser Landschaft, nahm ich sie in mich auf.
Jetzt wurde es spannend. Salomon fuhr vom Weg ab. Keine Ahnung, woran er sich orientierte. Auf schotterigem Boden durchquerten wir ein kleines Tal. Plötzlich drosselte er das Tempo. Ein Kind rannte neben dem Auto, ich weiß nicht, wo es herkam. Es trug ein T-Shirt und einen Lederrock, der von hier stammte, offensichtlich alte Handarbeit. Schuhe und Strümpfe hatte es keine. Seine Haare, wild und zerzaust. Über seinem Gesicht sowie seiner gesamten Erscheinung lag eine Staubschicht. Salomon fuhr nun ganz langsam. Die kleine Kinderhand wollte unbedingt das Auto anfassen. Schon lagen ihre Finger auf meinem heruntergedrehten Fenster. Große, braune, ungemein neugierige Augen blickten mich an. Vor einer Tuch überdachten Behausung hielten wir.
Fünf bis sechs Kinder waren mittlerweile um uns herum versammelt. Ich stieg aus dem Wagen. Das Mädchen hielt beharrlich die Tür fest. Ein Auto anzufassen war für sie ein Ereignis. Sie wird nicht häufig eins zu sehen bekommen. Ihre Augen blieben an dem roten Pfeil hängen, den ich mir in meine dunklen Haare hineingefärbt hatte. Dann wanderte ihr Blick zu meiner roten Feder, die ich als Ohrring trug. Mit meiner schwarzen Lederjacke, der schwarzen Lederhose und den roten Stiefeln erschien ich ihr wie jemand aus einer anderen Welt. Eine Weile beäugten wir uns, freundlich interessiert an dem Anderssein des anderen. Sie kannte nichts von meiner Welt, ich kannte nichts von ihrer. Doch etwas verband uns, machte uns gleich. Es war das Menschsein. Bittend hielt sie ihre Hand auf.
Die Kinder waren aufgeregt wegen unserer Ankunft. Wir waren eine Sensation in ihrem Leben, und sie in unserem. Salomon öffnete den Kofferraum, holte eine Unmenge Obst heraus. Gierig griffen sie danach. Äpfel, Bananen, Apfelsinen, wie lange hatten sie so etwas nicht gegessen, einige von ihnen sahen Früchte vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben.
Ein Beduine im langen, weißen Gewand kam auf Salomon zu, drückte ihn freundlich und herzlich, angenehm überrascht ob des spontanen Besuches. Sie kannten sich aus früheren Zeiten, als der Sinai noch zu Israel gehörte. Acht Jahre hatte Salomon im Sinai gelebt. Er wusste, wie sich die Kinder über Obst freuen würden, welches ihnen hier fehlt. Seine Fürsorge rührte mich.
Der Beduine wies uns einen Platz unter Palmen zu. Ein Leinentuch spendete zusätzlichen Schatten. Eine senkrecht in den Boden gerammte Matte aus geflochtenen Palmwedeln wehrte den Wind ab. Teppiche lagen auf dem Wüstensand sowie über angeschau-felten Rückenlehnen.
Drei Männer tauchten auf, setzten sich dazu. Salomon redete arabisch mit ihnen.
Der ihn zuerst begrüßt hat, offensichtlich der Hausherr, wies eine in Schwarz gehüllte, verschleierte Frau an, Tee zu kochen und Brot zu backen. Es waren noch mehr Frauen anwesend, aber sie setzen sich nicht zu uns, hielten sich abseits, warfen hin und wieder scheue, verstohlene Blicke herüber.
Ich war in eine echte Beduinenfamilie hineingeraten, hinterfragte mich, ob ich hier leben könnte, versuchte mir vorzustellen, wie sich das anfühlt, unter diesen Umständen zu leben, permanent draußen in der glühenden Sonne mit einem Minimum an Habseligkeiten. Oh ja. Etwas in mir sehnte sich geradezu nach dieser Kargheit, nach dieser Einfachheit des alltäglichen Lebens. Nur dem Klang des Windes oder dem Klang der Stille ausgesetzt sein, ein paar Menschen und ein paar Ziegen um dich herum, ansonsten endlose, wundersame Weite. Kommt man dabei nicht in seine Ruhe? Keinerlei Zerstreuung der Sinne durch Telefone oder Autogeräusche, kein Fernsehen, keine bunte, westliche Welt, nur Natur. Findet man nicht automatisch seinen Seelenfrieden, wenn man hier lebt?
Die Beduinenfrau kochte Tee in einem Blechtopf, der über dem Feuer hing. Sie hatte sogar genügend Gläser für uns alle, servierte den zuckersüßen Tee auf einem metallenen, orientalisch verzierten Tablett und zog sich zurück.
Salomon stellte uns vor. „Shimon aus Israel, Hazel und May aus Australien und Marlisa aus Deutschland, und das ist Moussa, mein Freund.“
Der zeigte sich sichtlich geehrt über Besucher von so weit her, schaute jedem von uns freundlich in die Augen.
Unterdessen hob die Frau ein paar Meter weiter ein Loch in der Erde aus und legte dürres Gezweig hinein, das sie mit einem Feuerzeug anzündete. Was macht sie bloß, wenn das Feuerzeug leer ist? Hier gibt es keinen Laden. Aber sie ist ganz ruhig. Sie wird es schon wissen. Aus Mehl und Wasser in einer Holzschale knetete sie einen Teig. Nachdem das Feuer zu Asche verglüht war, formte sie aus dem Teig einen Fladen, platzierte ihn direkt auf die Asche und bedeckte ihn mit Sand. Die noch heiße Asche erwärmte den Sand um sich herum und inmitten dieser warmen Stelle in der Erde buk der Teig. Was für ein Ofen! Aus nichts gemacht. Nach einer Weile grub sie das Brot aus, klopfte es sorgfältig ab und reichte es uns. Jeder brach sich ein Stück ab. Mmh, lecker! Dieser feurige, erdige Geschmack! Und überhaupt nicht sandig, entgegen meinen Befürchtungen. Wie herrlich natürlich diese Menschen doch lebten! Ich beneidete sie um ihre Schlichtheit. Sie waren nicht so eingeengt von Regeln und Gesetzen wie ein deutscher Bürger.
Gemeint hatte ich vor allem die geistige Überlastung, mit der ich jeden westlichen Menschen konfrontiert sah, unsere Vorstellung, dies und das und jenes zu brauchen, um leben, um glücklich sein zu können. Ich wollte frei sein von diesen selbst auferlegten Konzepten, von diesem Ballast, sehnte mich nach geistigem Abspecken, erkannte dies als eine der Wurzeln von Magersucht, die Sehnsucht nach einem Leben, in dem die Natur die Gesetze vorgibt, nicht der Mensch.
Wir verließen den Platz, nachdem reichlich die besten Segenswünsche für die weiteren Wege ausgetauscht waren. Was ich eben gesehen hatte, kannte ich nur von Auslandsreportagen aus dem Fernseher. In derart abgelegene Winkel kamen nur selten Weiße. Mir bewusst, dass ich etwas ganz Besonderes erleben durfte, befiel mich ein heiliges Gefühl. Einem inneren Impuls nachgehend drückte ich Salomons Arm.
„Danke, mein Freund, für dieses wundervolle Erlebnis.“
Ich spürte, dass er die Heiligkeit des Lebens ebenso empfand wie ich.
Zurück auf der Piste fuhren wir der Abendsonne entgegen.
Nach geraumer Zeit verkündete er milde: „Ich will euch etwas zeigen, einen schönen Platz, den ich irgendwann einmal auf einer Erkundungstour entdeckt habe.“ Ohne das Tempo zu drosseln, bog er links ab in die sandige Ebene hinein. Mitten auf offener Fläche hielt er an. Von hier aus marschierten wir zu Fuß Richtung Berge. Zielgerichtet ging er auf eine bestimmte Stelle zu, einen schmalen Felsspalt, der erst sichtbar wurde, wenn man direkt davor stand. Nacheinander zwängten wir uns hindurch in den Berg hinein.
Augenblicklich wurde es kühl. Im Gestein erkannte ich unter einem Vorsprung eine Art Arkadengang, dem wir folgten, an einer Lichtung vorbei, über zwei große Felsblöcke kletternd bis vor ein steinernes Tor, weniger als einen Meter hoch. In der Hocke schlüpften wir einer nach dem anderen hindurch und fanden uns in einer kegelförmigen Felsenhöhle wieder, groß wie ein Tipi, ein Indianerzelt. Durch ein kreisrundes Loch oben in der Spitze fiel das Himmelslicht herein, beschien die aalglatt geschwungene Rundung der Wand. Nur Wasser konnte Stein derart weich abtragen. Ablagerungsringe schimmerten in den verschiedensten Farben von rot bis orange, gelb, sandfarben, braun und viel rosa. In der Mitte der Höhle ragte ein schlanker Obelisk aus dem Felsboden heraus in die Höhe über die Öffnung hinaus und verband das Höhleninnere mit dem Himmel. Dieser Ort hatte etwas Mystisches an sich. Das Licht fiel in Säulen herab. Kein Lüftchen regte sich. Wo einst Wasser strudelte, herrschte heute diese unendliche Stille. Staunendes Schweigen ergriff uns. Dies war ein Tempel, eine Kirche, eine Moschee, ein heiliger Ort. Hier hatten sich die alten Weisen getroffen, um sich auszutauschen und zu beratschlagen, um zu beten und zu meditieren. Ihre Kraft ist immer noch präsent. Ich spüre, dass auch ich Weises in mir habe. Dass jeder von uns das hat. Und dass die Schwingung dieses Kraftortes diese weise Saite in mir antippt und zum Klingen bringt. Im Moment kann ich es fühlen. Sie beinhaltet eine grundlegende Achtung gegenüber Allem, was da ist. Gegenüber der gesamten Schöpfung. Gegenüber jedem Wesen. Vor allem gegenüber sich selbst. Es ist dieser erste Friede in der eigenen Seele, der sich erweitert auf den Nächsten und sich ausdehnt auf ganze Völker.
Plötzlich war ich sehr durstig, hatte vergessen, dass ich in der Wüste sehr viel mehr trinken muss als gewöhnlich, auch jetzt im Winter, wo es nachts sogar richtig kühl wird. Die Luft bleibt trocken. Ich erinnerte mich an Orits Worte über das Austrocknen und war froh, als wir wieder beim Auto ankamen, wo ich als erstes meine Wasserflasche an den Mund setzte.
„Wie ist das bei den Beduinen in der Wüste?“, wollte ich von Salomon wissen, „kommen die hier mal raus? Haben sie Freunde? Wie sieht ihr soziales Umfeld aus?“
„Natürlich haben sie Freunde, sie leben genauso wie wir. Nachts, wenn die Hitze des Tages sinkt, reiten sie los auf ihren Kamelen. Sie kennen hier jeden Winkel, so wie du die Straßen in dem Ort, wo du geboren bist. Sie wissen, an welchem Felsen sie wohin abzubiegen haben. Sie wissen, wer in der Gegend wohnt. Sie kennen sich alle untereinander. Sie haben ihre eigenen Gesetze.“
„Was für Gesetze?“
„Nimm diese Familie als Beispiel, die wir eben besucht haben, ja? Hast du den Baum gesehen? Wo das Zeltdach dran aufgehängt war? Sie haben sich ihren Platz zum Leben unter diesem Baum ausgesucht. Sie bleiben hier, bis ihre Ziegen in der ganzen Umgebung nichts mehr zu fressen finden. Oder sie haben andere Gründe weiterzuziehen. Jedenfalls packen sie alles, was sie auf der Weiterreise nicht mitnehmen wollen, in einen Ledersack. Den hängen sie an ein Seil in diesen Baum. Dann gehen sie los in der Gewissheit, hier noch Hab und Gut zu haben und jederzeit wieder einen Platz zum Bleiben. Der nächste, der sich mit seiner Familie unter diesem Baum niederlassen möchte, sieht den Sack hängen und weiß, dieser Platz ist besetzt. Also sucht er sich einen anderen Baum.“
„Er würde den Ledersack nicht abnehmen? Aus Neugierde? Oder um zu Stehlen?“
„Nein, so denkt man im Westen. Hier haben sie Respekt. Wo denkst du hin? Es sei denn, der Sack liegt am Boden, weil das Seil mit der Zeit von Wind und Sonne brüchig geworden ist. Dann weiß man, dass es schon eine sehr lange Zeit her sein muss, seit dieser Baum verlassen wurde, und dass die Familie wohl nicht mehr zurückkehren wird. Wenn das Seil gerissen ist, darfst du dich dort niederlassen und der Ledersack mitsamt Inhalt ist deiner. Sie würden es nicht wagen, der Natur nachzuhelfen. Sie selber haben einen Sack woanders in einem Baum hängen, meinst du, sie wollen, dass den jemand abnimmt? Nein nein, die Menschen hier sind friedlich. Sie haben ein hartes Leben.“
„Wovon leben sie denn? Sie brauchen doch auch mal Geld, um was zu kaufen, Kleidung, Gemüse, Mehl. Fahren sie mal in die Stadt? Wie kriegen sie die Sachen überhaupt hier her?“
„Sie leben nicht allein wie bei uns, sie leben in großen Sippen. Einer von ihnen hat immer einen Cousin oder einen Onkel oder vielleicht einen Bruder, der hat ein Auto und der fährt einmal in der Woche oder einmal im Monat nach Kairo oder er arbeitet in Kairo und kommt hin und wieder hierher und er weiß, was sie hier brauchen, weil er selber einmal hier gelebt hat. So oder ähnlich. Sie sind nicht einfach allein und verlassen in der Wüste. Sie brauchen Dinge aus der Stadt und es findet immer irgendwo ein Transport statt. Sie helfen sich alle gegenseitig, verstehst du? Anders könnten sie nicht überleben.“
Wie gerne würde ich in einer Sippe leben, angeschlossen an ein übergeordnetes System, das für mich sorgt. Hier zu leben müsste traumhaft sein. Nichts, was dich irritiert, nur Natur um dich herum, Weitblick, Klarheit. Im Vertrauen, dass du nicht verhungern oder verdursten wirst, sondern dass für genügend Nachschub gesorgt ist, weil du Familie hast, weil du Teil eines größeren Netzwerks bist. Mein Gott möchte ich gerne dazu gehören, so gerne möchte ich dazugehören! Die Sehnsucht, Teil eines in sich funktionierenden Kreislaufs zu sein, brennt in meiner Brust. Ich sehe doch, dass es so was gibt, also muss es auch für mich möglich sein. Seit jeher fühle ich mich als verlorenes Einzelwesen in dieser Welt. Beduinen fühlen sich bestimmt nicht als verlorene Einzelwesen, sie leben ein Herdenleben, sind miteinander verbunden, mit ihren Ziegen und ihrer Familie und der Erde. Liegt die Seligkeit im Zusammenleben? Sehen Beduinen nicht viel ruhiger und friedlicher aus als die Menschen in der Zivilisation? Nicht nur friedlicher, auch zufriedener, obwohl sie so viel weniger haben. Ist weniger mehr? Geht das bei uns im Westen nicht in die falsche Richtung? Ist die Richtung falsch oder ist der Westen falsch? Oder nichts von beidem? Wer oder was bestimmt überhaupt, wie die Welt ist? Hier haben sie alle denselben Glauben. Ist es das, was die Menschen ausgeglichen macht? Ihr Glaube? Wobei es einen richtigen und einen falschen Glauben nicht wirklich geben kann, nur verschiedene Arten und Weisen, ihn umzusetzen, friedvoll oder eben fanatisch.
Der Sinai nahm mich wieder gefangen. Die Teerpiste führte durch bezaubernde Felsformationen. Jede Kurve enthüllte Neues zum Bestaunen. Ein weit überstehender Felsvorsprung erschien wie eine Riesenechse, ein anderer wie der Kopf eines Adlers. Hellblaue Gesteinsschichten zeichneten sich in den Felswänden ab. Der sandige Erdboden färbte sich an einer einzigen Stelle rot, bevor er sich wieder im Gelblichbeigen verlief.
Die Sonne neigte sich langsam gen Horizont, tönte die Luft rotgolden. Wie einen zarten Schleier breitete sie ihre leuchtende Farbe über die Welt aus und ließ fantastische Schatten an den Felsabhängen entstehen.
Salomon fuhr von der Straße ab auf eine Sandpiste Richtung Meer, schaltete runter auf Schritttempo. Den Fußgänger sah ich erst, als er auf Höhe meines Seitenfensters war. Er trug eine Jeansjacke über seinem Beduinengewand, ein blau-weißes Tuch um den Kopf. Ihm voran liefen zwei Beduinen mit braunen Gewändern und weißen Turbanen, jeder ein Dromedar an der Leine.
Vor einer Holzbude machten wir halt, einem Laden mit Konservendosen, Chipstüten und Süßigkeiten auf schmalen Regalen. Nebenan eine Bude mit Arafat-Tüchern und Kleidungsstücken, wie sie im Westen in den sechziger Jahren zur Hippie-Zeit modern waren.
Vorbei an den Shops, die ohne Fundament auf dem Wüstensand standen, folgten wir einem eingetretenen Fußpfad parallel zum Meeressaum. Es war dunkel geworden.
Nicht weit von mir erkannte ich Gestalten, zwei Beduinen, die anderen Westler, einer der Jungs hatte langes, blondes Haar. Sie saßen unter einer Palme auf Teppichen und Kissen, eine Kerze in ihrer Mitte, tranken Tee und unterhielten sich flüsternd, lachten leise. Es roch nach Marihuana.
Eine Kerze auf einem gezimmerten Tresen erhellte eine am Pfosten hängende Tafel. Mit weißer Kreide stand geschrieben: Rührei, Salat, Chumus und Brot. In Englisch. Die krakelige Schrift wies darauf hin, dass der Schreiber unsere lateinischen Buchstaben nicht gewöhnt war.
Allein in einer Beduinensitzecke schmuste ein Pärchen, weltvergessen, völlig ineinander versunken, eins mit sich und der Welt, Wein auf dem Tisch, Kerze.
Erst jetzt bemerkte ich ausnahmslos Kerzen. Es gab keinen Strom.
Die stockfinstere Nacht ließ den Pfad kaum erkennen. Links vor mir tat sich in der Dunkelheit eine Art Holzverschlag mit Tresen auf. Rechts hockten Rucksacktouristen auf Teppichen vor niedrigen Tischen und aßen gebratenen Fisch; sie sprachen gedämpft.
Der Geruch von frischem Fisch stieg uns in die Nase.
Wo war ich hier gelandet? Im Paradies? Alles so friedvoll. Nur sanfter, warmer Wüstenwind und lachende, vor Ehrfurcht angesichts der Schönheit des Lebens verhaltene Menschen. Sie schienen glücklich zu sein. Einige verweilten vor kleinen Feuerchen. Alle leise. Jeder genoss das Dasein auf diesem herrlichen Fleckchen Erde. Keine Musik, keine Geräusche, keine künstlichen Lichter. Einheimische wie Fremdlinge bewegten sich langsam, als hätten sie ewig Zeit.
Die Menschen wussten um die Besonderheit dieses Ortes, eine der letzten Oasen auf unserem Planeten, Dahab im Sinai.
Der Fußweg endete bei einem primitiven Holzhaus, in dem es Trinken und Essen gab. Salomon und die anderen gingen hinein, ich blieb draußen am Meer.
Der Mond erhob sich am Himmelszelt, beleuchtete das Land. Allmählich konnte ich die sichelförmige Bucht überblicken, die in einer Landzunge endet, an deren Spitze ich jetzt stand. Ich setzte mich in den Sand. Wie viele Sterne zu sehen waren! Hell und klar. Eine weitaus üppigere Sternenpracht als in Europa je zu sehen ist. Gedankenlos lauschte ich dem himmlischen Frieden, bis Salomons Stimme mich vorsichtig aufrief.
„Marlisa, komm!“
Im Mondlicht spazierten wir zurück zum Fahrzeug.
Der startende Motor unterbrach die Stille. Nach einer scharfen Rechtskurve tauchte zur Linken eine weiße Mauer auf, an der wir entlangfuhren. Hin und wieder rutschten die Räder im Sand oder drehten durch, doch sie fingen sich jedes Mal wieder. Die lange Mauer versperrte den Blick zum Meer. Was wohl dahinter sein mochte? Plötzlich eine Öffnung, groß genug für ein Auto und flutsch – war Salomon hindurch gefahren. Hinter einer Gruppe von Palmen hielt er vor einem weißen Häuschen.
Noch ehe alle ausgestiegen waren, umarmte er einen kleinen Mann. Pechschwarzer Schnurrbart, blaues, bis zum Boden reichendes Hemd, schneeweißer Turban um schwarze Locken gewickelt.
„Lernt meinen Freund Hamid kennen. Wir sind Freunde seit der Zeit, in der wir hier noch ein- und ausgehen durften. Wenn ich hier herkomme, gehe ich immer zu ihm. Hamid, das ist Marlisa aus Deutschland.“
Hamid reichte mir die Hand zum Gruß. Spitzbübisch lächelte er mich an, hielt meinen Blick fest. Seine Hand fühlte sich an wie raues Leder.
„Willkommen, Marlisa, willkommen in meinem Heim“, sagte er in einwandfreiem Englisch zu mir.
Das hatte ich nicht erwartet. „Woher hast du dein Englisch?“
„Von den Touristen.“
„So viele Touristen kommen hierher, dass man davon Englisch lernen kann?“
Lachend zwinkerte er mit einem Auge: „Nun, du musst schlau sein“, hob den Zeigefinger wie ein Lehrer, „dann kannst du alles machen! Kommt, trinkt einen Tee.“ Er ging voran hinter eine weitere Mauer.
„Seht“, stolz breitete er seinen Arm über das Land aus. „Dies ist mein Platz. Ihr könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Dies ist mein Coffeeshop, mein kleines Café. Bitte setzt euch, macht es euch bequem.“
Sein Platz reichte bis hinunter an den Strand. Teppiche auf dem Boden und über Matratzen bildeten separate Sitzecken, die sich in den Bewuchs der Palmen auf seinem Grundstück schmiegten. Einige Sitzgruppen waren mit Palmwedeln überdacht, andere standen im Freien.
„Lasst uns hierüber gehen“, raunte Salomon. Er wählte die Ecke, die vom Eingang aus am wenigsten einsehbar war. „Wegen der Polizei.“
Wir ließen uns nieder. Hamid brachte ein Tablett voller Teegläser.
„Sie führen abends Kontrollen durch“, sprach Salomon weiter. „Rauchen ist hier nicht erlaubt. Wenn sie dich erwischen --- piuhh“, er pfiff durch die Zähne und schüttelte seine Finger, als hätte er sich verbrannt.
„Es ist schlimmer geworden“, nickte Hamid mit großen Augen. „Die Polizei ist wirklich frech geworden. Sie kommen von hinten, weißt du, da unten beim Ufergestrüpp, da stehen sie“, seine Hand zeigte hinaus ins Dunkle. „Es ist nicht mehr wie früher. Sie wollen uns hier weg haben. Also suchen sie was, womit sie uns beschuldigen können. Dann stecken sie uns ins Gefängnis, und wenn wir wieder rauskommen, haben sie unser Land genommen, unseren Platz, sie nehmen uns alles. Sie wollen das große Geld mit den Touristen machen, auf unsere Kosten. Aber wir können nichts gegen sie tun. Wir haben ja nichts. Wir können nur beten, Allah, hilf uns!“ Hamid blickte mir direkt in die Augen, höhnte: „Denkst du, wenn du dein Leben lang ein guter Mensch bist und immer anderen hilfst und immer betest, dann passiert dir nichts? Pah!“ Er presste einen Luftstoß zwischen den Lippen hindurch. „Du kannst dich gegen das Böse nicht absichern.“ Erklärend fügte er hinzu: „Die Leute von Kairo haben Geld. Wer das Geld hat, hat die Macht. Sie hetzen uns die Polizei auf den Hals. Früher gab es hier keine Polizei. Wir brauchen auch keine. Hier stiehlt niemand. Jetzt kommen sie uns mit ihren Gesetzen. Was? Wir sollen nicht rauchen? Wir sind Beduinen. Wir leben hier unser ganzes Leben und rauchen, wen stört das schon? Wir tun niemandem was, also lasst uns in Ruhe! Aber sie machen diese Gesetze, damit sie uns kriegen. Sie wollen hier Hotels bauen. Leute aus der ganzen Welt sollen hier herkommen und sollen noch mehr Geld bringen. Wie viel mehr Geld noch? Wann ist es genug? Wie viel brauchen sie?“
„Richtig! Du hast Recht“, sprach Salomon als nächster, „es ist das Böse im Menschen, was du am meisten zu fürchten hast. Schatten ist in jedem, genau wie Licht. Der Mensch entscheidet, worauf er seinen Fokus legt. Nur merkt er manchmal nicht, von welcher Seite aus er guckt. Die Habgier ist es, die die Welt zugrunde richten wird, und der Selbstbetrug.“
Ich liebte Themen, die alle angingen, Wahrheiten, die zu jeder Zeit an jedem Ort ihre Gültigkeit besaßen. Licht- und Schattenseiten der Menschen war so ein Thema. Kaum jemand weiß, wo und wie sie tatsächlich mit uns verknüpft sind, aber jeder weiß, wie sie wirken. Licht und Schatten sind wie Dur und Moll in der Musik. Lichte, leichte, schöne Musik hellt uns auf, macht uns licht und leicht. Licht ist alles, was harmonisch ist, alles, was sich gut anfühlt. Schatten ist alles, was sich schlecht anfühlt, was wir fürchten, was uns traurig macht oder zornig, was wehtut. Ich sehe viel Schatten auf der Erde, Streit und Krieg in jeder Generation. Dabei will das niemand wirklich. Alle sehnen sich nach Frieden, nach beständigem Frieden, dem Dauerlicht. Ich sehe, wie wir als Baby unbescholten auf diesem Planeten ankommen, unbeschrieben wie ein weißes Blatt Papier. Angenehmes ist selbstverständlich wie Luft zum Atmen. Die erste unangenehme Erfahrung erschreckt uns. Schon stehen die ersten unschönen Dinge auf unserem Papier wie Angst und Schmerz, und es kommen weitere hinzu. Mit diesen Prägungen begegnen wir dem Leben und das Leben schwingt sie uns zurück. Wir geraten in Situationen, die uns Angst machen und wir machen anderen Menschen Angst. Wir erfahren Schmerz und wir fügen anderen Schmerz zu. Wie eine Eingebung erkenne ich, mit Prägungen von Menschen verhält es sich ebenso wie mit Schwingungsfrequenzen von Instrumenten. Sie ziehen sich gegenseitig an und verbinden sich. Sie folgen den Gesetzen der Resonanz. In einer Auseinandersetzung zwischen Menschen eskaliert der Ton genau wie bei einer Rückkopplung zwischen Gitarre und Verstärker. Schwingt eine Seite nicht zurück, gibt es auch keine Eskalation. Wenn keiner zum Krieg geht, gibt es keinen. Eine Hand allein kann nicht klatschen. Dann bleibt nur noch Friede. Nur Licht kann Schatten erhellen, nur Liebe kann Hass verwandeln – in Liebe. Unabhängig vom Glauben. Hier saßen ein Moslem und ein Jude, zwei Weltfeinde, und sie verstanden sich prächtig, waren sich sogar über menschliche Grundsätze einig. Reicht es nicht, ein paar menschliche Grundsätze einzuhalten, und dann wäre Frieden auf Erden? Die beiden beweisen, dass Menschsein über dem Glauben steht. Welcher Grundsätze bedarf es, die für alle gelten, worüber sich auch alle einig wären? Gibt es so etwas wie einen Dauerfrieden? Gibt es überhaupt eine Beziehung ohne Streit? Oder muss Streit sein als Gegenpol zum Frieden, weil auf dieser Erde alles zwei Seiten hat, weil wir in der Dualität leben? Wenn eine Löwin ein Zebra anfällt, ist das für das Zebra wie Krieg. Ist Krieg am Ende natürlich?
„Ich mache uns schöne Musik an. Ja, ich habe einen Generator gekauft, ich mache uns jetzt Pink Floyd an. Kennt ihr Pink Floyd? Sicher, ihr müsst sie kennen. Gute Musik!“ Hamid drückte Daumen und Zeigefinger zusammen und spitzte anerkennend seinen Mund.
Nach einer Weile fing es über mir an zu knistern. Die melancholische Rockmusik ertönte aus den Lautsprechern, die in den Palmen hingen. Ich lehnte mich zurück, hörte der Musik zu, blickte in die Sterne und genoss das pure Dasein. Nichts in mir drückte, drängelte oder befürchtete, nichts wollte, nichts sollte, nichts musste. Alles in mir war ruhig wie ein See. Dies war der Zustand, nach dem ich mich immer wieder sehnte.
Nach dem letzten Song schaltete Hamid den Generator ab. Mit der Hand winkte er. „Kommt mit zu mir!“
Wir erhoben uns, folgten ihm über den Vorplatz zu einem kastenförmigen Bau, ähnlich einer Garage, und traten durch die Tür ins Dunkle. Im Nu hatte Hamid eine Kerze angezündet. Die vier weißen Wände standen auf bloßem Wüstensand. Auf der Erde lagen Teppiche, in der Ecke eine große Matratze und mehrere Decken. Kein weiteres Mobiliar. Keine Fenster. Im Kreis verteilten wir uns um die Kerze im Messinghalter am Boden, das Messing über und über mit Wachs beträufelt, völlig versandet. Hamid, im Schneidersitz, spannte sein Gewand von Knie zu Knie. Auf diesem Tisch hantierte er mit Papier und Gras und baute einen riesigen Joint. Fertig gerollt, zündete er ihn an, steckte ihn zwischen zwei Finger und formte mit beiden Händen eine hohle Kugel. Seine Daumen bildeten ein Saugloch. Diese überdimensionale Zigarette hielt er jedem an den Mund, um einmal daran zu ziehen. Er ging solange reihum, bis das Ding aufgeraucht war. Mir wurde ein wenig komisch, gut, dass ich saß. Sauerstoff fehlte. Ich legte mich hin. Salomon packte mich sanft am Arm. „Marlisa, alles okay? Komm lass uns rausgehen, wir gehen alle raus jetzt.“
Mein Freund, er passte auf mich auf, er fühlte mich und war sofort da, wenn ich schwächelte. Er ließ mich vorgehen. Ich trat ins Freie und schaute in den Sternenhimmel. Die Sterne hingen tief. Weit unten am Horizont funkelten immer noch reichlich an der Zahl. Sie erschienen mir heute größer denn je.
Salomon zog mich von hinten am Ärmel. „He, Marlisa, was ist los mit dir? Du schwankst. Geh normal!“ Er lachte, nahm mich in den Arm. „Du bist stoned, was?“ Gab mich wieder frei. Wir gingen zurück zu Hamids Coffeeshop.
In einer Sandmulde entfachte Salomon ein kleines Feuer, um das wir uns gruppierten. Hamid brachte Kekse aus seinem Laden. Das reinste Schlaraffenland. Am Feuer schlief ich ein.
Das schönste Aufwachen ist unter freiem Himmel.
Hamids Platz im Hellen war eine Oase für sich, abgeschirmt vom Außen durch die Mauer und zwei seitliche Abgrenzungen aus Palmwedeln bis runter zum Strand. Die hohen Palmen in diesem Garten Eden hingen voller Datteln. Der Strand erstrahlte hellgelb in der Morgensonne. Das Rote Meer glitzerte. Im Tageslicht bewunderte ich die Sitzecken im Sand, bedeckt mit handgewebten Teppichen in dezenten Farben. In jeder ein niedriger Holztisch auf Teppichboden. Wohneinheiten ohne Decken und Wände.
Die heruntergelassene Ladenluke des Häuschens wurde tagsüber waagerecht auf zwei Pfeiler gestützt und als Außentresen genutzt. Ein Dach aus geflochtenen Palmwedeln spendete einladenden Schatten. Durch die offene Luke konnte ich in den Shop einsehen. Auf einem Holzregal lagerten vereinzelte Kekspackungen mit geschwungener, arabischer Aufschrift neben einigen in Plastik eingeschweißten, fingerdicken Süßigkeiten, aufgemacht wie westliche Schokoriegel, hergestellt in Ägypten. Die amerikanische Idee war also schon bis hierhin vorgedrungen.
Die Zweige der Dattelpalmen schaukelten kräftig hin und her, während hier unten hinter der Mauer Windstille herrschte. Die Sonne brannte zunehmend heißer. Ich zog meine Lederjacke aus. Beduinen ziehen nie was aus, wenn es wärmer wird und auch nichts an, wenn es kälter wird. Stets tragen sie ihre langen Hemden, selten eine Jacke. Ich merke, dass ich anders bin, dass ich Westler bin, nur Tourist bin, nicht empfinde wie die Menschen hier. Ich möchte aber nicht anders sein. Anders sein heißt ausgegrenzt sein. Das will niemand. Man müsste doch auch anders sein können und trotzdem dazugehören. Alle Menschen entstammen der gleichen Gattung, haben den gleichen Ursprung, wovon also hängt das Dazugehören ab?
Hamid erschien am Ausschank, lächelte mich an, neigte grüßend den Kopf.
„Good morning, Lady, möchtest du einen Kaffee oder einen Tee?“
„Boker tov, Hamid“, begrüßte ich ihn auf Hebräisch, „gib mir einen Kaffee bitte.“
Hamid verschwand im Innern des Ladens.
Nachdem sich meine Augen an den Schatten gewöhnt hatten, erkannte ich, die eine Seite des Häuschens war Teil der Grenzmauer. Schlau gemacht. Häuschen bedeutet vier auf Sand gebaute Wände mit Schrägdach. Außenwände weiß, innen leuchtend blau angestrichen. Auf einem Holztisch, ein zweiflammiger Kocher, verbunden durch einen orangefarbenen Schlauch mit einer Gasflasche am Boden. Eine alte Pfanne wartete auf ihren Einsatz. Auf dem Tisch, gewürfelte Zwiebelreste und ein paar Eier. Die Olivenöl-Flasche musste ihrem Aussehen nach schon unzählige Male nachgefüllt worden sein.
Salomon streifte von hinten über meinen Rücken. „Guten Morgen, wie geht’s dir? Alles okay? Hast du gut geschlafen?“
„Alles in Ordnung, danke.“
Hamid stellte mir einen Kaffee hin, Salomon wie selbstverständlich einen Tee. Er wusste genau, wie Salomon seinen Tee trinkt, schwach, mit zweieinhalb Löffeln Zucker, er kannte seinen Freund von Herzen. An den Tresen gelehnt spähten wir hinaus aufs Meer.
May trottete mit verschlafenen Augen herbei. Ihre kurzen, roten Haare standen in alle Richtungen.
„Hallo, wie geht’s euch? Was für ein schöner Morgen. Salomon, wo kann ich auf Toilette gehen?“
„Draußen, komm mit.“
Sie passierten den Durchgang. Ich schloss mich ihnen an.
„Wartet auf mich“, hörten wir Hazel hinter uns her eilen. Wir blieben stehen, bis sie uns erreichte.
„Da hinten müsst ihr langgehen, dann seht ihr es schon.“ Salomon zeigte in die Landschaft hinter dem weißen Kastenbau, in dem wir gestern Abend gesessen haben.
Wir drei Frauen ließen den Bau hinter uns, schlenderten durch den weichen, hellbeigen Wüstensand und entdeckten bereits die sanitäre Anlage.
Ich ging auf die erste Holztür zu, öffnete sie. „Wow, seht euch das an!“ In den Boden dieser mit weißen Fliesen ausgelegten Zelle war ein sauberes, schneeweißes Stehklosett eingelassen. May und Hazel standen ebenfalls vor einer geöffneten Toilettentür.
„Das ist ja vornehm hier“, stellte Hazel fest.
„Mädels“, ließ May lax verlauten, „ihr könnt hier stehen und euch über diesen Anblick erfreuen, ich muss mal.“ Grienend verschwand sie hinter ihrer Tür.
Die Klozellen hatten keine Decke, kein Dach. Die übrigen drei Kabinen entpuppten sich als Duschzellen, weiß gekachelt von unten bis oben, darüber der azurblaue Himmel. Die Sonne lugte gerade über die Rückwand. Welch ein Luxus, unter der Dusche stehen und in die strahlende Sonne blicken!
Den restlichen Tag verbrachten wir in Hamids Oase, hockten beieinander, palaverten wie die Indianer beim Powwow.
Bevor die Sonne hinter den Felsen versank, wanderten wir den Weg bis ans Ende der Bucht, aßen Fisch und kehrten zurück zu Hamids Platz, wo wir bis weit nach Mitternacht unterm Sternenzelt chillten.
Erfüllt von den wunderbaren Eindrücken der Sinaireise fuhren wir zurück nach Israel. So viel Lebensintensität, Gemeinschaft mit anderen und Einssein mit sich selbst – danach hatte ich gesucht, geradezu göttlich. Aber wie dies Gefühl halten?
In meinem Zuhause angekommen, umspannen mich sofort die alten Fänge. Der innere Aufruhr begann ohne mein Dazutun, steigerte sich von selbst, zerstreute mich, zerfusselte mich, bis sich alles vor meinen Augen verzerrte, ich weder klar gucken noch denken konnte. Allerhöchste Zeit. Unter unaushaltbarem Druck lief ich in die Stadt, kaufte drei Packungen Kekse, eilte nach Hause, aß sie alle auf, trank dazu einen großen Pott dünnen Kaffee, der so ekelig schmeckte, dass es mir leicht fiel, anschließend alles wieder zu erbrechen. Danach war es still in mir.
Würde dieser Zwang aufhören, wenn ich im Sinai leben würde? Könnte ich dort im Einklang mit mir und den anderen leben? Wäre das die Lösung? Soll die Wüste das Ende meiner Reise sein? Waren Mohammed und Jesus nicht auch so bewegt von der Wüste? Tagelang hatten sie in ihr meditiert. Ist das nicht Beweis genug, dass die Wüste den Menschen verändert? Ist hier der Ausweg? Sollte ich in der Wüste leben, einen Beduinen zum Mann haben, den ganzen Tag zusammen mit anderen Frauen Essen kochen und Kinder und Ziegen hüten? Warum nicht? Ich wäre nicht allein und es wäre einfach nicht genug da, um zu viel zu essen!
Weiterhin suchte ich und beobachtete andere, wie sie es schafften ihr Leben zu meistern.
Nach einer Show traf ich auf Jakob, einen amerikanischen Juden, der erst vor kurzem mit seiner Familie nach Elat gekommen ist. Er lud mich nach Hause ein zu seiner Frau Rebecca und seinen drei Kindern. Rebecca und ich hatten uns viel zu erzählen, sie mir von Amerika, ich ihr von Deutschland.
Bei einem meiner Besuche geschah etwas Unvorhersehbares. Sie war gerade ins Kinderzimmer gegangen, als ich beschloss aufzubrechen. Höflich brachte ich unsere Tassen in die Küche und spülte sie kurz ab. Sie kam drüber zu, fing an zu kreischen. „Nicht! Mein Gott, das kannst du doch nicht machen!“ Blankes Entsetzen stand in ihren Augen.
Irritiert starrte ich sie an. Was hatte sie nur?
Sie brauchte einige Zeit, bis sich ihr Atem beruhigte. „Du hast das Spülbecken entweiht. Dieses Spülbecken ist nur für das Geschirr, das mit Fleisch in Berührung gekommen ist. Es wird mit dieser Bürste abgewaschen und kommt in diesen Schrank. Jenes Spülbecken“, sie zeigte auf das zweite, „ist für alles, was mit Milch zu tun hat. Dazu gehören jene Spülbürste und jener Schrank. So bleibt alles koscher. Die Dinge dürfen niemals miteinander in Berührung kommen. Jetzt muss das Spülbecken wieder koscher geweiht werden.“
Mehrfach entschuldigte ich mich bei ihr und ging.
Die Band des Lichts spielte drei- bis viermal die Woche. Inzwischen kannte ich alle Hotels, Clubs und Diskotheken. In letzter Zeit fielen vermehrt Auftritte aus. Manchmal erfuhren wir davon, wenn wir mit unseren Instrumenten bereits vor Ort waren. Es seien nicht genügend Gäste im Hotel, ein andermal sollte eine Alternativ-Veranstaltung stattfinden. Außer mir wunderte sich niemand, dass man uns nicht eher informierte. Auf derart kurzfristige Absage eines Engagements stünde in Deutschland die Konventionalstrafe. Nun denn, die Auftrittssituation sah jedenfalls nicht gerade rosig aus.
Aus finanziellen Gründen wollte Raffael die Anzahl der Bandmitglieder senken. Von heute auf morgen kündigte er mir. „Marlisa, du spielst ab sofort nicht mehr in meiner Band. Ich werde versuchen, dich als Lobby-Pianistin im Sonesta Hotel unterzubringen. Ich werde mit Yaron reden. Du gehst nächste Woche zu ihm. Bis dahin habe ich mit ihm gesprochen.“
Dreimal lief ich vergeblich zum Hotel, bevor ich ihn schließlich antraf. Yaron, Manager des Hotels, der die Künstler engagiert, ein alter Mann mit einer dicken Goldkette um den Hals. Er sprach kaum Englisch, daher beschränkte sich die Unterhaltung auf das Notwendigste. Mit zusammengekniffenen Augen taxierte er mich ab.
„Du arbeiten? Okay! Start Montag, fünf Uhr! Geld Raffi!“ Dann winkte er mir zu und verließ das Büro.
Verwundert blieb ich zurück. Das war das ganze Einstellungsgespräch? Kein Vertrag? Nichts Schriftliches? Keine Aussage über Gagenhöhe? Da bleibt mir wieder einmal nichts anderes übrig als zu vertrauen.
Montag fünf Uhr saß ich am weißen Konzertflügel in der Lobby des vornehmen Sonesta Hotels. Die Israelis haben es damals aufgebaut, als sie sich den Sinai im Sechs-Tage-Krieg eroberten. Sinai haben sie inzwischen wieder an Ägypten abgetreten, um ihre Bereitschaft zum Frieden zu zeigen, sagt Salomon. Das Hotel blieb in israelischer Hand. Ein begehrtes Fleckchen Erde, auf dem ich mich befand.
Von meinem Flügel aus schaute ich durch die breite Glasfront auf das Rote Meer und die jordanischen Berge. Jeden Tag freute ich mich auf meine Arbeit, spielte, wozu ich Lust hatte, Klassik, Pop, Volkslieder, alles, was mir einfiel, und ich sang hebräische Lieder so perfekt, dass man mich für eine Israelin hielt. Ich war in meinem persönlichen Himmelreich angekommen. Am Ende des Monats drückte mir Yaron auch noch einen Scheck in die Hand.
Wochenlang durfte ich diesen Job genießen, bis Yaron eines Nachmittags zu mir an den Flügel trat und mir andeutete, mitzukommen. Ich beendete mein Lied und folgte ihm in sein Büro.
Er setzte sich hinter seinen großen Schreibtisch, bot mir den Platz gegenüber an. Was konnte er von mir wollen? Auf einmal verzog er sein Gesicht zu einer überheblichen Grimasse.
„Nix mehr Arbeit, geh nach Hause!“
Erschrocken stierte ich ihn an.
Wie die Hexe bei Hänsel und Gretel krümmte er seinen Zeigefinger. ,Herkommen!’, hieß das.
Ich beugte mich vor.
,Näher!’
Sicher würde er mir jetzt erklären, warum ich aufhören sollte zu arbeiten.
Als ich nah genug dran war, steckte er blitzschnell seinen Zeigefinger in meinen Ausschnitt, zog meine Bluse nach unten, blickte auf meinen Busen und ließ sich lachend in seinen Sessel zurückfallen.
Auf der Stelle drehte ich mich um und rannte aus seinem Büro. Unten an der Hotelauffahrt bemühte ich mich, meine Empörung und Verwirrung zu sortieren, mich von dem Schrecken zu erholen. Wie konnte Yaron so gemein sein? Wovon sollte ich nun leben? Keine Arbeit, kein Geld. Sollte das heißen, ich muss zurück nach Deutschland? Das war meine größte Angst. Tränen liefen mir über die Wangen. Ich war verzweifelt. Was sollte ich jetzt tun? Was konnte ich tun?
Plötzlich lächelten mich zwei strahlend blaugrüne Augen an. Baruch, der Tennislehrer des Hotels. „Was ist denn mit dir los? Ich kenne dich nur fröhlich. Nun sehe ich dich weinen? Was kann es sein, das dich weinen lässt?“ Liebevoll legte er seinen Arm um mich.
„Ich habe meinen Job verloren“, platzte ich schluchzend heraus.
Laut schallend fing Baruch an zu lachen.
Nun war ich noch verwirrter, was gab es denn da zu lachen?
„Und deswegen weinst du?“ Baruch konnte sich gar nicht wieder beruhigen. „Da gibt es doch nichts zu weinen, seinen Job verliert man andauernd. Dann sucht man sich einen neuen, so ist das im Leben. Alle verlieren ständig ihre Arbeit und finden eine andere, darüber habe ich noch nie jemanden weinen sehen, bist du naiv!“ Mit diesen Worten ließ er mich stehen und ging runter zu den Tennisplätzen.
Jetzt war ich beleidigt. In Deutschland hätte man mein Problem gewälzt und sich in freundlichen Gesprächen ergangen. Dann fing ich an zu begreifen. Hier ist man pragmatisch. Wo nicht wirklich Not am Mann ist, geht man seiner Wege, und wo Hilfe notwendig ist, wird sie ohne Umstände geleistet. Kein unnötiges Palaver. Ich kam mir eng vor mit meinem Sicherheitsdenken, meiner Kleingeistigkeit, meiner Naivität. Ich spürte einen riesigen Unterschied zwischen mir und den Israelis. Sie waren so flexibel, hatten so wenig Angst, nahmen das Leben, wie es kam, sie fühlten sich so viel leichter an als ich. Wie sie wollte ich sein. So frei!
Tatsächlich fand ich schnell einen neuen Job. Man kannte mich in allen Hotels als Raffaels Sängerin und Keyboarderin. Nun spielte ich jede Nacht in der Hotelbar des kleinen Red Rock Hotels Klavier. Die Bezahlung stimmte.
Nach zwei Monaten sagten sie mir ab, zu wenig Gäste im Hotel.
Zur selben Zeit traf ich wie zufällig Raffi auf Straße.
„Hi, Marlisa, wie geht’s, willst du wieder bei mir spielen?“, kam er ohne Umschweife zur Sache.
„Ja.“
„Gut, dann sei morgen Abend um acht im Queen of Sheba, wir haben eine Show mit einem Schwarzen aus Trinidad. Wir werden ihn begleiten. Seine Songs gehen wir kurz vorher durch. Bye, bis morgen.“
Nirgendwo bekommt und verliert man Jobs so schnell wie hier. Israel ist eine gute Schule für Flexibilität.
Im Queen of Sheba standen neue Musiker auf der Bühne. Orit ist nach Tel Aviv gegangen, ein neuer Gitarrist aus Tel Aviv gekommen. Ich hatte ihn nie zuvor gesehen, aber er beherrschte das gesamte Programm. Radshif war auch nicht mehr da, dafür spielte Raffi selbst das Schlagzeug.
Beim nächsten Auftritt spielte Radshif den Bass und der Russe Udi die Drums. Manchmal spielten wir auch mit zwei Gitarristen. Die Besetzung änderte sich ständig, für eine deutsche Band undenkbar. Hier ist eben alles anders.
Jemand aus dem Publikum lud mich auf ein Getränk ein. Zvika. Edle Erscheinung, sprach langsam und bedächtig, schien mir weise zu sein, das zog mich an.
Ich liebte es, ihn reden zu hören, verbrachte viele Abende mit ihm. Er liebte es, mir traditionelle israelische Musik vorzuspielen und von seinem Leben in Mexiko und Los Angeles zu berichten. Jeden Schabbat fuhren wir mit seinem Buggy die Küste entlang, um bei einem Strandcafé zu halten, Freunde zu treffen und das Leben zu feiern.
Eines Abends klingelte ich spontan an seiner Tür.
Erfreut begrüßte er mich. „Ich grille gerade ein Hähnchen im Patio. Willst du mitessen? Komm und bring das Brot mit.“
Sofort half ich den Tisch decken.
„Im Kühlschrank sind noch eingelegte Paprikas, bring sie bitte“, forderte er mich auf.
Während ich die Paprikas aus dem Kühlschrank holte, entdeckte ich Schafskäse. Mmh, das passt prima zu Hähnchen, ich nahm ihn gleich mit. Zvika war draußen mit dem Fleisch beschäftigt. Ich setzte mich zu ihm und schaute hoch in den dunklen Abendhimmel. Der Widerschein der Stadtlichter lag wie eine orangefarbene Wolke über den Häusern. Gedämpft drangen die Geräusche bis zur hinteren Häuserreihe zu uns vor. Die Luft war wunderbar mild und lau, ich genoss es, im privaten Patio geschützt zu sitzen und gleichzeitig draußen im Freien zu sein.
Zvika begab sich zu Tisch, wir begannen zu essen. Auf einmal schreckte er hoch und fuhr mich an.
„Was fällt dir ein? Das gibt's doch wohl nicht. An meinem Tisch!“
Erschrocken fragte ich, was los sei.
„Der Schafskäse! Du kannst doch nicht Schafskäse auf den Tisch stellen, wenn wir Fleisch essen!“
„Du brauchst ihn doch nicht essen!“
„Ich mag überhaupt nicht mehr essen. Das gehört nicht auf denselben Tisch“, sagte er scharf sich abkehrend.
Von Rebecca vorgewarnt, was das koschere Essen angeht, habe ich von Zvika so eine Reaktion nicht erwartet, er war doch sonst so leger. Außerdem wusste ich nicht, dass ich den Schafskäse nicht auf den Tisch hätte stellen dürfen. Ich entschuldigte mich und brachte den Käse zurück in den Kühlschrank.
Er beruhigte sich wieder.
Wir blieben weiterhin Freunde.
Mohammed, ein junger Araber, wollte mit mir ein Bier trinken gehen. Trotz des Verbots meines Bandleaders, mich mit Arabern einzulassen, nahm ich die Einladung an. Ich war neugierig, ich wollte Araber kennenlernen, einfach um sie kennenzulernen, damit ich weiß, wie sie sind. Außerdem wollte ich wissen, ob es da einen Unterschied gibt zu Juden oder ob der Unterschied nur erfunden ist. Vielleicht um ein Feindbild aufrecht zu erhalten. Ich wollte Menschenkenntnis erhalten, also musste ich so viele wie möglich kennenlernen, oder wie erhält man Menschenkenntnis?
Mohammed gab sich große Mühe als Mann von Welt zu erscheinen und sprach mit ausgewählten, englischen Worten. Als wir aus dem Pub traten, legte er seinen Arm um mich, ich ließ es geschehen. Wir gingen an der Straße entlang. Auf einmal hupte Jossi mir vom Auto aus zu. Ich winkte zurück. Sofort wurde Mohammed wütend. Wie kann ich einen anderen Mann grüßen, wenn ich in seiner Begleitung bin. Was für Besitzansprüche! Ich gehöre doch niemandem, auch nicht, wenn ich mit ihm ein Bier trinken gehe. Mohammed wollte mich nicht verstehen. Er war grimmig. Ich sah ihn nie wieder.