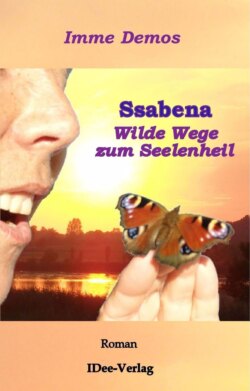Читать книгу Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil - Imme Demos - Страница 5
Flüggewerden
ОглавлениеIn zwanzig Jahren auf Planet Erde hatte ich nicht gelernt, auch nur eine einzige Nacht allein in einer Wohnung zu verbringen. Schlief mein Freund über Nacht aushäusig, musste ich entweder mit ihm gehen oder jemanden finden, der mich bei sich aufnahm. Dunkelheit bot einen idealen Nährboden für meine Heidenangst. Allein im Dunkeln aufwachen steigerte sie ins Unermessliche. Vor Geräu-schen, Dingen, die ich sehen, ahnen oder befürchten, Gefühlen, die ich erleben würde. Angst vor der Angst. Ich war erwachsen und nicht lebensfähig. Sehnte mich nach Erlösung. Vielleicht hilft einfach nur üben, trainieren.
Erneut brach ich auf. Innerhalb einer Busreisegruppe wähnte ich mich sicher. Bei der Zimmerreservierung bestand die Wahl zwischen Einzel- und Doppelzimmer. Mutig bestellte ich ein Einzelzimmer.
Zwei Tage dauerte die Fahrt an den Ort meines Herzens, selbstverständlich Sizilien.
Zum Sitzen und Aus-dem-Fenster-Schauen fehlte mir die Ruhe. Meinem Wunsch nach Eingebundensein entsprechend machte ich mich nützlich. Mit Zustimmung des Busfahrers durfte ich die winzige Küche im Heck übernehmen und die Reisenden mit Kaffee und Tee bedienen. Bei dem einen oder anderen verweilte ich, um ein Gespräch zu beginnen und etwas über ihn zu erfahren. Bald kannte ich jeden einzelnen Fahrgast. Alle freuten sich, wenn ich kam.
Die Nächte in meinem Einzelzimmer überstand ich erstaunlich gut.
Daraus schöpfte ich den Mut, meine Kreise zu erweitern. Ich flog über den Atlantik auf die kanarische Insel Gomera, westlich von Nord-Afrika. Allein. Ohne meinen Freund und ohne Reisegruppe im Rücken. Gomera sollte ein Geheimtipp sein, vom Tourismus kaum entdeckt, mit etlichen unberührten Stränden und Natur. Das Unberührte lockte mich, das vom Menschen noch nicht Verunstaltete. Wildwüchsige Landschaften, Wälder und Seen. Unbewusst war mein Bestreben, zurück zu meinem eigenen, unberührten Urzustand zu finden, zum Frieden, der in mir herrschte, bevor das Leid des Lebens auf der Erde mich erfasste.
Trotz aller Übung hielten sich Ängste und Essstörungen hartnäckig. Mein Zustand verschlimmerte sich sogar. Mehrmals stand ich mitten in der Stadt, zitternd, heulend, verwirrt, irgendwie wissend, dass ich in dieser Stadt wohne, gleichzeitig aber auch nicht. Selbst meinen Namen Marlisa erinnerte ich dann nur schemenhaft, ohne Bezug dazu. Das machte mir Angst.
Einmal quoll ein regelrechter Schreianfall aus mir heraus. Obwohl ich nicht alleine war. Ein Studienfreund und ich wanderten einen einsamen Strand entlang, als etwas leise in mir zu rumoren begann. Ich wurde unruhig ohne ersichtlichen Grund, aufgewühlt wie die See. In meinem Kopf nahm die Lautstärke zu. Mein Atem beschleunigte, röchelte, fauchte gegen Wind und Wellen, wandelte sich zu einem Ton, der aus meiner Kehle heraus wimmerte, erst wie zartes Wehklagen, dann heftiger und zunehmend lauter. Im Leid versinkend spürte ich meinen Körper nicht mehr. Wie von unsichtbarer Hand geführt, stoppten meine Füße, wendeten mich dem Meer zu. Jetzt schrie es aus mir heraus, schrie und schrie aus Leibeskräften. Keine Worte, nur langgezogene Laute.
Voller Mitgefühl stand mein Studienfreund neben mir. Er wusste, er konnte nichts für mich tun.
Lange schrie es aus mir heraus, bevor es wieder aufhörte.
Danach hatte ich Angst, meinen Mund zu öffnen, nicht sicher, ob Sprache herauskommen würde oder Schrei.
Ich verstand nichts. Wollte das ändern. Musste was tun, irgendwas, damit der Wahnsinn endet.
Getrieben vom inneren Drängen suchte ich die Lösung bei Männern, aber es kam lediglich zu Sex und anschließend weinte ich, ohne zu wissen warum. Meinen Freund liebte ich deswegen nicht weniger abgöttisch. Er konnte nicht nachempfinden, dass ich diese Erfahrung für mich machen musste und verließ mich.
In Wahrheit hatte ich herausfinden wollen, ob Sex ein Weg ist zur inneren Befreiung, zum inneren Frieden. Nein. Ist er nicht.
Zu spät kam diese Erkenntnis. Meinen Liebsten verloren zu haben schmerzte entsetzlich. Unwiderruflich von mir gelöst widerstand er allen Versuchen, ihn zurückzugewinnen. Verbindung gekappt, Nabelschnur durchtrennt. Mutterseelenallein, haltlos, desorientiert mit Schmerzen im Bauch wurde das Leben zur Qual. Jedes Erwachen ohne Hoffnung, nur endlose Leere und Angst, hundert Mal am Tag.
Unbewusst verstärkten in meinem System gespeicherte Emotionen aus der Zeit, als meine Mutter mich verließ, meinen derzeitigen Schmerz, das Grauen, das quälende Warten, das wachsende Entsetzen beim Begreifen, dass mein Symbiosepartner einfach nicht wiederkommt.
Etwas in mir wartete immer noch.
Ich weiß nichts, was mehr wehtut als Liebeskummer. Weit weg wollte ich, ganz weit weg, am liebsten raus aus meinem Körper und nicht wieder rein.
Mich vor Sehnsucht verzehrend rief ich ihn eines Nachts um halb vier in betrunkenem Zustand an. Er war mir nicht böse. Ich schluchzte ihm meine Verzweiflung ins Ohr, faselte vor mich hin, bis er sagte, er müsse jetzt los, seinen Wagen beladen mit den Sachen für den Flohmarkt, alles Gute, tschüss.
Alles Gute, tschüss, was fällt dem denn ein?! Will keine Verantwortung mehr für mich übernehmen?! Obwohl er genau weiß, dass ich alleine nicht lebensfähig bin? Hastig nahm ich noch einen Schluck aus der Flasche. In mir brodelte es wie in einem Vulkan. Vorsichtig taumelte ich die Stufen hinunter, bestieg meinen kleinen Fiat und fuhr langsam und so aufmerksam wie möglich in seine Richtung. Um diese Uhrzeit war die Stadt menschenleer. Vorschriftsmäßig blinkte ich, bog rechts ab und sah bereits die beiden Fenster seiner Wohnung am Ende der Häuserschlucht. Licht brannte nicht. Ich folgte der Straße um die Kurve. Irgendwo würde ich schon einen Parkplatz finden. Oh! Überrascht hielt ich inne. Sein blaumetallic leuchtender Wagen hob sich in der Dämmerung von den gräulichen Häuserfassaden ab. Er schob einen Gegenstand auf die Rückbank des Wagens, drehte sich herum und blickte mich an. Mein Herz raste. In meinem Kopf zog sich alles zusammen zu einem schwarzen Loch. Der vermeintliche Verursacher all meiner Schmerzen, schön und unschuldig, jetzt sollte er mein Leid zu spüren bekommen. Meine Gedanken flogen undenkbar schnell, strudelten, und ich ertrank darin. Die Augen geschlossen, visierte ich ihn mit dem Lenkrad an, blinzelte, wusste nicht, ob ich ihn treffen wollte oder sollte oder lieber nur das Auto. Doch einem plötzlichen Impuls folgend peilte ich genau und drückte aufs Gaspedal – bis es knallte! Erschrocken setzte ich zurück. Die Seite seiner hübschen, blauen Karosse war eingeknüllt. So sieht es also aus, wenn solche Kraft auf ein Auto trifft, staunte ich verwundert. Paralysiert stand er zwischen Tür und Rahmen, ein Stück weit in die Knie gesackt, kreidebleich im Gesicht. Noch einmal setzte ich an, zögerte. Ich weiß nicht, wie sehr ich ihn wirklich treffen wollte, ich liebte ihn doch auch. Aber ich war so wütend und traurig, verletzt und verzweifelt und so hundeelendig einsam. Seit ich mit vierzehn von ihm träumte, wollte ich ihn zum Mann. Mein einziger Halt, den sollte ich auch noch verlieren?!
Er rannte auf die andere Straßenseite.
Warum kam er nicht zu mir? Enttäuschung wallte auf, brachte den Schmerz erneut zum Siedepunkt. Abermals rammte ich die Seite seines Autos. Dann setzte ich zurück und machte den Motor aus. Welch plötzliche Ruhe.
Ich lehnte mich in den Sitz. In mir war es still. Ich schloss die Augen.
Jemand öffnete die Fahrertür. Eine uniformierte Hand packte mich am Arm.
„Kommen Sie mal raus da bitte!“
Wie aus einer anderen Welt entstieg ich meinem Auto.
„Würden Sie uns bitte folgen?“
In dem Gebäude nebenan erkannte ich die Polizeiwache. Wahrscheinlich haben mir die Herren durchs Fenster zugeschaut. Leugnen ist sinnlos.
Sie sperrten mich in die Ausnüchterungszelle, fuhren mich ein paar Stunden später nach Hause und kassierten bei der Gelegenheit meinen Führerschein ein.
Meine große Liebe verzichtete darauf, mich wegen versuchten Totschlags anzuzeigen.
Zum Glück! Sonst wäre ich vielleicht im Gefängnis gelandet.
Steckten mörderische Veranlagungen in mir? Könnte ich morden?
Nun hatte ich auch noch Angst vor mir selber. Und heute Abend soll ich auf der Bühne stehen und vor zweitausendfünfhundert Leuten singen. Mein Gott, das ist verrückt.
Doch selbst in dieser Lebenslage machte ich meine Arbeit professionell. Das Publikum klatschte, die Jungs von der Band waren wie üblich mit mir zufrieden.
Unser Sänger Will, ein Amerikaner, offerierte beiläufig: „Wenn du mal in die Staaten willst, sag mir Bescheid. Ich kenne da eine Menge Leute, bei denen kannst du wohnen.“
Ja, das kam mir gerade recht, Hauptsache weit weg. Nach Amerika wollte ich schon immer, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Insgeheim hegte ich die Hoffnung, einen Indianer zu treffen, in ein Gebiet vorzudringen, wo einer der letzten Stämme noch in seiner Urform lebt. Hundertprozentig würde ich bei ihnen bleiben, vorausgesetzt sie akzeptierten mich. Es war mir peinlich zur weißen Rasse zu gehören, die den Indianern ihren Lebensraum raubte, Keule gegen Atombombe eintauschte und sich zivilisiert nennt. Ich hasste die Weißen dafür, dass sie Völker entwurzelten und vernichteten, statt von ihnen zu lernen, wie man Mensch, Tier und Natur respektiert, eins wird mit der Schöpfung, wie man wieder Mensch wird, sich auf der Erde bewegt, ohne zu zerstören. Das wurde anscheinend im Laufe des Fortschritts vergessen.
Will gab mir zwei Telefonnummern.
Bevor ich meinen Flug buchte, rief ich in New York an. Eine Frau meldete sich. Ihre Stimme klang alt. Ich erklärte, ich hätte ihre Nummer von Will aus Deutschland und fragte, ob es ihr recht sei, wenn ich für ein paar Tage bei ihr einkehren würde, da ich niemanden kenne in Amerika.
„No problem“, erwiderte sie freundlich, nicht im geringsten überrascht über meine spontane Anfrage, „you’re welcome!“
Daraufhin buchte ich in den Flieger und trat meine Reise in die Vereinigten Staaten an.
Am Flughafen von New York bestieg ich ein Taxi. Der Fahrer redete ununterbrochen auf mich ein. Man müsse sehr aufpassen in Amerika, vor allem, wenn man das erste Mal hier sei. Es gäbe viele linke Vögel, die wollen einem ans Leder, ja, selbst Taxifahrer würden die Touristen nur allzu gerne ausnehmen wie Weihnachtsgänse, man solle sehr vorsichtig sein und niemandem trauen. Er selbst sei griechischer Herkunft, also gar kein richtiger Amerikaner, aber er wisse Bescheid, und deshalb warne er Neuankömmlinge wie mich.
Nachdem wir eine ganze Zeit lang gefahren sind, hielt er in einer Seitenstraße vor einem Mehrfamilienhaus.
Ich bezahlte die sechzig Dollar, die er verlangte, und ging mit meiner Reisetasche ins Haus.
Im dritten Stockwerk fand ich den Namen an der Haustür. Aufgeregt drückte ich den Klingelknopf. Hoffentlich ist überhaupt jemand zu Hause. Schon hörte ich Schritte über den Flur latschten. Die Tür öffnete sich. Vor mir stand die Mutter von Wills Freund. Unvorbereitet stutze ich: Sie war schwarz. Natürlich hatte ich schon Dunkelhäutige gesehen, nun aber sollte ich vorübergehend mit ihnen zusammen leben, auf dieselbe Toilette gehen, hautnah mit ihnen sein. Ich erschrak über mich selber, war ich etwa Rassist? Für einen Augenblick befielen mich Selbstzweifel, die glücklicherweise schnell meinem gesunden Menschenverstand wichen.
Fünf Minuten später plauderte ich mit der beleibten Dame in ihrer Küche bei einer Tasse Tee über Gott und die Welt. Nach weiteren fünf Minuten hatte ich unsere unterschiedlichen Hautfarben gänzlich vergessen. Wir begegneten uns einfach als Menschen. Ich verzieh mir meine kurze Verwirrung.
Als erstes fragte sie mich, wie viel Geld der Taxifahrer von mir genommen hätte.
Ich nannte den Preis.
“What? You paid sixty Dollar? The regular price is twenty-five, that fucking son of a bitch“.
Dem Taxifahrer war ich auf den Leim gegangen. Er wiegte mich in Sicherheit und wusste, er würde mich betrügen. So musste ich Lehrgeld zahlen für meine Naivität.
Die Mammy war wie eine Mutter zu mir. Ihr Sohn würde mir am nächsten Tag New York zeigen, alles, was ich sehen wolle, ich solle nur ja nicht alleine gehen, ich sähe ja, wie gefährlich es hier sei.
Am nächsten Morgen lernte ich ihren Sohn kennen, einen hochgewachsenen, hageren Burschen mit Schnauzbart über vollen Lippen. Lässig lehnte er im Türrahmen, verkündete seine Mutter sei ausgegangen, wir wären jetzt allein in der Wohnung.
„Soso, und du willst New York sehen. Was willst du denn sehen?“ Unverhohlen scannte er meine Körpermaße ab.
„Den Broadway.“ Sein Blick bereitete mir Unbehagen.
„Was hältst du davon, wenn wir Sex machen, bevor wir losgehen?“
Mein Atem stockte. Blitzschnell suchte ich fieberhaft eine passende Antwort. Wenn ich nein sage, fällt er womöglich über mich her. Ich kenne den Mann nicht, bin alleine mit ihm. Dass er Wills Freund ist, nützt mir jetzt wenig. Ist er überhaupt Wills Freund? Egal. Auf keinen Fall soll ihn meine Unsicherheit provozieren. Ich rang mir ein gequältes Lächeln ab. „Nö, lass uns lieber losgehen.“
Lange blickte er mich an, schweigend, etwas mitleidig, als sei ich einfach nur eine arme, dumme Sau, der nicht zu helfen ist. In breitem Amerikanisch ließ er ab: „Okay, du willst den Broadway sehen, ich werde dir den Broadway zeigen.“
Per Taxi gelangten wir über die pittoreske Brooklyn Brücke nach Manhattan. In einer eher ärmlichen Wohngegend mit holperigem Pflaster hieß der Fahrer uns aussteigen. Will ging voran zu einer kleinen Kreuzung.
„Please, Madame, this is the Broadway!“
Wollte er mir einen dummen Streich spielen? Weil ich nicht mit ihm ins Bett gegangen bin? Dies konnte unmöglich der Broadway sein ohne Reklameschilder, Cabarets und volle Straßen.
Genüsslich betrachtete er mein ungläubiges Gesicht, deutete mit dem Daumen auf das Straßenschild.
Tatsächlich. Broadway. Nicht zu fassen.
„Jaja,“ grinste er überheblich, „ihr auf der anderen Seite vom großen Teich meint immer, Broadway sei nur das Lichtermeer, das ihr aus dem Fernsehen kennt, aber der Broadway ist verdammt lang und er fängt genau hier an. Du brauchst nur diese Straße aufwärts zu gehen, irgendwann wirst du dort hinkommen, wo es so aussieht, wie du es erwartest. Und nun bye, ich habe noch zu tun. See you later.“ Weg war er.
Ich atmete tief durch und marschierte los, beobachtete die mir entgegen kommenden Menschen, die Autos, die Häuser, die Geschäfte, das Leben und Treiben New Yorks.
Mit jeder gelaufenen Stunde stieg die Anzahl der Fußgänger, der Fahrzeuge, Geschäftshäuser und Lichter. Die Straße bereits mehrspurig, erspähte ich in der Ferne die riesige Werbetafel unweit der Theaterhäuser, den berühmten Teil des Broadways. Das aus dem Fernsehen bekannte Bild live wiederzuerkennen, erfreute mich ungemein.
Auf einmal setzte mein Herz aus. Vor der Rolltreppe eines U-Bahnschachts lag ein Mann reglos am Boden, ein Farbiger, sein Kopf blutüberströmt. Passanten stiegen über ihn hinweg, als sei er eine herumliegende Plastiktüte. Vereinzelte drehten sich nach ihm um. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Soviel Ignoranz durfte doch nicht wahr sein. Geschockt, bewegungsunfähig, ein Loch im Kopf anstatt eines klaren Gedankens, schob mich die Menschenmenge vorwärts und ich ließ mich weiterschieben.
In meinem Hirn ratterte es. War der Mann tot? Wie kann ich ihm helfen? Wieso hilft niemand? Wird er verfolgt? Droht Gefahr, wenn ich ihm helfe? Dürfen Weiße hier überhaupt Schwarzen helfen oder bekomme ich dann mit allen Ärger?
Ohnmächtig und verzweifelt verurteilte ich mich dafür, vorbeigegangen zu sein, ohne einzugreifen, irgendwie auch Rassist zu sein. Ich unterteilte in Schwarz und Weiß, anstatt nur an den Menschen zu denken. Und ich war auch ein Egoist, wenn mich meine privaten Ängste davon abhielten, einem Menschen zu helfen, zumal die Befürchtungen nur in meinem Kopf stattgefunden haben. Wie feige! Ich verachtete mich zutiefst.
Betäubt vom Schock über dieses Erlebnis und meine eigene Unfähigkeit, trugen mich meine Beine über den Broadway hinaus in den Central Park.
Auf dem Rasen unter einem hohen Baum ließ ich mich nieder. Seine ausladenden Äste boten mir Schatten und ein Stück Geborgenheit. Langsam beruhigte sich mein Gemüt. Vogelgezwitscher erreichte mein Gehör, ich begann meine Umgebung wieder wahrzunehmen.
Neugierde und Faszination haben mich doch tatsächlich volle acht Stunden laufen lassen – und das mir, die in Deutschland jeden Meter mit dem Auto zurücklegte.
Bis Harlem war es nicht mehr weit. Das Slumviertel der farbigen New Yorker zog mich nicht nur an, weil viele Musiker dort geboren sind, sondern weil ich wissen wollte, wie es im Slum ist. Fernsehreportagen reichten mir nicht, ich wollte live hinein, fühlen, welche Atmosphäre herrscht inmitten der Unterdrückten, von der Gesellschaft an den Rand Gedrängten.
Instinktiv spürte ich, dass das gefährlich werden könnte für mich als Weiße so ganz alleine, und verwarf mein Vorhaben. Genug der Aufregung in den letzten zwei Tagen.
Von New York aus rief ich meine zweite Kontaktperson an, ein Mädchen namens Debbie mit Wohnsitz in Fort Lauderdale an der Küste Floridas.
Wie Wills Mutter schien auch Debbie keineswegs überrascht, von einem wildfremden Menschen angerufen zu werden. Sofort bot sie an, mich vom Flughafen Miami abzuholen. Sie gab mir eine Beschreibung von sich und wir machten einen Treffpunkt aus.
Am nächsten Tag saß ich im Flieger. Amerika ist groß. Der Flug dauerte über drei Stunden.
Meine Sitznachbarin, eine ältere Dame, fragte mich aus, wer ich sei, was ich in ihrem Land suche, stolz über ihren Kontakt zu einer jungen Europäerin. Offensichtlich war ich ihr sympathisch, sie gab mir ihre Adresse und forderte mich auf, unbedingt bei ihr Einkehr zu halten, wenn ich in Palm Springs vorbeikommen sollte.
Ich steckte den Zettel in meine Handtasche und versprach, bei Gelegenheit darauf zurückzukommen.
Nach der Landung in Miami traf ich auf Debbie. Mit einem riesigen, alten Rover holte sie mich ab.
Auf dem Weg registrierte ich, Miami ist eine Geschäftsstadt voller Wolkenkratzer, eine lückenlose Reihe von Hotelbauten versperrt den Zugang zum Strand. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Kaum in Debbies Apartment angekommen, zeigte sie mir Kühlschrank und Bad und teilte mir mit, sie müsse noch weg. „Feel at home and help yourself.“ Damit ließ sie mich allein. In Deutschland würde man einen fremden Menschen nicht bei sich in der Wohnung lassen. Hatte sie so viel Vertrauen zu mir oder war das eher Gleichgültigkeit?
Gegen Abend kam sie zurück, duschte, stylte ihre kurzen Haare, kleidete sich exklusiv in Schwarz, schminkte ihre Augen pechschwarz, Lippen dunkelrot und fuhr mit mir in eine Undergrounddisco. Eine Punkband spielte, zu laut zum Reden.
Beim Heimkehren zeigte sie mir, wo ihr Fahrrad zu finden sei, erklärte den Weg zum Beach, notierte die Telefonnummer ihrer Arbeitsstelle, falls Probleme auftauchen sollten, und ging zu Bett.
Ich rollte mich auf der Schlafcouch im Wohnzimmer in meinen Schlafsack und ließ den Tag Revue passieren. Debbie war wirklich freundlich, ich konnte mich nicht beklagen, aber irgendetwas fehlte mir trotz ihrer Offenheit und Gastfreundlichkeit, vielleicht war es Wärme.
Als ich erwachte, war sie fort. Voller Entdeckerlust eilte ich hinunter zum Fahrrad und radelte die Straße entlang, breit wie eine Autobahn, ohne Kurven, schnurgeradeaus.
Ein Hypermarkt erregte meine Aufmerksamkeit. Der Laden machte seinem Namen alle Ehre, ein Areal von der Grundfläche eines Dorfes, vorneweg ein gigantischer Parkplatz. Drinnen verirrt man sich zwischen endlosen Regalen. Unfassbar, wie viele Sorten Chips es geben kann, wie viele verschiedene Müslis. Allein die Knabberabteilung, so groß wie in Deutschland ein gesamtes Geschäft. In den Reihen mit Brot entdeckte ich Schwarzbrot. Sah zwar nicht aus wie bei uns, war ungewöhnlich weich, aber immerhin schwarz. Ich nahm ich es mit. Später entlarvte ich es als ganz normales, mit Zuckercouleur dunkel gefärbtes Weißbrot. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ja, da ist was dran.
In der Mittagshitze bestieg ich meinen Drahtesel, fuhr die Straße bis zum Ende durch und landete am Strand. Der Atlantik empfing mich mit klarem Hellblau. Aufgeheizt von der Sonne und vom Radfahren, freute ich mich auf das kühle Nass.
Doch oh! Was ist das? Null Temperaturunterschied. Das Wasser exakt so warm wie die Luft. In dieser riesigen Badewanne plantschte ich ausgelassen herum. Bis ich eine Filmszene erinnerte, in der ein Hai einem Menschen das Bein abbiss. Vorbei war's mit meiner Unbeschwertheit. Erschrocken hielt ich inne, inspizierte umsichtig die Meeresoberfläche. Ich war allein im Wasser, schwamm zügig an Land und legte mich in den Sand.
Ein junger Amerikaner gesellte sich zu mir, tat freundlich, war mir aber unangenehm. Als er begann, aufdringlich zu werden, packte ich meine Sachen und floh zu meinem Fahrrad.
Bestürzt stellte ich einen platten Reifen fest. Am Rad befand sich keine Luftpumpe. Weit und breit kein Radfahrer zu sehen, der mir eine Pumpe leihen könnte, schob ich es zur nächsten Telefonzelle und rief Debbie an. Sie blieb cool, holte mich ab und brachte mich nach Hause. Das war mir sehr unangenehm. Trotz ihrer Hilfsbereitschaft fühlte ich wieder diese unpersönliche Kühle. Gleich darauf kehrte sie zurück zur Arbeit. Ich überlegte, was ich tun könnte, um mobil zu werden. Auto mieten stand außer Frage, ich besaß keinen Führerschein mehr.
Abends erzählte ich Debbie von meinem Problem.
„Das ist kein Problem“, widersprach sie, „du holst dir einfach einen amerikanischen Führerschein. Wenn du sowieso schon fahren kannst, brauchst du nur den Fahrtest zu bestehen. Fertig.“
Ordentlich herausgeputzt besuchten wir eine andere Diskothek. Auch hier wurde Live-Musik gemacht, aber wie! Die Band glänzte nicht nur mit exzellentem Spiel, sondern beeindruckte zusätzlich mit einer ausgetüftelten Tanz-Show. Derart Professionelles siehst du in Deutschland in großen Sälen, nicht aber in einer gewöhnlichen Disco. In der Pause konnte ich ein Wort mit den Musikern wechseln. Sie machten das hier jeden Abend, drei Stunden Liveact, hochgradig anstrengend. Die ganze Band bekam dafür zu wenig Geld, als dass der Einzelne davon leben konnte. Unglaubliche Verhältnisse.
Anderntags begab ich mich zur Fahrschule, einem Gebäude mitten auf einer weitläufigen, asphaltierten Fläche, unterbrochen von Kantsteinen zum Einparken. Ein Prüfer setzte sich mit mir in einen der großen Amischlitten, dirigierte mich hundert Meter geradeaus, eine Kurve zu drehen und zwischen zwei Autos einzuparken. Zufrieden nickte er. Innerhalb von zehn Minuten hielt ich einen frisch gedruckten, amerikanischen Führerschein in der Hand, für ganze fünfzig Dollar. Juchhu!
Fröhlich schmiedete ich Pläne, ganz Florida zu durchqueren und mir berühmte Stätten anzusehen.
Ich mietete ein kleines Auto und machte mich auf den Weg, zunächst nach Palm Springs zu der älteren Dame aus dem Flugzeug. Natürlich wollte ich sie besuchen, denn Amerika kennenlernen hieß für mich auch, zu erfahren, wie die Einwohner in ihren Behausungen leben, welchen Flair sie darin verbreiten.
Die Frau wohnte in einer Anlage, zu der man ausschließlich Zugang durch eine Schranke erhielt. Dieses Privileg der Abgeschirmtheit gehörte nur den Reichen. Von einer Telefonzelle aus rief ich an. Niemand nahm ab. Ich parkte vor dem Haus auf der Straße und wartete. Nach fast zwei Stunden sah ich sie mit einer silberfarbenen Nobelkarosse ankommen. Die Schranke tat sich ihr auf, sie fuhr auf das Gelände. Ich stieg aus meinem Auto, rief ihr zu. Sie freute sich sehr mich zu sehen, umarmte mich wie eine alte Freundin und nahm mich mit in ihr Haus.
Ihr Wohnzimmer schien größer als meine gesamte Wohnung in Deutschland. Sie fragte, ob ich hungrig sei und führte mich in die Küche. Sie selbst sei gerade auf Diät, hätte deshalb nur Knäckebrot und Halbfettmargarine im Haus. Später sollte ihr Boyfriend kommen, dann wolle sie mit ihm und mir ausgehen.
Hier müssen anscheinend alle immer ausgehen mit ihrem Besuch, ich würde gerne mal zu Hause sitzen und mich unterhalten.
Den Abend verbrachten wir im Pub. Auf einer kleinen Seitenbühne spielte ein Quartett gepflegten Country. Livemusik war in den Staaten offenbar gang und gäbe, ein Stück Kultur, welches uns in Deutschland abhanden gekommen ist. Richtige Beachtung ernteten die Musiker allerdings nicht, sie fungierten eher als lebender Plattenspieler.
Selbstverständlich übernachtete ich bei meiner Gastgeberin. Als sie von meiner Absicht hörte, das berühmte Disney World in Orlando zu besuchen, griff sie sofort zum Telefon. Ohne mich zu fragen, verabredete sie, dass ich für die Zeit meines Aufenthaltes in Orlando bei ihrer Freundin samt Mann und Kindern wohnen werde.
Danke für diese wundervolle Fügung.
Auf der Strecke nach Orlando liegt Cape Canaveral. Von dort startete die erste Rakete zum Mond. Das musste ich sehen. Ein Shuttlebus fuhr uns Besucher durch das weitläufig eingezäunte Gebiet vorbei an verschiedenen Raketen, die viel kleiner sind, als ich dachte.
Zum Sonnenuntergang erreichte ich meine Kontaktadresse, eine schmucke Holzvilla mit Garten. Die Bewohner waren gerade im Begriff wegzufahren. Die Mutter zeigte mir den Kühlschrank, legte ein Handtuch raus, wies auf das Badezimmer und verabschiedete sich mit den freundlichen Worten: „Feel free and help yourself.“ Das hat Debbie auch gesagt.
Wieder allein in einem fremden Haushalt. Merkwürdig. Bei aller Gastfreundschaft. Ich könnte das Haus auf den Kopf stellen während ihrer Abwesenheit, was würden sie dann ihren Kindern zumuten? Fehlte den Eltern eine Art Beschützerinstinkt für ihr Heim oder bin ich zu engstirnig?
Drei Tage hielt ich mich bei der Familie auf, bekam sie kaum zu Gesicht, und das schien auch niemanden zu stören.
Den ersten Tag verbrachte ich von morgens bis abends in Disney World, der Superlative von Erlebnis-, Abenteuer- und Märchenpark. Den zweiten Tag im Epcot Center, der Welt in Kleinformat. In einem nachgebauten englischen Straßenzug beispielsweise steht ein englischer Pub, wo Ale ausgeschenkt wird. Daneben der auf drei Meter geschrumpfte Big Ben. Sämtliche Bedienstete tragen typisch englische Kleidung. Ähnliches gibt es für Dänemark, Russland, Japan und etliche weitere Länder. Unmöglich, sich alles an einem Tag anzusehen.
Zum Schluss meines Mammutprogramms besuchte ich Sea World, Shows mit Mörderwalen, Delphinen und Wasserskiballett.
Vollgestopft mit unzähligen Eindrücken rauchte mir der Kopf. Gleichzeitig hinterließ das Künstliche der Veranstaltungszentren in mir das Gefühl einer leeren Blase, als wäre ich innen hohl. Intuitiv suchte ich nach einem guten Gespräch mit bodenständigen Leuten.
In der Familie fand außer Smalltalk nichts statt.
Mit einem Geschenk verabschiedete ich mich und zog Richtung Everglades Nationalpark.
In solchen Fällen hilft Natur, immer da, niemals unpässlich, oberflächlich oder zu müde. Ich erkannte, der westlichen Welt fehlt Zugang zur inneren Natur, die Verbindung zwischen innerer und äußerer Natur. So verstehe ich das Indianerdasein. Man muss nicht rote Haut haben und im Zelt leben, man muss nur verbunden sein mit sich und der Natur. Früher haben wir Menschen rudelweise in, von und mit der Natur gelebt, im Kreislauf des Gebens und Nehmens. Dieser natürliche Instinkt ist uns durch die Zivilisation abhanden gekommen. Wir zerstören die Natur, uns selbst und andere.
Nur die Entwicklung eines neuen Bewusstseins für ein konstruktives Miteinander führt aus dem Leid.
Diese Erkenntnis besänftigte mich, es gab also einen Ausweg aus dem menschlichen Dilemma.
Die einmalige Sumpflandschaft der Everglades bedeckt den Süden Floridas, nicht zu verfehlen. Am Rande der Mangroven fand ich einen Seitenweg zu einer kleinen Station.
Die Amerikaner scheinen Künstliches in der Tat zu lieben. Neben dem Stationshäuschen entdeckte ich einen kreisförmigen Holzbohlenweg durch künstlich angelegtes Sumpfgebiet. Lieber wäre ich mit einem Propellergleitboot in die Natur hineingefahren, aber das wurde nicht angeboten.
Also flanierte ich durch dieses unnatürlich Natürliche. Ein undefinierbares Geräusch hinter mir ließ mich herumschnellen. Einen Meter von meinen Füßen entfernt stand ein Alligator. Ungefähr anderthalb Meter lang. Wie versteinert guckte er mich an. Ich wusste nicht so recht, ob ich jetzt Angst haben sollte oder nicht. Vielleicht ist er auch nur eine Imitation. Nein, er lebte. Da ich keine Angst verspürte, blieb ich stehen.
Gegenseitig betrachteten wir uns.
Ist schon ein tolles Gefühl, so einem Urviech zu begegnen. Dieses kleine Krokodil, entsprungen aus einer der wenigen überlebenden Arten aus der Zeit der Dinosaurier, rief etwas in mir wach. Auf einmal war ich total präsent, fühlte mich mir selbst und allen Lebewesen auf der Erde nahe. Weich, warm und voller Liebe. Leider verflüchtigte sich dieses schöne Gefühl nach einer Weile. Doch habe ich nicht aufgehört, es wiederfinden zu wollen.
Noch am selben Tag verließ ich die Everglades, entschlossen, zum südöstlichen Ende von Amerika zu reisen, nach Key West, der kleinen Inselkette an der äußersten Spitze Floridas.
Die verbindende Inselstraße, rechts und links von Meer begleitet, endet vor der Karibik. Das Auto geparkt, ging ich die letzten Meter zu Fuß.
Auf dem Platz am Endpunkt versammelten sich jeden Abend Touristen sowie Einheimische zum Sonnenuntergang, um diesem Naturschauspiel zuzusehen. Ich genoss den frischen Wind und die Freiheit, hinfahren und bleiben zu können, wo es mir gefiel. Ein Trostpflaster für mein rastloses Gemüt. Keine äußere Freiheit kann befreien von dem, was einen innerlich gefangen hält.
Ein junger Mann auf einem Stein fiel mir auf wegen seiner besonderen Ausstrahlung. Wir grüßten uns. An seinem Hallo hörte ich, er muss Deutscher sein. Sofort stellten wir uns gegenseitig die Frage: „Was machst du denn hier so alleine?“
Offenherzig vertraute er mir an, vor einem halben Jahr erfahren zu haben, dass er unheilbar krank sei. Aids. Die Ärzte schätzten seine Lebenserwartung auf höchstens zwei Jahre.
Oha! Plötzlich konfrontiert mit einem Tod Geweihten. Ich hatte völlig vergessen, dass wir alle dem Tod geweiht sind, früher oder später, aber auf sicher. Diese Sicherheit ist die sicherste, die wir haben, und es ist nicht verkehrt, sich mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen. Der Tod ist Bestandteil des Lebens.
Der Mann erschütterte und faszinierte mich zugleich. Die ihm verbleibende Zeit gedachte er, hier zu verbringen, am Ende der Welt, passend zu seinem Zustand. Wir sprachen über das Leben und über den Tod. Schließlich lud er mich zu sich nach Hause ein. Das verunsicherte mich, ich wusste wenig über diese Krankheit, nur dass sie sehr ansteckend sei, aber konnte man sich nicht nur über Blut oder Schleimhaut anstecken? Verlegen verbarg ich meine Angst vor Ansteckung, obwohl er mir wahrscheinlich medizinisch alles genau hätte erklären können. Ich wollte seine Einladung nicht ausschlagen, er war doch bereits Außenseiter der Gesellschaft, also ging ich mit. In seiner Wohnung bewegte ich mich nur sehr vorsichtig. Als ich auf die Toilette musste, wuchsen meine Befürchtungen, da ich dies für einen Ort der Ansteckungsgefahr hielt. Ich schämte mich. Nicht über meine Angst zu sprechen, war töricht, dennoch wollte ich ihn nicht wie einen Aussätzigen behandeln.
Die Einfachheit und Klarheit, mit der er über seinen Tod sprach, hatte etwas Ergreifendes an sich, nichts Beängstigendes. Trotz seiner Jugend schien er sich mit dem Tod angefreundet zu haben. Seine innere Stärke berührte mich tief. Mit einem Bein im Grab schien er irgendwie mehr da zu sein als diejenigen, die mitten im Leben stehen.
Was ich täte, wenn ich erfahren würde, dass ich nur noch zwei Jahre zu leben hätte? Ich weiß es nicht, habe aber im Grunde keine andere Wahl, als den Tod mit ins Leben einzubeziehen. Möglicherweise entscheide ich mich in der einen oder anderen Lebenssituation anders, wenn ich den Tod mit im Blick habe. Vielleicht kann ich schon mal einige Dinge vorher sterben lassen, bevor ich selber sterbe. Zum Beispiel Rachegefühle irgendjemandem gegenüber oder alte, verhärtete Wut, sämtliche Besitzansprüche. Ich bräuchte mich selbst nicht mehr so fürchterlich wichtig zu nehmen, bin nur einer von vielen, die auch alle sterben müssen. Kann eigentlich jedwede Gefühle sterben lassen, nachdem sie gefühlt sind, jegliche Gedanken, nachdem sie einmal gedacht sind, ja, jede Sekunde müsste ich sterben lassen, um die nächste in vollen Zügen genießen zu können. Mein ganzes Leben ist in Wahrheit ein Sterbeprozess. In jeder Sekunde sterben Körperzellen. In sieben Jahren ist nicht eine einzige Zelle mehr übrig, habe ich mich vollkommen erneuert, bin ich tatsächlich nicht mehr die alte. Ich sterbe ständig und erneuere mich ständig. Alle, die schon mal tot waren und wieder ins Leben zurückgeholt worden sind, erzählen das gleiche, es wird ganz hell und es ist schön. Wenn ich jede Sekunde sterben lasse, um mich an der nächsten zu erfreuen, muss mein Leben auch hell und schön werden. Nur – wie macht man das?
Den jungen Aidskranken verließ ich mit bewegtem Herzen. Die Nacht war schon hereingebrochen, ich schlief im Auto auf dem großen Platz vor der Kirche. Gottes Haus würde mich beschützen.
Am Morgen weckte mich die Sonne. Ich schlenderte durch die Straßen, um das besondere Ambiente an diesem Endpunkt der Welt auszukosten. Zwischen den Häusern gab es mehrere richtige Saloons wie im wilden Westen. Zu meiner Überraschung herrschte schon morgens um zehn reges Treiben. Bands spielten in allen Pubs originale Western-Musik mit Geige und Mundharmonika. Ich kam am Haus von Ernest Hemingway vorbei, konnte mir gut vorstellen, wie er hier Inspirationen für seine Bücher empfing. Dieser Platz Key West war wirklich speziell.
Die zwei Wochen, die ich das Mietauto gebucht hatte, näherten sich dem Ende.
Ich trat meine Rückreise an, blieb noch einen Tag bei Debbie und flog anschließend über New York nach Deutschland.
Das war meine Amerikareise. Nicht gefunden, was ich erhoffte, hatte ich jedoch etwas erworben: Die Gewissheit, weit weg von zu Hause, von allem, was mir vertraut ist, sein und überleben zu können.
Meine ersten Flugversuche sind zufriedenstellend verlaufen.