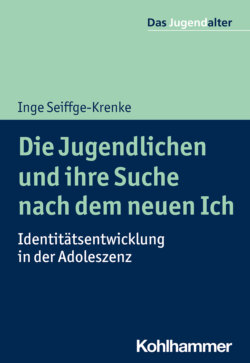Читать книгу Die Jugendlichen und ihre Suche nach dem neuen Ich - Inge Seiffge-Krenke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Das Phasenmodell der menschlichen Entwicklung
ОглавлениеErikson entwickelte das Phasenmodell zusammen mit seiner Frau Joan Erikson (1903–1997) – er hatte nicht studiert, sie dagegen schon. Er selbst gab später an, er könne seinen eigenen Anteil von dem ihren nicht unterscheiden; auch die Tochter beschreibt das Arbeiten der Eltern explizit und ausführlich als »Arbeitsteilung«. Dabei führte die wechselseitige emotionale Abhängigkeit zu zahlreichen Spannungen, die jedoch nicht offen thematisiert wurden. Darüber hinaus übersetzte bzw. korrigierte Joan seine Arbeiten, da sie Englisch als Muttersprache gelernt hatte. In seinen letzten Jahren und nach seinem Tod entwickelte sie das gemeinsame Modell weiter und ergänzte eine 9. Lebensphase des hochbetagten Alters.
Erikson beschreibt in diesem Stufenmodell die psychosoziale Entwicklung des Menschen. Diese entfalte sich im Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen und Wünschen des Individuums und den sich im Laufe der Entwicklung permanent verändernden Anforderungen der sozialen Umwelt. Eriksons Entwicklungstheorie spricht den Beziehungen bzw. der Interaktion des Kindes mit seiner personalen (und gegenständlichen) Umwelt eine wesentliche Rolle für die psychische Entwicklung zu. Im Vergleich zu Freuds Modell gibt er dem Unbewussten und der psychosexuellen Dimension weniger Raum. Erikson erweiterte damit auf der Grundlage der Freudschen Phasen infantiler Triebentwicklung die Psychoanalyse um die psychologische Dimension der Ich- und Identitätsentwicklung im gesamten Lebenslauf. Erikson hat immer vor der unkritischen Ausblendung von Ängsten und Konflikten gewarnt, und so ist es auch zu verstehen, dass er in seinem Phasenmodell jede Entwicklungsstufe, die von ihm als normative Krise bezeichnet wird, durch Polaritäten einer geglückten und einer problematischen Entwicklung gekennzeichnet wird.
Dabei wird angenommen, dass diese Phasen altersspezifisch aufeinander aufbauen, d. h. die Lösung einer altersspezifischen Krise die Voraussetzung für das Voranschreiten der Entwicklung und die Lösung der folgenden Krise ist. Kritisch ist zu bemerken, dass die Vorstellungen der persönlichen Reife teilweise etwas Normatives haben und insbesondere in den letzten 3 Phasen stark am Familienzyklus orientiert sind. Die ersten Phasen sind auch noch sehr deutlich an die Freud’sche Entwicklungstheorie angelehnt.
Die acht Phasen der psychosozialen Entwicklung nach Erikson (1959, dt. 1971)
Phase 1: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (1. Lebensjahr)
Das Gefühl des Ur-Vertrauens bezeichnet Erikson (1971) als ein »Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens« (ebenda: S. 62). Hierzu ist das Kind auf die Verlässlichkeit der Bezugspersonen angewiesen. Die Bindung zu der Mutter und die damit verbundene Nahrungsaufnahme spielt eine bedeutende Rolle, da sie die erste Bezugsperson, die Welt, repräsentiert. Werden dem Kind Forderungen nach körperlicher Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, Nahrung etc. verweigert, entwickelt es Bedrohungsgefühle und Ängste, da eine weitgehende Erfüllung dieser Bedürfnisse lebenswichtig ist. Außerdem verinnerlicht es das Gefühl, seine Umwelt nicht beeinflussen zu können und ihr hilflos ausgeliefert zu sein. Hier entsteht die Gefahr der Etablierung eines Ur-Misstrauens. Es können infantile Ängste des Verlassenwerdens entstehen (ebenda.S. 63).
Phase 2: Autonomie vs. Scham und Zweifel (1. bis 3. Lebensjahr)
Erikson bezeichnet dieses Stadium als »entscheidend für das Verhältnis zwischen Liebe und Hass, Bereitwilligkeit und Trotz, freier Selbstäußerung und Gedrücktheit« (ebenda S.76). Beschrieben werden die zunehmende Autonomieentwicklung des Kindes und ihre Bedeutung für die Manifestierung eines positiven Selbstkonzeptes bzw. einer Identität. Die Bedingung für Autonomie wurzelt in einem festen Vertrauen in die Bezugspersonen und sich selbst, setzt also die Bewältigung der Phase »Vertrauen versus Misstrauen« voraus. Das Kind muss das Gefühl haben, explorieren oder seinen Willen durchsetzen zu dürfen, ohne dass dadurch das Vertrauen-Können und Geborgen-Sein in Gefahr gerät. Hier spielt Erikson zufolge die Emotion Scham eine wichtige Rolle. Die weitgehende oder permanente Einschränkung der explorativen Verhaltensweisen des Kindes führt dazu, dass es seine Bedürfnisse und Wünsche als schmutzig und nicht akzeptabel wahrnimmt. Was sich somit beim Kind etabliert ist schließlich Scham und der Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Wünsche und Bedürfnisse.
Phase 3: Initiative vs. Schuldgefühle (3. bis 5. Lebensjahr)
Findet das Kind mit vier oder fünf Jahren zu einer bleibenden Lösung seiner Autonomieprobleme, steht es Erikson zufolge bereits vor der nächsten Krise. Er legt hier seinen Fokus stark auf die Bewältigung oder Nichtbewältigung des Ödipuskomplexes. Die symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind öffnet sich, und das Kind erkennt die Bedeutung anderer Personen im Leben der Mutter. Weiter geht es in erster Linie um eine gesunde Meisterung der kindlichen Moralentwicklung. Die Grundlage für die Entwicklung des Gewissens ist gelegt, das Kind fühlt sich unabhängig von der Entdeckung seiner »Missetaten« beschämt und unwohl. »Gegebenenfalls verinnerlicht das Kind die Überzeugung, dass es selbst und seine Bedürfnisse dem Wesen nach schlecht seien.« Im Gegenzug dazu beschreibt Erikson das Kind, welches diese Krise bewältigen kann, als begleitet vom Gefühl »ungebrochener Initiative als Grundlage eines hochgespannten und doch realistischen Strebens nach Leistung und Unabhängigkeit« (ebenda S. 87f).
Phase 4: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. Lebensjahr bis Pubertät)
Kinder in diesem Alter wollen zuschauen, mitmachen, beobachten und teilnehmen; wollen, dass man ihnen zeigt, wie sie sich mit etwas beschäftigen und mit anderen zusammenarbeiten können. Das Bedürfnis des Kindes, etwas Nützliches und Gutes zu machen, bezeichnet Erikson als Werksinn bzw. Kompetenz. Kinder wollen nicht mehr »so tun, als ob« – jetzt spielt das Gefühl, an der Welt der Erwachsenen teilnehmen zu können, eine große Rolle. Sie wollen etwas herstellen und dafür Anerkennung erhalten, ebenso für ihre geleisteten kognitiven Fähigkeiten. Dem gegenüber steht in dieser Phase die Entwicklung eines Gefühls der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit. Dieses Gefühl kann sich immer dann etablieren, wenn der Werksinn des Kindes überstrapaziert wird. Überschätzung – ob vom Kind oder von seiner Umwelt ausgehend – führt zum Scheitern, Unterschätzung zum Minderwertigkeitsgefühl.
Phase 5: Ich-Identität vs. Ich-Identitätsdiffusion (Jugendalter)
Identität bedeutet, dass man weiß, wer man ist und wie man in diese Gesellschaft passt. Aufgabe des Jugendlichen ist es, all sein Wissen über sich und die Welt zusammenzufügen und ein Selbstbild zu formen, das für ihn und die Gemeinschaft gut ist. Seine soziale Rolle gilt es zu finden. Ist eine Rolle zu strikt, die Identität damit zu stark, kann das zu Intoleranz gegenüber Menschen mit anderen Haltungen führen. Der Druck der Peer-Group kann dazu führen, »den anderen [Fremden]« nicht zu akzeptieren. Mit einer noch nicht gefestigten eigenen Identität kann der Jugendliche sich im seltensten Fall von der Meinung seiner Peer-Group absetzen und seine eigene Meinung bilden. Schafft der Jugendliche es nicht, seine Rolle in der Gesellschaft und seine Identität zu finden, führt das nach Erikson zu Zurückweisung. Menschen mit dieser Neigung ziehen sich von der Gesellschaft zurück und schließen sich unter Umständen Gruppen an, die ihnen eine gemeinsame Identität anbieten.
Phase 6: Intimität vs. Isolation (frühes Erwachsenenalter)
Aufgabe dieser Entwicklungsstufe ist es, ein gewisses Maß an Intimität zu erreichen, anstatt isoliert zu bleiben. Die Identitäten sind gefestigt, und es stehen einander zwei unabhängige Egos gegenüber. Es gibt viele Dinge im modernen Leben, die dem Aufbau von Intimität entgegenstehen (z. B. Betonung der Karriere, großstädtisches Leben, die zunehmende Mobilität). Wird zu wenig Wert auf den Aufbau intimer Beziehungen (was auch Freunde etc. mit einbezieht) gelegt, kann das nach Erikson zur Exklusivität führen, was heißt, sich von Freundschaften, Liebe und Gemeinschaften zu isolieren. Wird diese Stufe erfolgreich gemeistert, ist der junge Erwachsene fähig zur Liebe. Damit meint Erikson die Fähigkeit, Unterschiede und Widersprüche in den Hintergrund treten zu lassen.
Phase 7: Generativität vs. Stagnation und Selbstabsorption (Erwachsenenalter)
Generativität bedeutet die Liebe in die Zukunft zu tragen, sich um zukünftige Generationen zu kümmern, Kinder großzuziehen. Erikson zählt dazu nicht nur eigene Kinder zu zeugen und für sie zu sorgen, sondern auch das Unterrichten, die Künste und Wissenschaften und soziales Engagement. Also alles, was für zukünftige Generationen »brauchbar« sein könnte. Stagnation ist das Gegenteil von Generativität: sich um sich selbst kümmern und um niemanden sonst. Zu viel Generativität heißt, dass man sich selbst vernachlässigt zum Wohle anderer. Stagnation führt dazu, dass Niemand so wichtig ist wie wir selbst. Wird die Phase erfolgreich abgeschlossen, hat man die Fähigkeit zur Fürsorge erlangt, ohne sich selbst dabei aus den Augen zu verlieren.
Phase 8: Ich-Integrität vs. Verzweiflung (reifes Erwachsenenalter)
Der letzte Lebensabschnitt stellt den Menschen vor die Aufgabe, auf sein Leben zurückzublicken. Anzunehmen, was er getan hat und geworden ist, und den Tod als sein Ende nicht zu fürchten. Angst vor dem Tod oder auch der Glaube, noch einmal leben zu müssen, etwa um es dann besser zu machen, führen zur Verzweiflung. Setzt sich der Mensch in dieser Phase nicht mit Alter und Tod auseinander (und spürt nicht die Verzweiflung dabei), kann das zur Anmaßung und Verachtung dem Leben gegenüber (dem eigenen und dem aller) führen. Wird diese Phase jedoch erfolgreich gemeistert, erlangt der Mensch das, was Erikson Weisheit nennt – dem Tod ohne Furcht entgegensehen, sein Leben annehmen und trotzdem die Fehler und das Glück darin sehen können.
Jede der acht Phasen stellt demnach eine Krise dar, mit der das Individuum sich aktiv auseinandersetzten sollte. Die Stufenfolge ist für Erikson unumkehrbar. Die erfolgreiche Bewältigung einer Entwicklungsphase liegt in der Klärung des Konflikts auf dem positiv ausgeprägten Pol. Die vorangegangenen Phasen bilden somit das Fundament für die kommenden Phasen, und angesammelte Erfahrungen werden verwendet, um die Krisen der höheren Lebensalter zu verarbeiten. Dabei wird ein Konflikt nie vollständig gelöst, sondern bleibt ein Leben lang aktuell, war aber auch schon vor dem jeweiligen Stadium als Problematik vorhanden. Das wird besonders deutlich beim Identitätsthema, wie noch zu zeigen sein wird.
Die erste Fassung des Stufenmodells wurde 1950 im Buch Childhood and Society unter »Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit« veröffentlicht. Es ist interessant zu sehen, dass es offenkundig nicht ganz einfach ist, die Phase, in der man gerade steht, konzeptuell zu bearbeiten. Erikson ist selbst ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Regel nicht den Blick hat für die eigene Entwicklungsphase, sondern das dies eher durch eine Sicht von außen ermöglicht wird (Seiffge-Krenke, 2012a):
Das siebte Stadium Generativität war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Wie ist es entstanden? Erikson war mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Vortrag; von Berkeley aus wollte er den Zug nach Los Angeles nehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie drei kleine Kinder. Während der Autofahrt von Berkeley zur Train Station San Francisco amüsierten sie sich darüber, dass Shakespeare, als er die »Seven ages of men« aus »As you like it« beschrieben hat, komplett das Play Stage vergessen hatte, und kamen sich sehr weise vor. »Oh Schreck, er hat sieben Stadien und das Spielstadium vergessen. Haben wir nicht auch sieben Stadien? Was haben wir eigentlich übersehen? Wir sind von Intimität, Stadium 6, zu Integrität im höheren Erwachsenenalter, Stadium 7, gesprungen«. Während der Autofahrt, die Zeit eilte, haben Erikson und seine Frau relativ schnell ein neues, ein siebtes Stadium entwickelt, die Generativität. Interessanterweise sind sie auf das Stadium, in dem sie sich selber befanden, Generativität, erst durch einen Zufall gekommen (Erikson, 1982/1997).
Nach Eriksons Tod hat seine Frau Joan eine Weiterentwicklung des Modells vorgelegt, in dem sie 9 Phasen postuliert (Erikson, 1982/1997). Die letzte Phase der Gerotranszendenz setzt sich mit dem Altern und dem Tod auseinander. Sie ordnet sie den 80- und 90-Jährigen zu, die sich mit körperlichen Einschränkungen und Verfall, Aufgeben der Autonomie beschäftigen müssen, und nennt sie »a second childhood without play« (Erikson 1982/1997, S. 118). Die Perspektive liegt hier auf dem Kosmischen, Transzendenten, dem Eins-Sein mit der Welt.