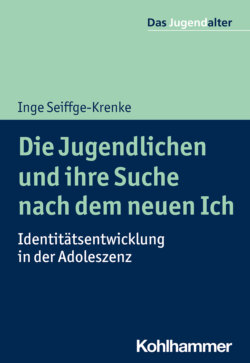Читать книгу Die Jugendlichen und ihre Suche nach dem neuen Ich - Inge Seiffge-Krenke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Erik H. Erikson: Der Begründer der psychoanalytischen Identitätstheorie und seine ganz persönliche Identitätskrise
ОглавлениеEriksons Mutter Karla Abrahamsen stammte aus Kopenhagen und wuchs in einer gut situierten jüdischen Familie auf. Ihr Ehemann, der Börsenmakler Valdemar Salomonsen, verließ sie kurz nach der Hochzeit, und Karla Abrahamsen ging nach Deutschland. Damals war sie bereits schwanger, Salomonsen war jedoch nicht der Vater des Kindes. Diese Unkenntnis, wer sein leiblicher Vater war, belastete Erikson sein Leben lang. Er erfuhr es weder von seiner Mutter noch durch intensive Nachforschungen, die er sein Leben lang anstellte. Er selbst hatte die Vorstellung, dass sein Vater ein dänischer Adeliger war.
Die ersten drei Jahre wuchs Erikson in Frankfurt bei seiner Mutter mit dem Namen Erik Abrahamsen auf. Im Jahr 1905 heirateten seine Mutter und der jüdische Kinderarzt Theodor Homburger, der das Kind behandelt hatte. Erikson bekam jetzt den Nachnamen des Stiefvaters und hieß fortan Erik Homburger. Die Familie zog nach Karlsruhe. Während seiner gesamten Kindheit wurde ihm verheimlicht, dass sein Stiefvater nicht sein biologischer Vater war. Erikson hatte zwei Halbschwestern, Ellen und Ruth.
Erikson war also der Sohn einer dänischen Jüdin, er hatte einen jüdischen Stiefvater und verbrachte die meiste Zeit seiner Kindheit im wilhelminischen Karlsruhe. Manche antisemitischen Angriffe während seiner Schulzeit machten aus ihm einen scheuen und zurückhaltenden Jugendlichen. Nach dem Besuch des Karlsruher Bismarck-Gymnasiums studierte Erikson teilweise an einer Kunstakademie. Mit der Weigerung, die von den Eltern gewünschte Arztlaufbahn einzuschlagen, folgte nach dem Abitur ein langes krisenhaftes Moratorium. Immer wieder brach Erikson den Versuch, eine künstlerische Ausbildung zu absolvieren, ab. Darauf folgten Wanderjahre teilweise als Künstler und eine innere Unausgeglichenheit, die ihn später, wie er schreibt (Erikson, 1982), zu dem Thema der Identitätskrise disponierte.
Anschließend arbeitete er als Hauslehrer einer amerikanischen Familie in Wien. Sein Schulkamerad Peter Blos hatte ihn nach Wien geholt, als Lehrer an der Burlingham-Rosenfeld-Schule. Erikson war zu jener Zeit Mitte zwanzig und verstand sich selbst als Künstler. Er machte hauptsächlich Holzschnitte und hatte immerhin schon gemeinsam mit Max Beckmann und Wilhelm Lehmbruck in München ausgestellt. Er war an der Kunstakademie eingeschrieben, machte sich aber, rastlos und jugendbewegt, wie er war, immer wieder auf die Wanderschaft und verbrachte eine Zeit in der Toskana. Rückblickend schreibt er: »Ich war zu jener Zeit wohl ein ›Bohemien‹.« Erst in der Wiener Zeit und nur mit Hilfe seines Freundes Peter Blos habe er »regelmäßig arbeiten« gelernt (Erikson 1982, S. 27f.). Über die Familie Burlingham entstand 1927 der Kontakt zur psychoanalytischen Bewegung. Erikson lernte Anna Freud kennen und machte bei ihr seine Lehranalyse als Teil seiner psychoanalytischen Ausbildung. Bekannt wurde er auch mit Sigmund Freud, Paul Federn, Heinz Hartmann, Ernst Kris, Eva Rosenfeld und Helene Deutsch. Das unkonventionelle Klima der frühen Psychoanalyse, die Entlarvung bürgerlicher Heuchelei, übte auf Erikson einen unwiderstehlichen Reiz aus. Hier fand er Ideen, die ihm berufliche und weltanschauliche Identität vermittelten. Er gab die Malerei auf, unterzog sich einer Lehranalyse und ließ sich zum Psychoanalytiker ausbilden. Seine Heirat in diesen Jahren war ein weiterer Faktor für nun zunehmende Stabilität in seinem Leben.
In Wien lernte Erik Erikson 1929 seine spätere Ehefrau, die kanadische Erzieherin und Tanzwissenschaftlerin Joan Serson, kennen. Zwischen 1931 und 1944 hatte das Ehepaar insgesamt vier Kinder: Kai Theodor (* 1931), Jon (* 1933), Sue (* 1938) und Neil (* 1944). Seine Frau Joan wurde seine wichtigste Mitarbeiterin. Das Familienleben war trotz sehr viel Harmonie und Kreativität eher konventionell und von »Mustern des Schweigens« geprägt sowie von der damals üblichen eher distanzierten Beziehung des Vaters zu seinen Kindern, wie seine Tochter beschreibt:
»Er hatte das Aufziehen der Kinder schon immer meiner Mutter überlassen, weil er sich selbst in all diesen Dingen für erbärmlich inkompetent, meine Mutter dagegen für außerordentlich begabt hielt.«
Da bei Neil nach der Geburt das Down-Syndrom festgestellt wurde, traf Erikson ohne Wissen seiner Ehefrau die Entscheidung, das Kind in ein Heim zu geben. Dies wurde sowohl innerhalb der Familie als auch nach außen tabuisiert – die Familie zog fort, und es bestand kein Kontakt zu dem Kind. Neil starb mit 21 Jahren. Das Aufrechterhalten einer perfekten Fassade belastete die Familie schwer.
Nachdem die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht erlangt hatten, emigrierte Erikson mit seiner Frau und seinem ersten Sohn Kai von Wien über Kopenhagen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Er ließ sich in Boston nieder und eröffnete die erste Praxis für Kinderpsychoanalyse in der Stadt. Nach der Ankunft in den USA änderte das Ehepaar den bisherigen Familiennamen »Homburger«: Der Sohn Kai bekam stattdessen den Nachnamen »Erikson« – von »Eriks Sohn« in Anlehnung an skandinavische Traditionen der Nachnamensgebung. Auch Joan und die später geborenen Kinder erhielten diesen Familiennamen. Lediglich Erikson selbst behielt den Nachnamen seines Stiefvaters als mittleren Bestandteil seines Namens: »Erik H. Erikson«.
Eriksons Ideen über Kultur und Gesellschaft wurden beflügelt durch die Bekanntschaft mit A. Kroeber, einem deutschen Anthropologen, der in Berkeley einen der letzten Überlebenden der Yahi-Indianer in die westliche Zivilisation gebracht und die Anpassungsversuche von Ishi beobachtet und beschrieben hatte. Zusammen mit Kroeber lebte er im Jahr 1938 eine Zeitlang mit einer Untergruppe der Sioux-Indianer, den Oglaja, im Pine Ridge Reservat, Süd Dakota, zusammen und analysierte deren Zusammenleben und die Kindererziehung. Im folgenden Jahr wurde Erikson amerikanischer Staatsbürger. Später reiste er auch an die nordkalifornische Westküste, um den indianischen Fischerstamm der Yurok zu studieren. Beide Indianerstämme hatten sehr verschiedene Lebensräume und entwickelten auch sehr verschiedene Identitäten.
Nach seiner Emigration – er war von 1934 bis 1970 als Psychotherapeut, Dozent, Berater und schließlich als Hochschullehrer tätig – blieb das Werk von Sigmund Freud seine wichtigste geistige Prägung. In seiner Weiterentwicklung Freudianischer Ideen, mit seiner Stufenfolge der Entwicklung und der Identitätstheorie bezeichnete er sich als Stiefsohn Freuds. In den USA wurde er schließlich – ohne jemals ein Universitätsstudium absolviert zu haben – Professor für Entwicklungspsychologie an den Elite-Universitäten Berkeley und Harvard. Im Jahr 1959 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. In Harvard entwickelte und veröffentlichte er sein berühmt gewordenes Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung, das auf dem Freudschen Modell psychosexueller Entwicklung aufbaut. Es untergliederte die Entwicklung des Menschen von seiner Geburt an bis zum Tod in acht Phasen. In jeder dieser Phasen des Entwicklungsmodells kommt es zu einer entwicklungsspezifischen Krise, deren Lösung den weiteren Entwicklungsweg bahnt. Das Schlüsselkonzept Eriksons zum Verständnis der menschlichen Psyche ist die Identität bzw. die Ich-Identität.
Neben der Kinder- und Entwicklungspsychologie beschäftigte sich Erikson auch mit Ethnologie. Erikson verfasste ab den 1950er Jahren psychoanalytisch orientierte Biografien über Martin Luther und Mahatma Gandhi, unter anderem im Zusammenhang mit dem von ihm begründeten Begriff der Generativität. Unter Generativität versteht Erikson im weitesten Sinne den Drang zu helfen, zu heilen, für die nächste Generation zu sorgen, etwas zum Gemeinwohl beizutragen. Mit seinem Buch über Luther wurde er zu einem Vorreiter der Psychohistorie. Für die Biografie über Mahatma Gandhi (Gandhi’s Truth, 1969) erhielt Erikson 1970 den Pulitzer-Preis. Zahlreiche weitere Ehrungen und Preise krönten das Lebenswerk des genialen Autodidakten (Conzen, 2017).
Mitte der 1980er Jahre begann Erikson sich emotional und geistig immer mehr zurückzuziehen. In dieser Phase setzte seine Frau die Arbeit zunehmend alleine fort. Zeit seines Lebens kämpfte Erikson mit einer Neigung zur Depression. Er litt unter Gefühlen der eigenen Wertlosigkeit, Unsicherheit und Unzulänglichkeit. Als er 1929 seine Frau kennenlernte, hatte er sich gerade von einer schweren Depression erholt. Seine Frau wurde ihm aufgrund ihrer emotionalen Stärke lebenslang zu einer unverzichtbaren Stütze.