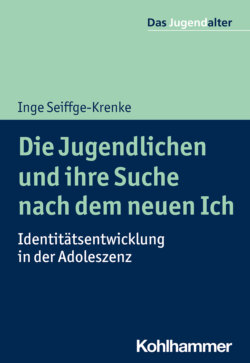Читать книгу Die Jugendlichen und ihre Suche nach dem neuen Ich - Inge Seiffge-Krenke - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Eriksons Konzept der Identitätsentwicklung im Jugendalter
ОглавлениеDas Jugendalter wurde erstmals von Erikson (1968) als eine Phase beschrieben, die für den lebenslangen Prozess der Identitätsentwicklung von herausragender Bedeutung ist. In seiner Theorie der psychosozialen Entwicklung nahm er an, dass acht Themen lebenslang identitätsrelevant sind, von denen jeweils eines altersabhängig besonders drängend und krisenhaft ist. Die aktive Auseinandersetzung mit der jeweiligen lebensphasentypischen Krise ist dabei für die Bewältigung der nachfolgenden Krise hilfreich. Sein Modell ist also eine Stufenfolge von aufeinander aufbauenden Entwicklungsschritten mit spezifischen Herausforderungen, die jeweils gelöst werden müssen. Obwohl er annahm, dass der generelle Zeitplan des Durchlaufens der phasenspezifischen Krisen stark an Bedingungen der biologischen Reife geknüpft ist, betonte er die Bedeutung von Kultur und sozialer Umwelt für ihre Lösung.
Die Krise, die nach Erikson das Jugendalter charakterisiert, war zwischen den Polen Identitätssynthese (d. h. der Integration von früheren Identitätsaspekten und Identifikationen aus der Kindheit) und Identitätskonfusion (der Unfähigkeit, das Ganze zu einer kohärenten Identität zu integrieren) angesiedelt. Sie besteht in der Herausforderung, die eigene Identität zu definieren. Ihr wird die größte Bedeutung von allen zu bewältigenden Krisen beigemessen. Sie ist dadurch charakterisiert, dass der junge Mensch das, was er bisher von den Eltern unhinterfragt übernommen hat, z. B. politische, religiöse oder sexuelle Orientierung, in Zweifel zieht. Idealerweise wird eine möglicherweise sich einstellende Identitätsdiffusion aufgehoben, in dem der Jugendliche sich mit verschiedenen alternativen Identitätsformen auseinandersetzt, um sich dann aktiv und autonom für eine Lebensform zu entscheiden.
»Ab der Pubertät werden alle Identifizierungen und Sicherungen, auf die man sich bisher verlassen konnte, in Frage gestellt« (Erikson, 1971, S. 106). Er unterstreicht, dass die Identitätsentwicklung im Jugendalter nicht einfach die Summe der Kindheitsidentifikationen darstellt, sondern ein Integrationsprozess einsetzt von alten und neuen Identifikationen und Fragmenten, wobei die Identifizierungen mit den Eltern überprüft und neue Identifizierungen mit anderen (Erwachsenen, Freunden, romantischen Partnern) entwickelt werden. Das Gefühl der Ich-Identität ist also eine Integrationsleistung, bei der Einheitlichkeit und Kontinuität angestrebt wird. Dieser Prozess ist krisenreich und gefährlich, deshalb gab es schon zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften institutionalisierte psychosoziale Schonzeiten oder Aufschübe, in denen junge Menschen die Möglichkeit der Selbstfindung ausprobieren konnten. Wie in Kapitel 3 ( Kap. 3) und 9 ( Kap. 9) ausgeführt, ist diese »Schonfrist« inzwischen besonders ausgedehnt worden. Erikson verweist in diesem Zusammenhang auf Arthur Millers »Tod eines Handlungsreisenden« (1949), wo einer der Söhne (Biff) sagt: »I cannot get hold of my life« – »Ich kann es einfach nicht zu fassen kriegen, ich kann mein Leben nirgends festhalten.« Wir werden noch auf die neue Entwicklungsphase des »emerging adulthood« eingehen, wo der Aufschub besonders deutlich ist. Es gab also auch schon vor vielen Jahrzehnten junge Leute, die die integrative Leistung nicht schafften.
Die Arbeiten Eriksons (1959, 1968, 1971) sind insofern innovativ, als er in Absetzung von den frühen psychoanalytischen Ansätzen von Sigmund und Anna Freud das Phänomen der Adoleszenz nicht nur durch eine Zunahme der Triebimpulse begründet, sondern es als eine psychosoziale Notwendigkeit darstellt, die wesentlich zur Integration des Individuums in die Gesellschaft beiträgt. Durch die Postulierung von acht psychosozialen Phasen der Ich-Entwicklung, die sich über den Zeitraum von der Geburt bis ins hohe Alter erstrecken, erweitert er die Auffassung Freuds, für den die Persönlichkeitsentwicklung auf die kindlichen Phasen beschränkt blieb. Auch andere Theoretiker der Psychoanalyse haben einen Schwerpunkt auf die frühe Kindheit gelegt und die Latenz kaum, die Adoleszenz nur unter Triebaspekten konzeptualisiert. Die Adoleszenz, als fünfte von Eriksons Grundphasen, wird durch die Antithese von Identität vs. Identitätsdiffusion charakterisiert und hat, wie erwähnt, eine Schlüsselstellung im Lebenslauf inne. Sie ist die entscheidende Phase, von der aus reife Partnerbeziehungen und später ggfs Elternschaft möglich werden. Tatsächlich würde eine Person mit unreifer Identität bei der Idee der Verschmelzung mit einer anderen Person eher Angst entwickeln. Ein gefestigtes Identitätsgefühl, ein abgegrenztes Körpererleben und Selbstbewusstsein ist notwendig, damit man sich auf intime Beziehungen und Sexualität einlassen kann – so Erikson. Der Zusammenbruch, der Indikator für eine Identitätsdiffusion, ist oftmals zeitlich später zu bemerken, wenn etwa neue Anforderungen (der nächsten Phase) auf den Jugendlichen zukommen, also etwa Berufswahl, Intimität mit einem Partner etc. »Jetzt enthüllt sich die latente Schwäche der Identität« (Erikson, 1971, S. 157). Erikson weist darauf hin, dass Personen mit einer Identitätsdiffusion auch an einer Störung der Leistungsfähigkeit (»Diffusion des Werksinns«, S. 158) leiden.
Zur Erprobung der Identitätsfacetten und der verschiedenen Identifizierungen gehört nach Erikson auch ein spielerisches Experimentieren, auch oft gewagtes Experimentieren mit Alternativen – real und in der Phantasie. Erikson spricht von einem »Hinauslehnen über Abgründe« (Erikson 1971, S. 145). In diesem Zusammenhang erläutert er auch das Konzept der negativen Identität: »Prahlerische und wütende Widersetzlichkeit gegen alles, was dem jungen Menschen aus der Familie oder der unmittelbaren Umgebung als gute, wünschenswerte Rolle nahegelegt wird« (S. 163). »Jedenfalls«, fährt er fort, »ziehen es manche Jugendliche vor, statt des fortgesetzten Diffusionsgefühls lieber ein Niemand oder ganz und gar schlecht oder gar tot zu sein« (S.168).
Erikson weist darauf hin, dass Jugendliche eines Moratoriums bedürfen, in dem sie all dieses ausprobieren, bevor sie als junge Erwachsene endgültig eine spezialisierte Arbeit aufnehmen können und zur »echten Intimität« fähig sind (Erikson, 1968). Die endgültige Identität, wie sie am Ende der Adoleszenz feststeht, schließt die Auseinandersetzung mit allen bedeutsamen Identifizierungen der Vergangenheit in sich ein, aber sie verändert diese auch und integriert sie mit neuen Facetten zu einem einzigartigen zusammenhängenden Ganzen. Damit nähert sich Erikson sehr stark an Befunde an, die in der Entwicklungspsychologie, u. a. auf der Grundlage umfangreicher Studien, gegenwärtig bekannt sind.
Verschiedentlich ist kritisiert worden, dass die Engfassung der Phasen mit ihrer Normierung an Altersstufen heute, vor allem für postmoderne Gesellschaften, so nicht mehr gültig sei. Auch wenn man die starke Familienorientierung in den Entwicklungsphasen und die nicht umkehrbare Sequenzierung kritisch sehen mag: Die Konzeption von Erikson mit ihrer Annahme der verschiedenen Entwicklungsstufen und ihrem Aufbau aufeinander ist heute noch von Bedeutung. So konnten wir anhand unserer Längsschnittdaten zeigen, dass erst eine reife Identität die Aufnahme qualitativ hochwertiger intimer Partnerbeziehungen möglich macht (Seiffge-Krenke & Beyers, 2016). In unserer Längsschnittstichprobe waren nur Personen, die eine reife, erarbeitete Identität hatten, auch später zu hochintimen, anspruchsvollen Partnerbeziehungen in der Lage. Allerdings war interessant, dass die Bindung eine entscheidende moderierende Funktion hatte. Dies unterstreicht, was auch schon Erikson formuliert hat, dass nämlich frühe Interaktionen und Beziehungen (»Vertrauen«) den Grundstein für die Identitätsentwicklung legen, ein Ansatz, der auch in diesem Buch vertreten wird.