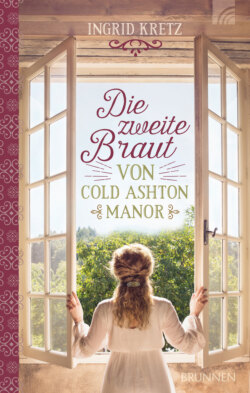Читать книгу Die zweite Braut von Cold Ashton Manor - Ingrid Kretz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 DEZEMBER 1799, DORF COLD ASHTON
ОглавлениеRichard drückte die Klinke der pechschwarzen Eichentür herunter. Das Glöckchen bimmelte und er musste sich mit Kraft gegen die Tür stemmen, bis sie unter einem Schnarren aufschwang. Wahrscheinlich hatte sich das Holz durch die feuchte Witterung verzogen.
Er betrat die Apotheke und während er die Handschuhe auszog, rieselten Schneeflocken auf den Mosaikboden. Er spürte neugierige Blicke auf sich ruhen. In diesem Moment bedauerte er, den Schnee auf seinen Ärmeln und Stiefeln nicht draußen vor der Tür abgeklopft zu haben.
In einem Anflug von Übermut war er von Cold Ashton Manor mit seinem offenen Landauer gestartet, in der Hoffnung, der befürchtete Schneefall würde erst morgen kommen. Was ihn bewogen hatte, nicht einfach einen Diener zu beauftragen, das Gefährt umzubauen oder wie gewöhnlich in der geschlossenen Kutsche zu fahren, wusste er selbst nicht.
Er lächelte vor sich hin, weil man manchmal Dinge tat, die wider jede Vernunft waren oder weil man sich langweilte oder weil sie einfach amüsant schienen. Jedenfalls hatte es während der Fahrt plötzlich angefangen kräftig zu schneien und es hatte ihm sogar Spaß gemacht, hautnah mitzuerleben, wie die Welt noch leiser wurde, als sie hier in den Cotwolds bereits war. Die weiße Pracht schluckte letzte Töne und wusch die Landschaft in ein überirdisches, fast heiliges Weiß.
Es war warm im Verkaufsraum und als er vortrat, hinterließen seine Stiefel kleine Pfützen. Er blieb vor dem großen Ladentisch stehen, der aus dunklem Holz gearbeitet war und viele Schubladen besaß. Dahinter stand ein großer Wandschrank, links und rechts vollständig eingefasst mit Regalen und gefüllt mit unzähligen Gefäßen, Tiegeln und Behältern in verschiedenen Größen, die alle sorgfältig beschriftet waren. Sulfur.Depurat., Ungt.Zinci., Acid. Salicyl., Rhiz.Rhei., Empl.Canthar.Perpet. und viele andere merkwürdige Bezeichnungen las er. Wann war er das letzte Mal hier gewesen? Es mussten einige Jahre her sein, doch offenbar hatte sich seitdem nichts in der Apotheke verändert, bis auf den Besitzer, denn inzwischen war Mr Devaneys Bart ergraut und er trug eine Brille.
Richard lenkte seine Aufmerksamkeit vom Apotheker auf eine ältere Dame, die er beriet und der er für die Behandlung ihrer Beschwerden eine Kombination aus getrockneter Goldrute und Dornige Hauhechel empfahl. Sie möge allerdings die längere Ziehzeit der Dornigen Hauhechel bei der Zubereitung des Tees beachten, machte Mr Devaney deutlich.
Plötzlich trat aus dem Schatten des Apothekers eine junge Frau hervor. Es brauchte keinen Wimpernschlag, um sie zu erkennen und ihm stockte der Atem. Sein Herz begann zu rasen. Es war die Wohltäterin vom Jahrmarkt!
Endlich hatte er Gelegenheit, sie genauer zu betrachten. Sie war schlank und hatte hellblonde glatte, aufgesteckte Haare, die trotz der trüben Beleuchtung im Geschäft regelrecht wie ein flimmernder Sommertag leuchteten. „Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragte sie mit sanfter Stimme und sah ihn aufmerksam an.
Er fand es ungewöhnlich, sie unvermittelt und auf Augenhöhe anzusehen, anstatt wie gewohnt bei jungen Damen den Kopf zu neigen, weil sie ihm meist nur bis an die Schultern reichten. Die Situation hier war irgendwie anders und neu. Er erstarrte, als er in ihre Augen blickte. Sie hatten das lichteste Blau, das er jemals gesehen hatte, umrahmt von dichten Wimpern in etwas dunklerem Ton als ihre Haarfarbe. Sein Blick verharrte fasziniert auf ihr und länger, als es schicklich galt.
Sie ließ es geschehen und wich ihm nicht aus. Die Stimme des Apothekers verwischte im Hintergrund zu einem Summen. In ihren Augen lag etwas Berührendes und gleichzeitig Unschuldiges, das er bisher bei keiner jungen Dame bemerkt hatte, die ihm vorgestellt worden war. Es war, als blicke er in die Weiten des Himmels, in dem er sich gespiegelt wiederfand.
„Alles in Ordnung, mein Herr?“, hörte er Mr Devaney plötzlich ganz nah vor ihm. Sein Kittel verbreitete den Duft einer Würzmischung aus Kräutern, die Richard vage bekannt vorkam. Anscheinend hatte der Apotheker ihn beobachtet. Warum musste er nur den Zauber des Augenblicks zerstören?
Während Richard seine Enttäuschung hinunterschluckte, nahm die Stimme von Mr Devaney einen beflissenen Klang an. „Amber, gibt es hier irgendwelche Unklarheiten?“ Dann wandte er sich wieder Richard zu und schwatzte süffisant: „Mein Herr, vergeben Sie mir, bitte. Ich weiß auch nicht, was heute mit meiner Tochter los ist.“ Er nickte entschuldigend zu seiner Kundin, die vieldeutig lächelte.
Richard räusperte sich und erinnerte sich an seine gute Erziehung. Formvollendet verneigte er sich. „Das war alleine meine Schuld. Verzeihen Sie, ich war unaufmerksam.“
Amber Devaney blinzelte, als sei ihr ein Staubkorn ins Auge geflogen und Richard bemerkte, dass sich ihre Wangen röteten. Sie schlug die Augen nieder. „Mein Vater hat recht“, stammelte sie mit belegter Stimme. „Wie kann ich Ihnen helfen?“
Aha – sie war die Tochter des Apothekers! Richard lächelte entschuldigend. Wie gern hätte er ihr den Tadel ihres Vaters erspart. Ihre hohen Wangenknochen glühten noch immer. Er riss sich zusammen und sagte nun konzentriert: „Meine Mutter plagt sich mit rasenden Kopfschmerzen. Gibt es etwas, was ihr Linderung verschaffen könnte?“
Ambers Gesichtsausdruck wurde ernst. „Natürlich. Hat Ihre Mutter denn auch schon einen Arzt konsultiert?“
„So elend ist ihr nun auch wieder nicht zumute. Sie glaubt, sie könnte es zuerst selbst mit einem Heilmittel ausprobieren.“
„Ich verstehe. Einen Moment bitte.“ Sie wandte sich, ohne ihn nochmals anzusehen, der Regalwand zu, stieg auf einen Schemel und holte aus einem Fach ein Gefäß, dem sie zwei Handvoll Blätter entnahm.
Richard betrachtete sie. Die Bindebänder der Schürze, die sie über einer hellbraunen Bluse und einem karierten Rock trug, waren auf dem Rücken zu einer riesigen Schleife gebunden. Wahrscheinlich waren sie viel zu lang und bestimmt hatte der Kittel zuvor einer kräftigeren Person gehört. Man trug die Kleidung im Allgemeinen, bis sie gänzlich zerschlissen, nicht mehr zu reparieren oder umzuarbeiten war. Er kannte das von den Dienstboten.
„Eisenkraut hat eine hervorragende Wirkung.“ Amber stieg herab und bevor sie die nötige Menge abwog, zeigte sie es ihrem Vater. Mr Devaney gab ihr mit einem Nicken zu verstehen, dass sie das richtige Mittel gewählt hatte. Während sie die Blätter in ein Papier einschlug, erklärte sie: „Der Tee ist einfach zuzubereiten. Ein paar Blätter in eine große Tasse geben und mit heißem Wasser aufgießen, eine kleine Weile ziehen lassen – etwa zehn Minuten –, dann ist er trinkbereit.“
Nachdenklich betrachtete Richard die Gehilfin des Apothekers. Er war fasziniert von ihr und fragte mit einem neugierigen Lächeln: „Woran erkennen Sie, dass das, was Sie da eingeschlagen haben, Eisenkraut ist und nicht etwas anderes? Für mich sieht es aus wie ein gewöhnliches Blatt.“
Sie sah ihn einen Moment erstaunt an, bevor sie ihn plötzlich anlächelte, was Grübchen in ihre Wangen zauberte. „Die Beschaffenheit der Blätter ist schon auffällig“, meinte sie und entnahm der Dose ein Blatt, das sie ihm vor die Nase hielt. „Sehen Sie die Form an“, mit einem Finger fuhr sie sanft darüber, „und außerdem befinden sich auf beiden Seiten kleine Härchen.“
Richard war erstaunt über ihre Pflanzenkenntnis und was sie über deren Anwendung wusste. Offenbar hatte ihr Vater sie gut unterwiesen. „Ich danke Ihnen! Wie viel macht das?“
Er zahlte die Summe, die sie nannte, griff nach dem Päckchen und wandte sich zum Gehen. Gerne wäre er noch länger geblieben, aber er wusste nicht, wie er seinen Wunsch nach einem Wiedersehen ausdrücken sollte. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Niemals zuvor hatte er eine so bezaubernde Frau gesehen. Er war selbst überrascht davon, wie stark er empfand, hatte er die Frau doch erst zweimal gesehen und kaum ein paar Sätze mit ihr gewechselt. Er öffnete den Mund, doch schloss ihn sofort wieder. Alles, was er jetzt noch sagte, konnte nur falsch sein. Vielleicht war es besser, einfach zu schweigen. Er setzte seinen Hut auf und verabschiedete sich. Bevor die Tür hinter ihm zufiel, hörte er ihre warme Stimme: „Sollte der Tee keine Linderung bringen und Ihre Frau Mutter noch immer keinen Arzt aufsuchen wollen, wird mein Vater sicher noch eine andere Idee haben.“
Draußen empfing ihn ein regelrechter Schneesturm, der den Himmel vollständig verdunkelt hatte. Er ging zu seinem Landauer und betrachtete die Sitze, auf denen sich dicke Kissen aus Schneeflocken aufgetürmt hatten. Seufzend griff er in einen vermeintlichen Schlitz zwischen den Sitzbänken, fand tatsächlich den stählernen Hebel und klappte das Verdeck zu. Wie gut, dass er seinen Kutscher oft dabei beobachtet hatte, sonst hätte er jetzt ratlos dagestanden. Vor einem Haus auf der anderen Straßenseite standen ein paar Männer, denen das Wetter wohl nichts anhaben konnte und die ihn still beobachteten. Als er endlich das Dach befestigt und die Sitze vom Schnee befreit hatte, tätschelte er seinem treuen Rappen über die Blesse. „Wir zwei finden schon heim“, flüsterte er ihm zu und nahm auf dem Kutschbock Platz. Ein Schmunzeln umspielte seine Lippen und in ihm machte sich ein Hochgefühl breit. Die Erinnerung an seinen Besuch in der Apotheke überflügelte sein Empfinden für die eisigen Temperaturen und den schneidenden Wind, der jetzt um die Häuserecken heulte. Niemals hätte er geglaubt, dass eine solche kurze Begegnung sein gesamtes Denken auf den Kopf stellen könnte.
Langsam trottete sein Wallach los. Er lächelte die Männer am Straßenrand an, die seine Freundlichkeit mit einem angedeuteten Grüßen quittierten. Seine Hände waren empfindlich kalt geworden und er zog Handschuhe über, bevor er die Gerte auf seinen Knien ablegte und sich zufrieden zurücklehnte. Könnte sein Vater jetzt das Strahlen in seinen Augen sehen, würde er wahrscheinlich fassungslos den Kopf schütteln und ihm einen Kartenspielabend mit seinen Freunden und einem guten Whiskey empfehlen.
Als er in Cold Ashton Manor ankam, hatte er den Eindruck, er sei geflogen. Seine Gedanken hatten ihn derart in Beschlag genommen, dass er von dem Rückweg nicht wirklich etwas mitbekommen hatte. Doch nun sah er das Anwesen vor sich.
Das Herrenhaus war umgeben von einer weitläufigen Steinmauer und nur durch ein imposantes, reich verziertes Tor zu erreichen. Links und rechts des Haupthauses fügten sich Giebelflügel zu einer behaglichen und zugleich prächtigen nach Südosten gerichteten Form. Der Schnee nahm den spitzen Giebeln die Strenge. Mehrere Schornsteine ragten wie kräftige Bohnenstangen in den Abendhimmel. Richard liebte die Harmonie und Schönheit der Fenster, die Jahrhunderte überdauert hatten und von denen er glaubte, dass sie zuletzt in der elisabethanischen Zeit erneuert worden waren.
Als er die Eingangshalle betrat, übergab er einer Dienerin die Kräuter, damit sie nach der Anweisung der Apothekerstochter einen Tee für seine Mutter zubereitete. Er folgte ihr in die Küche, setzte sich auf eine Bank und beobachtete, wie sie die Blätter in eine Tasse legte und mit kochendem Wasser übergoss.
Mrs Robinson stand derweil am Tisch und verfolgte mit kritischem Blick, wie die neue Küchenhilfe versuchte, aus einem störrischen Teigklumpen eine geschmeidige Masse zu kneten. „Drück mit den Handballen gleichzeitig von außen nach innen“, wies sie an, „und mit Kraft, sonst wird das nichts.“
Die Küchenhilfe mit ihren mageren Armen schien überfordert, doch die Köchin ließ sie gewähren. Wie sonst sollte das Mädchen kräftige Arme bekommen, wenn andere die Arbeit taten?
„Sie strahlen heute besonders“, merkte Mrs Robinson an und schob ihm einen Teller mit Keksen hin. Sie zeigte zum Fenster und schmunzelte. „Eure Lordschaft, war es eine lustige Kutschfahrt?“
Wie oft hatte er ihr schon gesagt, sie möge ihn weiter einfach nur Richard nennen. Doch sie war unbelehrbar und hielt sich an die Vorgaben, die die Herrschaften, in diesem Fall seine Eltern, bestimmten. Seit er erwachsen war, wurde er von ihr als künftiger Erbe von Cold Ashton angesehen und entsprechend behandelt.
Mrs Robinson hatte zwar keinen Ehemann, aber dennoch redeten sie alle wie eine verheiratete Frau an – eine ungeschriebene Sitte bei Hauswirtschafterinnen und Köchinnen, egal, ob sie verheiratet waren oder nicht. Sein Großvater hatte sie bereits als junges Mädchen ins Haus geholt und jeder Versuch anderer Herrschaften, sie mit besserer Bezahlung abzuwerben, war bisher gescheitert.
Als er noch ein kleiner Junge war, hatte die Köchin ihn manchmal auf den Knien geschaukelt und ihm Kinderlieder vorgesungen, wenn die Kinderfrau gerade nicht in Hörweite war. Es war bekannt, dass diese es nicht mochte, wenn die Dienstboten – zu der sie Mrs Robinson in Gedanken begrifflich deklassiert hatte – an den ihr anvertrauten Kindern herumerzogen.
Auch seine Schwester Jill war von der Köchin immer wie eine eigene Tochter betrachtet worden. Als Kind verwöhnte Mrs Robinson sie mit kunstvoll zubereiteten Pasteten und Gemüse, das sie zu Figuren schnitt. Auf das Schimpfen der Gräfin gab sie nichts. Doch seit Jill vor ein paar Jahren ihr Debüt gegeben hatte und ihre Wahl zwischen drei hartnäckigen Verehrern auf Sir Walter als Ehegatten gefallen war, besuchte sie Mrs Robinson zu ihrem Bedauern nur noch selten in der Küche.
Richard schaute nun auf seinen noch immer schneebedeckten Landauer und lachte. „Das kann man so sagen.“ Sanft malte er mit den Fingern die Maserung des blank geputzten Holztisches nach. „Stell dir vor, ich bin im offenen Wagen ins Dorf gefahren!“ Er schüttelte den Kopf über sein Schelmenstück. „Und Zuschauer hatte ich genügend.“
Mrs Robinson kicherte und richtete ihre Haube. „Kann ich mir gut vorstellen.“ Sie warf einen prüfenden Blick auf ihre blütenweiße Schürze, die ihr steingraues Kleid bedeckte, und schien zufrieden.
Die Dienerin siebte den Tee. „Soll ich ihn zu Ihrer Ladyschaft bringen?“
Richard erhob sich und griff nach der Tasse. „Nein, danke. Das mache ich selbst.“
Seine Mutter war heute noch nicht aufgestanden. Als Richard in ihr Zimmer trat, waren die Vorhänge noch zugezogen. Eine Lampe brannte auf dem Nachttisch und die Gräfin saß im Bett, gestützt durch dicke Kissen im Rücken. Sie sah von ihrer Modezeitschrift auf, die sie aufgeschlagen vor sich liegen hatte. Richard stellte die Tasse neben die Lampe und zog sich einen Stuhl ans Bett. Dann setzte er sich und griff nach ihrer Hand. „Geht es dir besser?“
Sie wiegte den Kopf hin und her und sog die Luft scharf ein. „Leider nicht“, erklärte sie, „und ich hoffe, dass die Arznei hilft. Was hast du mir da mitgebracht?“
„Eisenkraut.“
Sie schaute ihn fragend an. „Nie gehört.“ Sie legte den Handrücken auf die hohe Stirn, über der sich eine brünette Lockenpracht stapelte.
„Der Tee ist bereits trinkfertig.“ Mit Sicherheit hatte die Kammerdienerin sie im Bett frisieren müssen. Er lächelte über ihre Eitelkeit. „Nimmst du das Abendessen mit uns ein?“
Sie setzte eine leidende Miene auf. „Ich weiß nicht. Mein Kopf zerspringt und es flirrt vor meinen Augen.“
„Das tut mir leid.“ Richard überlegte, wie man in diesem Zustand Muße für Zeitschriften haben konnte. Er reichte ihr die Tasse und sie trank ein paar Schlucke.
„Wie geht es der Familie Devaney? Ist der Apotheker wieder gesund? Der Arme. Nicht auszudenken, wenn man die Christvesper im Bett verbringen muss.“
„Ich wusste gar nicht, dass er krank war“, räumte Richard ein. „Er stand im Laden und hat eine Kundin bedient.“ Sein Puls erhöhte sich, als er an die Tochter dachte.
Seine Mutter lehnte den Kopf nach hinten und blickte ihn an. „Man erzählt, er leide unter gelben Augen und der Gallenfluss sei gestört. Vielleicht ist ein Stein daran schuld“, mutmaßte sie recht theatralisch. „Ich habe schon öfter von solchen Attacken gehört. Sie sollen sehr schmerzhaft sein.“
„Gott sei Dank ist er wohlauf“, sagte Richard, „er machte keinen kranken Eindruck. Im Gegenteil.“ Als sie nicht reagierte, redete er weiter: „Doch jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Solltest du einen weiteren Tee wünschen, dann läute. In der Küche weiß man, wie er zubereitet wird.“
Richard war während des Gesprächs eine Idee gekommen. Er wollte Miss Devaney schreiben. Im Erdgeschoss befand sich die Bibliothek und dort stand ein Schreibtisch, der nur selten genutzt wurde. Der Gedanke, einen Brief zu verfassen, versetzte ihn in Hochstimmung.
Wie erwartet, war niemand in der Bibliothek, als er sie einige Minuten später betrat. Die Bücher waren ein Garant für Stille, selbst wenn sie beim Lesen heftige Bilder, Visionen von fernen Ländern und lärmende Geschichten im Kopf aufführen konnten. Er dachte kurz nach und griff nach einem Blatt Papier, tauchte den Federkiel ins Tintenfass, und war dabei so nervös, dass er gleich mehrere Bögen brauchte, um ein paar wenige Sätze zu verfassen, mit deren Formulierung er unzufrieden war. Auf dem Schreibtisch sammelten sich Papierbälle seiner verworfenen literarischen Geständnisse.
Er äußerte den Wunsch, sie wiederzusehen und schlug vor, nach dem Weihnachtsgottesdienst auf dem Kirchplatz ein wenig zu plaudern. Inmitten der vielen Besucher war es viel unauffälliger und einfacher, anstatt sich bei Kälte und Schnee auf einen Spaziergang zu verabreden. Sein Blut pulsierte. Er erinnerte sich an das Leuchten in ihren Augen in der Apotheke und war unruhig und gespannt zugleich, wie sie auf seine Nachricht reagieren würde. Hoffentlich hielt sie seine Bewunderung nicht für eine Spinnerei.
Er schluckte und sein Blick glitt prüfend über den Briefbogen, ob seine Worte auch wirklich angemessen klangen. Dann verschloss er den Brief, adressierte ihn an Miss Amber Devaney und beauftragte einen Diener, ihn gleich morgen früh aufzugeben. Stumm schickte er eine Bitte zum Himmel, dass sie seine Aufmerksamkeit achten würde.
Als der Diener die Bibliothek wieder verließ, blieb Richard noch einen Moment nachdenklich im Zimmer stehen, bis sich sein aufgeregter Herzschlag wieder verlangsamte. Dann beschloss er, sich beim Stallmeister zu erkundigen, ob seine trächtige Stute Ginger inzwischen gefohlt hatte. Die meisten Stuten fohlten zwar im Frühjahr, doch es war nicht ungewöhnlich, dass Pferde auch in strengen Wintermonaten Fohlen bekamen.
Gut gelaunt durchquerte er die Halle und hielt inne, als aus dem Arbeitszimmer seines Vaters laute Stimmen herüberdrangen. Eine davon gehörte seinem Vater. Verwundert schüttelte er den Kopf und blickte prüfend zur Tür, aber sie war ordnungsgemäß geschlossen. Trotzdem verstand er einige Worte, was er ungewöhnlich fand. Redete man bei normaler Lautstärke, konnte niemand im Flur davon etwas mitbekommen. Aber dieses Gespräch verlief anders und glich eher einem hitzigen Streit.
Kaufen. Diener. Belastet. Er kräuselte die Stirn. Darauf konnte er sich keinen Reim machen. Er vernahm auch eine fremde Männerstimme. Oder waren es sogar zwei? Zwischendurch hörte er seinen Vater etwas einwerfen. Aber was hatte es damit auf sich?
Warum stritt Vater sich lautstark mit jemandem? Was brachte ihn derart in Rage, dass er seine selbst erdachten Anordnungen missachtete, niemals Wortgefechte auszutragen, die andere mithören konnten? Unglaublich, dachte Richard. In diesem Moment war seine Neugier geweckt, aber bevor er noch weiter überlegen konnte, ging die Tür auf. Energisch stolzierte ein Mann in die Halle, den Kopf hoch erhoben und seine wie ein Krähenschnabel abstehende Nase zum Himmel gereckt. Auf Anhieb erkannte er ihn an seiner typischen Kleidung. Wie immer trug er eine schwarze Samtjacke mit goldenen Knöpfen und Litzen, die über dem dicken Leib zum Zerreißen gespannt war. Sie gehörte zu Advokat FitzAlan, den Richard noch nie gemocht, und der schon in seiner Kindheit einen Furcht einflößenden Eindruck auf ihn gemacht hatte. Gleich dahinter stelzte Bankdirektor Patel aus der Tür. Er hatte eine undurchsichtige Miene aufgesetzt und unter seinem Arm klemmte eine Mappe.
Wahrscheinlich hatte ihn keiner von ihnen bemerkt. Richards Augen wanderten zu seinem Vater, der langsam hinter beiden herging. Es war eher ein Schleichen, was Richard verwunderte. Als der Graf die Mitte der Halle erreicht hatte, erhaschte Richard einen Blick auf das Gesicht seines Vaters und erschauderte, denn dessen Gesichtsfarbe glich einem Leichentuch. Ohne weiter nachzudenken, lief Richard auf seinen Vater zu und griff nach dessen Arm. „Ist dir nicht gut? Soll ich dich nach oben bringen?“
Doch anstatt ihm eine Erklärung über seinen Gesundheitszustand zu geben, schüttelte der alte Lord die Hand ab. „Alles in Ordnung“, stieß er hervor, „ich bin wahrscheinlich nur zu schnell aus dem Sessel aufgestanden.“
Richard beschlich das beklemmende Gefühl, dass diese Antwort nicht der Wahrheit entsprach, doch er wollte ihn nicht in Bedrängnis bringen. Erst recht nicht in Anwesenheit der beiden Männer, die, ohne sich umzudrehen, Richtung Eingangstür schritten. „Vater, wenn ich was für dich tun kann, sag Bescheid“, meinte er nachdenklich, „du findest mich im Pferdestall.“
Sein Vater nickte und folgte den Gästen, um sie nach draußen zu begleiten, während Richard unschlüssig stehen blieb und ihnen nachsah. Der Graf war immer noch ein imposanter Mann, dessen markante Gesichtszüge Richard geerbt hatte. Diesen Mann in einer solchen Verfassung zu sehen, bereitete Richard Sorgen. Sollte er sich nicht besser vergewissern, ob sein Vater nicht doch einen Schwächeanfall erlitten hatte? Warum hatten die drei Männer sich angeschrien?
Richard seufzte. Vielleicht war es seinem Vater einfach nur peinlich, dass das Gespräch aus dem Ruder gelaufen war. Ob es Ärger mit einem Pächter gab? Das wäre nicht neu, weil immer mal jemand Zahlungsschwierigkeiten hatte. Bisher hatte man stets eine Lösung finden können. Mal wurden die Schulden gestundet oder die aufgelaufenen Summen erlassen. Vater war da oft großzügig und dieses Mitgefühl schätzte Richard an ihm.
Die Finanzen des Herrenhauses samt den Ländereien verwaltete der Graf noch selbst. Richard hatte ihm angeboten, ihn in der Buchhaltung zu unterstützen, doch sein Vater hatte ihm empfohlen, vorerst noch das Leben zu genießen. Außerdem müsse er erst einmal die verschiedenen Pächter, die Handwerker und die damit verbundenen Belange überwachen. Bisher war Vater voller Lob für ihn gewesen und selbst Young, ihr Verwalter, schwärmte von seiner Auffassungsgabe. Mit der Übertragung der Finanzen würde der Graf seine letzten Vollmachten abgeben, was ihn bestimmt grüblerisch machte, denn es bedeutete, sich eindringlich mit dem Lebensende auseinanderzusetzen.
Leider hielt sich sein Vater sehr bedeckt bei dem, was er tatsächlich dachte über das, was nach dem Tod kam. Bis auf die regelmäßigen Kirchgänge bekam Richard nicht viel vom christlichen Leben seiner Eltern mit. Innerhalb der Familie wurde nicht über Themen wie Glauben und Endlichkeit gesprochen. Richard hatte sich bisher immer alleine damit auseinandersetzen müssen. Für ihn war der christliche Glaube ein wesentlicher Teil seines Lebens geworden, wenn nicht gar der wichtigste.
Ein kalter Wind fegte in die Halle hinein und riss ihn aus seinen Gedanken. Die Eingangstür stand immer noch offen. Wo blieb Vater nur? Ein Schrecken durchfuhr ihn. Hoffentlich war er nicht draußen zusammengeklappt. Richard trat zur Tür und blieb auf der Schwelle stehen. Aufgewirbelter Schnee wehte ihm ins Gesicht. Dieses Jahr war der Winter spät gekommen. So lange er denken konnte, hatte es bereits im November geschneit, aber diesmal war alles anders.
Richards Blick fiel auf das Torhaus, dessen Durchgang offen stand. Dann entdeckte er den Grafen, der der abfahrenden Kutsche nachsah. Er hatte es sich trotz seiner Verfassung nicht nehmen lassen, seine Gäste draußen zu verabschieden. Der Schnee schluckte das Hufgeklapper und aus den Nüstern der beiden Pferde stieg Nebel wie heitere Wölkchen auf, die selbst noch sichtbar blieben, als die Kutsche längst hinter einer Wegbiegung verschwunden war.
Als der Graf ins Haus zurückkehrte und Richards achtsamen Blick sah, beruhigte er ihn: „Ich werde mich jetzt ein wenig ausruhen, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Geh ruhig zu deinen Pferden.“
Kurz darauf betrat Richard den Stall. Er liebte die Wärme, die von den Pferden ausging und sog den Geruch von Holz, Heu und Tieren ein. Sein Blick wanderte durch den von Pferdeboxen gesäumten Gang, der durch diffuses Licht aus den Oberlichtern erhellt wurde, und Staubkörnchen flimmerten zwischen den Boxen. Bis auf zwei Pferde, die zum Freilauf draußen über die Koppel stoben, befanden sich alle Tiere im Stall. MacCormick konnte er nicht entdecken.
Ein Stallbursche mistete neben Richard eine Pferdebox aus. „Weißt du, wo ich MacCormick finde?“, fragte er den Jungen, der etwas einfältig war, aber sehr gefühlvoll mit den Tieren umgehen konnte. Stoisch führte er die Bewegungen mit der Mistgabel aus. Ihm schien die Ausdünstung des Auswurfes nichts auszumachen.
„Eure Lordschaft“, hörte er hinter sich eine tiefe Stimme, „danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.“
Die Stimme erkannte Richard sofort. Er drehte sich um und lächelte, als er den untersetzten Mann sah, der mit seinen zottigen, schwarzen Augenbrauen und den tief liegenden Augen für Menschen, die ihn nicht kannten, einen Furcht einflößenden Eindruck machte. Doch hinter dem bärtigen Gesicht verbarg sich ein freundlicher, zuverlässiger Mann. Richard schätzte seine besonnene Art, mit der er die Pferde behandelte. Wie er selbst hielt auch der Stallmeister nichts von Gerte und harter Hand. Richards Art, mit den Tieren umzugehen, war in ganz Gloucestershire bekannt und hatte unter den meisten Pferdebesitzern alles andere als Anerkennung gefunden. Freunde der Familie hatten hier oft erlebt, wie er nur die Hand ausstrecken musste, damit die Tiere angetrottet kamen und daran schnupperten. Sobald er sich wegbewegte, folgte ihm das Leitpferd – in diesem Fall seine Stute Ginger. Die anderen Pferde folgten, ohne dass es ihnen jemand befahl. Richard liebte seine Fuchsstute, seit seine Eltern sie ihm vor acht Jahren zum Geburtstag geschenkt hatten. Jetzt war sie tragend und würde bald fohlen.
„MacCormick, was gibt es Wichtiges?“, fragte Richard nun. „Ist es wegen Ginger? Wie viele Tage, denken Sie, wird es noch dauern?“
Seit vielen Jahren wachte der Mann über die Stallungen und die Knechte, und Richard schätzte seinen Einsatz. Egal, zu welcher Tageszeit er gebraucht wurde, war er da. Mit seiner Frau und seinen vier Kindern wohnte er über dem Pferdestall, was Richard ein Gefühl der Sicherheit für seine vielen Rösser vermittelte.
Der Stallmeister gab ihm jetzt einen Wink und ging vorweg, bis er an einer Box am Ende des Ganges stehen blieb. Er hob die ansehnlichen Brauen, zwinkerte und sah Richard fröhlich an. „Es geht bald los.“
„Das sagen Sie erst jetzt?!“ Richard war erfreut und aufgeregt zugleich. Er trat vor und beobachtete seine Stute. „Ist das Stroh ausreichend? Es ist doch hoffentlich bester Qualität?“, sprudelte es aus ihm heraus. Jetzt hatte ihn die Aufregung der anstehenden Geburt voll erfasst.
„Sie sind nicht so unwissend wie Sie vorgeben“, grinste der Stallmeister und schob die Hände in die Hosentaschen.
Richard öffnete den Verschlag und strich Ginger über die Blesse. Er spürte MacCormicks Augen auf sich ruhen. Unwillkürlich griff er ihn am Arm und zog ihn in die Box. „Woran erkennen Sie, dass Ginger bald fohlt?“
Die Stute stampfte auf. „Schhh“, beruhigte sie MacCormick und blieb reglos stehen. „Kennen Sie das alte Sprichwort: Das Fohlen bestimmt den Tag, die Stute die Stunde der Geburt?“
Richard schüttelte den Kopf. „Bedauerlicherweise war ich immer verhindert, wenn eine Fohlengeburt anstand. Und die letzte liegt auch schon Jahre zurück.“
„Sie schwitzt“, erklärte MacCormick und zeigte auf das feuchte Fell, „und ist unruhig.“ Außerdem wies er auf das pralle Euter „Und das sind nur drei von mehreren Zeichen, die ich beobachte.“
Ginger bewegte sich in dem Stallabteil. MacCormick trat nah an sie heran und strich ihr leicht über den Hals, bevor er seinen Handteller betrachtete und ihn an der Hose trocken wischte. „Wir brauchen mehr Beleuchtung“, seufzte er und blickte zur Decke. „Jetzt ist es zwar ausreichend hell, doch die meisten Fohlen kommen nachts zur Welt. Gibt es noch Lampen?“
Richard nickte. „Ich lasse welche bringen.“
„Danke, Eure Lordschaft, und ich wäre froh, wenn Sie bei der Geburt dabei wären. Zwar gibt es meist keine Schwierigkeiten, aber …“ Er sah ihn fragend an.
„Ja, natürlich! Rufen Sie mich, wenn es so weit ist.“ Er bedachte Ginger mit einem aufmunternden Blick und wandte sich zum Gehen. „Gibt es Anlass zur Sorge?“
MacCormick schüttelte nach einem kurzen Zögern langsam den Kopf.
Gab es doch etwas, was MacCormick beunruhigte? Richard wollte ihn vorerst nicht weiter bedrängen. Das würde ihn womöglich verunsichern. „Sagt Ihnen der Name Bourgelat was?“
Der Stallmeister nickte. „Der Name ging durch viele Länder. Ein Phänomen, dieser Mann.“
„Ja. Ich werde mich morgen gleich kümmern, ob es jemanden in der Nähe gibt, der in Pferdekunde ausgebildet ist und notfalls gerufen werden kann.“ Vor sieben Jahren war in London die erste Lehrstätte für Tiermedizin gegründet worden. Schnell hatte sich der Franzose Claude Bourgelat, ein königlicher Beamter, in Frankreich mit seinen umfangreichen Kenntnissen über Pferde und Tiere im Allgemeinen einen Namen gemacht. Die Idee der École royale vétérinaire, an der Tiermedizin gelehrt wurde, griff auf andere Länder über. England war eines davon.
Vielleicht konnte man ihm in London einen Fachmann empfehlen, der dort studiert hatte.
Als Richard einige Zeit später wieder ins Haus kam, ging es seiner Mutter noch nicht besser. Sie fehlte beim Dinner, doch Vaters Vorschlag, den Arzt zu rufen, lehnte sie ab. Sie wollte zuwarten und hoffte, dass der „Eisenhammer“, wie sie es nannte, bis zum nächsten Morgengrauen verschwand.
Die Nacht blieb ruhig. Mehrmals wurde Richard wach, horchte in die Stille, aber offensichtlich ließ sich das Fohlen Zeit.
Noch vor dem Frühstück ging er zum Stall hinüber. Der Stallbursche, den MacCormick zur Wache verdonnerte hatte, lag vor der Box und schlief. Als Richard ihn weckte, blinzelte er ihn verschlafen von seinem Strohlager aus an. In stillem Übereinkommen verstand er den Besuch seines Herrn und schüttelte den Kopf. Das Fohlen war noch nicht da. Ginger trottete an die Boxentür und ließ sich von Richard kraulen. Er bedachte sie mit aufmunternden Worten und kehrte ins Haus zurück.
Auch beim Frühstück wurde die Gräfin vermisst, was seinem Vater ein missmutiges Gesicht bescherte. Der Graf murmelte: „Der Tee hat nur wenig Wirkung gezeigt.“ Er fuchtelte enttäuscht mit den Händen herum. „Wahrscheinlich sind es Lorbeerblätter gewesen, die man in Soßen und Eintöpfe legt“, beschwerte er sich, „aber nicht um Attacken der besonderen Art zu behandeln!“
Das war einfach so dahingesagt, wahrscheinlich, weil ihm die Genesung nicht schnell genug voranging. Trotzdem fühlte Richard sich verletzt, als gelte die Klage ihm, und etwas in ihm begehrte auf.
„Du irrst. Mr Devaney hat die Teemischung befürwortet“, verteidigte Richard Amber, ohne ihren Namen zu nennen. Was mochte sie gedacht haben, als sie seinen Brief erhalten hatte? Zu gern wüsste er bereits ihre Antwort. Wie sie ihn angesehen hatte! Mit ihren großen, leuchtenden Augen …
„Ich hole eine andere Arznei“, bestimmte er und schob seinen Teller beiseite. Hoffentlich war sie wieder im Laden. Ob sie dann genauso aufgeregt war wie er? Schnell trank er sein Glas aus und wollte aufstehen, als sein Vater ihn zurückhielt.
„Lass Junge“, meinte er, „deine Mutter möchte noch ein paar Stunden abwarten. Man bringt ihr gerade einen neuen Tee.“
Beherrscht nickte Richard. Die Gelegenheit, wieder zur Apotheke zu fahren, war vertan. Ob Amber Devaney ihm antworten würde?