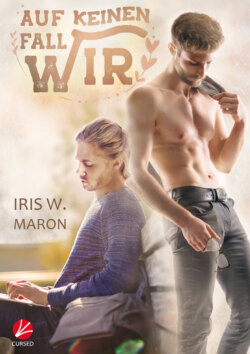Читать книгу Auf keinen Fall wir - Iris W. Maron - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеDer Zug hält mit einem leichten Ruck. Ich schultere meinen Rucksack und schiebe meinen Koffer zur Tür. Im Ausstiegsbereich drängt sich schon seit zehn Minuten eine Gruppe Rentner, um den Halt bloß nicht zu verpassen. Als sich die Türen nicht sofort öffnen, werden die Leute hektisch – beziehungsweise noch hektischer, was eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Die untersetzte Frau mit der auftoupierten, blondierten Mähne, die den Platz ganz vorne ergattert hat, ist kurz davor, gegen die Zugtüren zu hämmern. Den Öffnen-Knopf ignoriert sie.
»Typisch Bahn!«, schimpft der Mann hinter ihr.
Ich fürchte schon, von den Leuten niedergetrampelt zu werden, wenn sie sich ihren Weg zu einem anderen Ausgang bahnen wollen, da öffnen sich die Zugtüren mit einem durchdringenden Quietschen. Noch einmal nimmt die Hektik zu, dann sind alle, die vor mir standen, endlich ausgestiegen. Jetzt kann auch ich meinen Koffer hinauswuchten und den Zug verlassen.
Frische Luft vertreibt den Muff des Zuges. Ich gehe ein paar Schritte zur Seite, dann bleibe ich stehen und sehe mich um. Gott, sind die Menschen hier schlecht angezogen. Und wie nah die grünen Hügel sind, obwohl ich doch eigentlich mitten in der Stadt bin. Trotz der Geräusche eines Presslufthammers habe ich das Gefühl, auf dem Land zu sein.
Willkommen zurück in der Realität.
Es ist jedes Mal wieder ein veritabler Kulturschock, hier anzukommen. Alles ist klein. Der Bahnhof, die Häuser, die Stadt, die Szene. Ich wohne jetzt fast zwei Jahre in dieser »Stadt«, aber daran kann ich mich nur schwer gewöhnen. Ich wäre gerne woandershin gegangen, doch das ging nicht. Wenn man meinen Job machen will, kann man sich nicht aussuchen, wo man wohnt. Man geht dahin, wo es einen Job gibt. In meinem Fall ist das eben diese Kleinstadt.
Es ist eine klassische Universitätsstadt, wie es in Süddeutschland einige gibt. Hübsch, sonnig, ziemlich grün und wenn man sich außerhalb der Studentenszene bewegt: ein bisschen sehr spießig. Spätestens gegen Ende des Semesters geht mir die Stadt immer fürchterlich auf die Nerven und wird mir viel zu eng. Darum nutze ich jede Möglichkeit, um abzuhauen. Die letzten Monate habe ich in den USA verbracht und die Rückreise mit einem Besuch bei Thomas verbunden.
Lächelnd denke ich an letzte Nacht. Der Trip nach Köln hat sich wirklich gelohnt. Es hat Spaß gemacht, Pilot zu sein. Und es hat großen Spaß gemacht, Sven zu vögeln. Ich würde ihn tatsächlich gerne noch ein zweites Mal vernaschen. Das ist wirklich ungewöhnlich für mich. Aber man kann nicht alles haben. Und wer weiß, ob das zweite Mal mit dem ersten mithalten könnte. Wahrscheinlich nicht. Die Erwartungen wären zu hoch und der Reiz des Neuen wäre weg. Die Erinnerungen an eine wirklich gute Nacht, die bleiben mir ohnehin und so werden sie wenigstens nicht durch eine mittelmäßige Neuauflage getrübt.
In Gedanken noch bei Sven und seinem sexy Rücken remple ich mir meinen Weg durch die kleine Menschenmenge am Bahnsteig und marschiere ins Bahnhofsgebäude, um noch schnell zum Supermarkt zu gehen. Es ist Sonntag und andere Optionen gibt es in diesem Kaff nicht, um noch Einkäufe zu erledigen. Der Supermarkt ist übrigens winzig. Überraschung.
Nachdem ich das Nötigste ergattert habe, fahre ich mit der Straßenbahn die paar Stationen zu meiner Wohnung. Eigentlich könnte ich auch zu Fuß gehen. Mit dem Gepäck und der Einkaufstüte muss das aber wirklich nicht sein.
Der Kulturschock hält weiter an, als ich aus dem Straßenbahnfenster auf die vorbeiziehenden Häuser mit den Handyläden, den Ökoläden und den kleinen studentischen Szene-Bars schaue. Er hält auch an, als ich aussteige und unter großen Bäumen, die noch beinahe kahl sind, zu meinem Wohnhaus gehe. Es ist anders hier als in Köln und ganz, ganz anders als in den USA, obwohl ich auch dort an einer Provinz-Uni war.
Sobald ich in meiner Wohnung angekommen bin, werfe ich meine Reisetasche achtlos in ein Eck und streife meine Schuhe ab. Ich habe das Gefühl, jetzt das erste Mal wirklich durchatmen zu können. So langweilig ich die Stadt finde: Meine Wohnung liebe ich. Es ist meine erste eigene Wohnung, die keine WG ist und kein winziges Zimmer in irgendeinem Wohnheim. Ich hatte echt Glück, sie zu finden. Wie in allen Universitätsstädten sind auch hier die Mieten völlig überteuert und die Wohnungen heiß umkämpft. Dass ich mir diese schöne Wohnung leisten kann, lässt mich mich auch noch nach zwei Jahren so merkwürdig erwachsen fühlen. Und frei.
Während der vergangenen Monate habe ich die Wohnung untervermietet. Da weiß man nie, was einen erwartet, wenn man heimkehrt. Der Flur, der auch das Vorzimmer ist, sieht schon mal ordentlich aus. Das Bad muss die Untermieterin sogar geputzt haben, bevor sie gestern ausgezogen ist. Es riecht immer noch ein bisschen nach Zitronenreiniger. Die Dusche war, glaube ich, noch nie so sauber und selbst die Fugen in den Bodenfliesen, von denen ich immer dachte, sie wären grau, strahlen weiß. Wow.
Ich setze meinen Kontrollgang im Wohnzimmer mit der offenen Küche fort. Auch hier hat die Untermieterin gründlicher geputzt, als ich es an ihrer Stelle getan hätte.
»Hallo, Küche«, begrüße ich meinen liebsten Ort in der Wohnung und tätschle die graue Arbeitsplatte zärtlich. Diese super ausgestattete Küche war der Grund, weswegen ich die Wohnung unbedingt haben musste. Dass die Vormieter dann sogar den großen Esstisch dagelassen haben, war das Tüpfelchen auf dem I. Ein Schreibtisch hat dadurch zwar nicht mehr ins Wohnzimmer gepasst, aber wer will schon arbeiten, wenn er kochen kann?
Ich reiße mich vom Anblick meiner Küche los und gehe ins Schlafzimmer. Wie nicht anders zu erwarten, sieht auch hier alles picobello aus. Das große Bett hat die Untermieterin ordentlich abgezogen. Es ist das einzige Möbelstück, das ich neu gekauft und nicht von den Vormietern oder von meiner Schwester übernommen habe, als sie ihre Wohnung aufgegeben hat, um zu ihrem Freund zu ziehen. Aber auch so besitze ich nicht viele Möbel und Deko-Schnickschnack habe ich erst recht keinen. Das macht einfach keinen Sinn, wenn jede Wohnung nur eine Durchreisestation zur nächsten Wohnung in der nächsten Stadt ist.
Zuletzt gehe ich auf den Balkon. Er ist nicht riesig, aber groß genug für ein Outdoor-Sofa, auf dem drei Leute bequem sitzen können. Es stammt noch von den Vormietern, genauso wie das kleine Tischchen vor dem Sofa. Mit diesen Möbeln ist der Balkon absolut vollgeräumt. Man kann Sofa und Tisch einmal umrunden, mehr aber auch nicht. Definitiv kein Balkon fürs Urban Gardening. Für meine Kräuter habe ich immerhin ein paar Blumenkisten am Balkongeländer befestigt, die momentan recht trist und traurig aussehen.
Gähnend lasse ich meinen Blick über die Nachbarhäuser schweifen. Müdigkeit und Kater fordern langsam ihren Tribut. Dass ich jetzt noch auspacken und mich wieder häuslich einrichten muss, freut mich so gar nicht.
Als ich am nächsten Tag aufwache, fühle ich mich immer noch gerädert und nicht annähernd wach. Mit nur halb geöffneten Augen taste ich nach meinem Handy. Beim Blick auf die Uhrzeit setze ich mich ruckartig auf: Ich habe verschlafen. Verdammt.
Keine Ahnung, ob ich vergessen habe, den Wecker zu stellen, oder ob ich ihn im Halbschlaf abgeschaltet habe. Viel Zeit bleibt mir nicht, bevor ich zur Arbeit muss. Ich sollte eigentlich jetzt schon los, wenn ich rechtzeitig da sein will. Ohne Kaffee und zumindest eine Schüssel Müsli überstehe ich den Tag aber nicht. Also erst Frühstück und dann ab ins Bad. Dort versuche ich, nicht allzu viel Zeit in meine Frisur zu stecken. Natürlich bin ich trotzdem viel zu spät dran, als ich endlich losgehe.
Ich schwinge mich auf mein Rad und fahre auf schnellstem Wege in die Uni. Es ist nicht weit, doch bis ich dort ankomme, habe ich beinahe eine Fußgängerin überfahren und bin nur knapp der Kollision mit einem Auto entgangen. Vielleicht ist doch was dran, wenn meine Schwester immer behauptet, dass ich wie ein Irrer fahre. Die anderen könnten aber auch einfach ihre Augen offen halten.
Nachdem ich mein Rad angeschlossen habe, marschiere ich eilig zu meinem Büro an der Uni. Bevor ich dort ankomme, laufe ich auf dem Flur in zwei Professoren der älteren Generation, Bickenbacher und Hasslein, hinein, die lautstark und mit ausladenden Gesten darüber diskutieren, welche nahöstliche Gegend heute die stärksten Konsequenzen der jungsteinzeitlichen Ziegenhaltung und der damit verbundenen Vernichtung nahezu sämtlicher Vegetation zu erleiden hat. Sie werden fast handgreiflich, weil sie sich nicht einigen können.
Alle Archäologen sind irgendwie gestört. Ich muss es wissen. Ich bin selbst einer.
Bevor ich die Türe zu Doris' und meinem Büro öffne, werfe ich noch einen Blick auf meine Uhr. Ich bin eine Dreiviertelstunde zu spät dran, die Besprechung mit Doris kann ich also vergessen. Sie erwartet mich dann auch dementsprechend sauer.
»Auch schon da?«, giftet Doris.
»Hallo, Doris«, grüße ich zurück und übergehe ihren Zorn nonchalant. »Es ist auch sehr schön, dich endlich wiederzusehen. Der Wecker hat nicht geläutet.«
»Hättest du nicht wenigstens Bescheid geben können?«
»Das hätte an meiner Verspätung nichts geändert.«
»Aber ich hätte hier nicht rumgesessen wie bestellt und nicht abgeholt.«
Hätte sie doch. Doris sitzt so oder so immer im Büro. Aber den Kommentar schlucke ich wohlweislich runter.
»So dringend war unsere Besprechung doch nicht, oder? Das können wir nachher auch noch klären. Oder zur Not morgen.«
»Wir müssen die Exkursion planen und es gibt noch tausend Sachen zu besprechen. Am besten gestern.«
Ich mag Doris wirklich gerne, aber es nervt, dass sie stets solchen Stress verbreiten muss. Sie nimmt immer alles so wahnsinnig ernst. Mir ist meine Karriere auch wichtig, aber man muss echt Prioritäten setzen, sonst wird man noch irre. Die dämliche Exkursion, die wir mit den Studierenden machen sollen, ist auf meiner Prioritätenliste denkbar weit unten.
»Na ja, aber jetzt müssen wir erst mal zu Ruth«, meine ich.
»Was du nicht sagst.«
Ich öffne die Tür, die ich gerade erst hinter mir geschlossen habe, und halte sie Doris, höflich wie ich bin, auf. Gemeinsam gehen wir zum Büro unserer Chefin. Doris dampft immer noch vor Zorn. Wie immer übertreibt sie maßlos.
Der Rest des Lehrstuhls ist bereits in Ruths Büro versammelt: Anna, Viktoria und Fabian stehen inmitten des großen, vollgestopften Raumes und unterhalten sich mit unserer Chefin.
Ich finde Ruth großartig. Ruth ist eine Frau, die immer polarisiert. Sie ist spitzzüngig, sarkastisch und maßlos intelligent. Wahnsinnig erfolgreich in allem, was sie tut, hat sie den Ruf, nur die Besten bei sich aufzunehmen und allen anderen ganz klar zu sagen, was sie von ihnen hält. Deswegen wollte ich unbedingt zu ihr und habe sogar diese Kleinstadt in Kauf genommen.
Ihre wilde rote Mähne trägt Ruth wie immer locker zurückgebunden, sie wird nie ordentlich oder elegant aussehen. Immer hat sie die Aura des Chaotischen. Damit ist sie optisch der totale Kontrast zu Doris. Deren dunkle Kurzhaarfrisur sitzt wie immer perfekt. Doris ist der Typ Frau, der auch noch mit Jeans und T-Shirt (und selbst dann, wenn sie bei einer verregneten Grabung knietief im Morast steckt) vornehm wirkt. Sie ist streng und akkurat in allem, was sie tut – deswegen haben viele Studierende Angst vor ihr. Und nicht nur die.
Neben diesen beiden starken Frauen verblassen Anna, Viktoria und Fabian völlig. Alle drei sind sie durchschnittlich. Nett, aber langweilig. Mausgrau, irgendwie.
»Hallo, ihr zwei«, begrüßt uns Ruth. »David, schön, dass du wieder da bist!«
»Finde ich auch. Hallo!«
Ich umarme Ruth und die anderen zur Begrüßung, dann nehmen wir alle am Besprechungstisch Platz. Zu Semesterbeginn setzt Ruth sich immer mit uns allen zusammen, um den Stand unserer jeweiligen Projekte sowie die für dieses Semester geplanten Aktivitäten zu besprechen.
»Also, erzählt mal, was tut sich bei euch momentan so?«, eröffnet Ruth dann auch gleich das Gespräch.
»Jede Menge«, meine ich und lache. »Es war echt toll in den USA. Um die Technik sind sie wirklich zu beneiden. Ich wünschte, wir hätten ihre Drohnen.«
»Glaube ich. Lief die Grabungskampagne erfolgreich?«
»Ja, extrem. Wir haben einen wirklich vielversprechenden Überblick über das Areal bekommen. Ich schreibe momentan an einem Aufsatz über die Untersuchungen und werde die Ergebnisse auch auf der Tagung von Steve Miller in London in ein paar Wochen präsentieren.«
»Super. Zeig mir den Aufsatz dann, wenn er fertig ist. Ich bin wirklich neugierig darauf.«
»Klar, mache ich.«
Ruth nickt noch einmal, dann wendet sie sich Doris zu. »Und bei dir?«
»Ich habe das Gefühl, ich komme momentan vor lauter Verwaltung kaum zum Forschen«, meint Doris und wirft mir einen finsteren Blick zu, den ich gepflegt ignoriere. »Gestern habe ich die vakante Hilfskraftstelle ausgeschrieben.«
»Oh, bekommen wir einen neuen Hiwi?«, frage ich.
»Ja. Theres hat vor ein paar Wochen ihr Studium abgeschlossen.«
»Ah.«
»Außerdem planen David und ich die Lehrexkursion. Die Unterkunft ist schon gebucht und die Leute bei der Pfahlbausiedlung wissen auch Bescheid. Um die Anreise müssen wir uns noch kümmern. Ich schätze, David und ich fahren mit dem Auto, um die Geräte hinzubringen. Die Studis müssen dann allein mit der Bahn fahren.«
»Das werden sie schon hinkriegen«, befinde ich.
»Denke ich auch.«
»Das wird bestimmt eine gute Exkursion«, meint Ruth. »Fabian, was machst du momentan?«
»Mh… Es läuft gerade nicht so.«
»Inwiefern?«
»Ich weiß nicht. Die Dissertation ist momentan so… Keine Ahnung, ich glaube, ich habe eine kleine Sinnkrise.«
Den Kommentar hätte Fabian sich mal besser verkneifen sollen, denn er provoziert damit eine lange und wenig freundliche Rede von Ruth. Das scheint Viktoria die Sprache zu verschlagen, denn sie meint bloß, bei ihr gäbe es nichts Neues.
Es ist dann auch letztlich Anna, die den Vogel abschießt. Nachdem sie erzählt hat, dass sie ihre Dissertation vor zwei Tagen eingereicht hat – allgemeiner Jubel – und sie in den nächsten Wochen verteidigen wird, macht sie eine kleine Kunstpause.
»Ich muss euch noch etwas erzählen«, fährt sie dann fort.
Doris – die mir, glaube ich, in diesem Moment verzeiht – und ich werfen uns einen bedeutungsvollen Blick zu. Ich wette, sie ist schwanger. Und ich wette, Doris denkt das auch.
»Alex und ich werden heiraten!«, bricht es dann aus Anna heraus.
Fast.
Ich stimme in die allgemeinen Glückwünsche ein, auch wenn ich echt nicht weiß, was man da beglückwünschen soll. Die allgemeine Spießigkeit? Den Steuervorteil?
Nach Annas Ankündigung ist der seriöse Teil der Besprechung gelaufen. Ruth informiert uns zwar noch schnell über einige Neuigkeiten im Studienplan und schafft es, dass wir uns kurz noch über die Lehrveranstaltungen austauschen, die wir dieses Semester halten. Dann aber reden wir nicht mehr über Dienstliches, sondern nur noch über Hochzeitspläne und darüber, was wir in den Semesterferien gemacht haben, wenn wir gerade nicht gearbeitet haben – bis Ruth uns schließlich ziemlich rüde rauswirft, da sie in eine Sitzung muss.
Wie immer versammeln wir uns anschließend noch auf einen Kaffee in Doris' und meinem Büro. Wie es nicht anders zu erwarten war, dreht sich das Gespräch ziemlich schnell wieder um Annas geplante Hochzeit.
»Ganz schöne Umbrüche bei dir«, sagt Fabian.
»Du meinst, weil meine Diss jetzt auch fertig ist?«, erwidert Anna. »Alex hat mir den Antrag gemacht, nachdem ich sie eingereicht habe. Ich dachte, wir feiern, dass ich endlich fertig bin, aber da habe ich mich getäuscht.«
Anna lächelt selig. Mit einem halben Ohr höre ich zu, wie sie von dem »wahnsinnig romantischen« Heiratsantrag erzählt, der offenbar ein exquisites Menü in einem Sternerestaurant, eine Wagenladung rote Rosen und allen Ernstes einen im Dessert versteckten Ring beinhaltet hat. Ich kann mir kaum etwas Lächerlicheres vorstellen. Es ist mir ein Rätsel, dass Frauen so was gut finden. Dabei ist Anna Wissenschaftlerin.
»Wie lange läuft denn deine Stelle eigentlich noch?«, unterbreche ich sie schließlich.
Anna rümpft die Nase und sieht mich indigniert an. Offenbar missfällt es ihr, dass ich sie auf den Boden der Tatsachen zurückhole. Tja. Ihr Pech.
»Bis Oktober.«
»Hast du schon eine Idee, wo du danach hinwillst?«, nimmt Doris mir die Worte aus dem Mund.
Anna seufzt schwer. »Ich weiß nicht, ob ich überhaupt in der Wissenschaft bleiben will. Ich müsste dann ja an eine andere Uni gehen und ich bin doch so gerne hier.«
»Schon, aber wenn du weiterhin forschen willst, musst du nun einmal woandershin.«
»Klar, aber jetzt, wo wir heiraten… Und dann wäre es höchstens für ein paar Jahre, bevor ich wieder umziehen müsste. Der Job ist wirklich nicht besonders gut mit einer Beziehung oder gar mit einer Familie vereinbar.«
»Dafür sieht man immer wieder etwas Neues«, befinde ich. Dass man als Archäologe so oft umziehen muss, gehört zu den Dingen, die ich an dem Job liebe. Ich will nirgends lang bleiben. Kaum dass ich mich an einem Ort eingewöhnt habe, langweilt er mich auch schon. Es gibt so viele Orte, an denen ich noch leben will. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Beziehung, die dem im Weg steht… Nein, so weit käme es nicht.
Ich will ungebunden sein und frei. Mich von nichts und niemandem einengen lassen. Ich will spontan sein und woanders neu anfangen können, wenn mir danach ist. Ich will meine Entscheidungen alleine treffen und ohne, dass mir jemand seine Meinung aufzwingen will. Kompromisse fände ich furchtbar, sie wären für mich wie Selbstaufgabe. Ich bin mir zu wichtig, als dass ich mir das antun könnte.
»Ja, dass man immer etwas Neues sieht, ist schon cool«, meint Fabian. »Aber alle paar Jahre in eine neue Stadt oder in ein neues Land zu gehen, ist doch auch extrem anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, immer wieder neu beginnen und alles zurücklassen zu müssen.«
»Eine gute Beziehung hält das aus«, entgegnet Doris. Sie hat seit Jahren eine Fernbeziehung und pendelt deswegen nach Leipzig.
»Ach nein, ich weiß nicht«, sagt Anna und seufzt schwer. »Ich glaube nicht, dass Alex und ich das wollen.«
Ich kann nur den Kopf schütteln. Auch wenn Anna oft nervt, ist sie ziemlich gut in dem, was sie macht. Und das will sie jetzt allen Ernstes aufgeben für eine Ehe, die sowieso in ein paar Jahren geschieden wird, und weil sie zu feige ist, dieses Provinznest, in dem sie schon immer lebt, zu verlassen?
»Überleg dir das gut«, meine ich.
Anna seufzt schwer und jammert noch ein bisschen über ihre unklaren Zukunftsaussichten. Wenigstens redet sie nicht mehr übers Heiraten.
Lange bleiben Anna, Viktoria und Fabian nicht mehr. Nachdem sie gegangen sind, fahre ich meinen Computer hoch und bereite ein paar Dinge für meine Lehrveranstaltung vor, deren erste Einheit übermorgen ist. Dann zwingt Doris mich noch, mit ihr über die Exkursion zu reden – dabei gibt es für mich nicht mehr sonderlich viel zu tun. Strukturiert wie Doris ist, hat sie schon fast alles erledigt. Und eigentlich will sie auch gar nicht, dass ich ihr etwas abnehme.
Es ist trotzdem schon recht spät, als ich die Uni wieder verlasse. Auf dem Heimweg gehe ich noch einkaufen. Da ich gestern nur das Nötigste besorgt habe, wird es ein Großeinkauf, den ich mit hängender Zunge in meine Wohnung schleppe. Kurz überlege ich, mich, nachdem ich alles verstaut habe, einfach aufs Sofa zu werfen und den Rest des Abends nichts zu tun. Doch letztlich überwiegt das Gefühl, dass ich nach dem Tag in der Uni dringend Bewegung brauche. Also ziehe ich meine Sportklamotten an und gehe joggen.