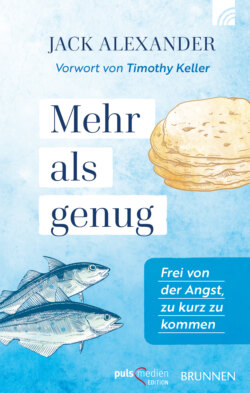Читать книгу Mehr als genug - Jack Alexander - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nicht genug
ОглавлениеMangel ist ein Wort, das seit dem letzten Jahrzehnt häufig verwendet wird. Alle – ob Psychologen, Werbefachleute oder Talkshow-Gäste – versuchen zu erklären, auf welche Weise der Mangel uns als Menschen prägt, und nicht selten schlagen sie auch Kapital daraus. Doch wenn wir einmal von all dem wissenschaftlichen Gerede absehen, was bedeutet Mangel wirklich?
Eine einfache Definition lautet: Das Gefühl des Mangels ist die Furcht, dass von etwas nicht genug für alle vorhanden ist – dass es nicht für alle reicht.
Was ist, wenn ich nicht genug Geld habe, wenn ich in Rente gehe?
Wie soll ich all diese Rechnungen bezahlen?
Können wir uns wirklich ein Kind leisten?
Doch die heimtückischen Folgen der Mangelmentalität gehen noch tiefer. Die Furcht, nicht genug zu haben, wirkt sich nicht nur auf unseren Geldbeutel aus, sondern auch auf unseren Geist.
Habe ich genug Zeit, mich in diesem Projekt zu engagieren?
Besitze ich genug seelische Kraft, um diesem Menschen in Not zu helfen?
Was ist, wenn ich für mich selbst nichts mehr übrig habe?
Diese und viele ähnliche Fragen belasten unsere Kultur. Seit der letzten großen Wirtschaftskrise haben zahlreiche Menschen, die ich kennengelernt habe, mit einem Gefühl des Verlusts und einer pessimistischen Sicht der Zukunft zu kämpfen. Ich habe mit Dutzenden von Familien gesprochen, die den Eindruck haben, am Rand eines Abgrunds zu leben. Sie fürchten, eine unerwartete Rechnung oder Krise könnte sie in eine Situation bringen, in der sie finanziell nicht mehr klarkommen. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, erkennt man schnell, warum.
Der technologische Fortschritt hat die Erwartung der ständigen Erreichbarkeit geschürt, wodurch sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Amerikaner verlängert hat, bei gleichzeitiger Senkung der Gehälter. Für den durchschnittlichen Amerikaner hat sich das Realeinkommen unter Berücksichtigung der Inflation seit dem Jahr 2000 nicht mehr erhöht. Die Rentenansprüche schrumpfen und Arbeitnehmer, die sich bisher finanziell sicher fühlten, müssen sich inzwischen tief verschulden, um die rasant wachsenden Ausbildungs- und Gesundheitskosten stemmen zu können. Der Klassenkampf bestimmt das gesellschaftliche Klima, da der Graben zwischen Arm und Reich mittlerweile so breit ist wie nie zuvor. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte wird die nächste Generation aus der Arbeiter- und Mittelschicht ihre Eltern im Blick auf Ausbildung, Einkommen und berufliche Chancen wohl nicht mehr übertreffen.
Die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, betreffen jedoch weit mehr als nur die Höhe unseres Bankguthabens. Der Stresslevel steigt und unsere mentale Kraft wird ebenso überstrapaziert wie unser Budget. Die Nachrichten sind voll von Tragödien und Skandalen, sie hinterlassen bei uns ein Gefühl der Ohnmacht, sodass wir unsere Türen doppelt verriegeln und jeden Fremden misstrauisch beäugen. Unsere Kultur fordert, dass wir niemanden beleidigen, und doch wird der Ton der öffentlichen Debatten von Tag zu Tag rauer. Kurz: Wir sind von Botschaften umgeben, die allesamt lauten: „Fürchte dich!“, und es fällt leicht, ihnen Glauben zu schenken.
Die Furcht ist ein erstickendes Gefühl. Sie lässt uns egoistisch, verbittert und von anderen entfremdet zurück. Das Mangeldenken ist ein Ableger der Furcht; es bringt uns dazu, die Welt als Nullsummenspiel zu betrachten: Alles, was andere bekommen, bedeutet, dass für mich weniger vorhanden ist. Wenn ich etwas von mir selbst oder von meinen Ressourcen verschenke, dann bleibt nicht mehr genug für meine eigenen Bedürfnisse übrig. Es ist einfach nicht so viel vorhanden – ob Geld, Vertrauen oder sogar Liebe –, dass es für alle reicht. Das daraus resultierende Gefühl des Mangels treibt uns Schritt für Schritt in die Hoffnungslosigkeit. Das war jedenfalls meine persönliche Erfahrung.
Mir ist wichtig, dass Sie wissen: Dies ist kein Buch über die Probleme anderer Leute. Über große Strecken meines Lebens waren Furcht und Mangel meine ständigen Begleiter. Ich lernte sie kennen, als mein Vater, so wie Jadens, unerwartet verstarb. Ich war erst neun Jahre alt. Meine Mutter heiratete erneut, aber es war keine glückliche Beziehung. Ja, meine Mutter und ihr Mann schienen sich sogar die meiste Zeit zu hassen. Ich wuchs in einer Familie auf, in der ständig über Geld gestritten wurde. Die beiden zankten sich um jede Kleinigkeit, zum Beispiel von welchem Konto man welche Rechnungen bezahlen oder was man mit kleinen, sentimentalen Erbstücken machen sollte. Wenn es nach meinem Stiefvater ging, gab es nie genug.
Mit seinen Gefühlen war er ebenso sparsam wie mit dem einen Dollar, den er jeden Sonntag in den Klingelbeutel warf. Meine Schwestern und ich wurden nicht zum Träumen ermutigt. Stattdessen wurden wir ausgeschimpft, wenn wir nicht die erforderlichen Leistungen erbrachten. Es gab keine Gnade und kein Sicherheitsnetz.
Ich reagierte darauf, indem ich schon als Junge hart arbeitete. Wenn ich nicht darauf vertrauen konnte, dass andere meine Bedürfnisse erfüllten, so dachte ich, dann musste ich es eben selbst tun. Im endlosen, eisigen Winter von New England trug ich Zeitungen aus und während der langen, feuchtwarmen Sommermonate verdingte ich mich als Caddie auf den Golfplätzen. Ich arbeitete bis spät in die Nacht als Hilfskellner und fuhr mit dem letzten Bus nach Hause.
Meine Welt war eine Welt des Mangels. Wir hatten weder Geld noch Liebe noch Trost zu verschenken. Ich lernte, dies von niemandem zu erwarten. Also arbeitete ich während meiner ganzen Collegezeit und studierte Wirtschaft und Rechnungswesen – eine sichere, clevere, vernünftige Wahl. Nach dem College nahm ich einen Job in einer Buchführungsfirma an. Davon konnte ich gut leben.
Nach außen hin war alles in Ordnung. Aber innerlich war es nicht so. Was wir als Kinder lernen, vergessen wir nie – und meine Lehrerin war die Angst gewesen. Sie hielt mich davon ab, Risiken einzugehen und meinem Herzen zu folgen. Sie ließ mich das ganze Leben als Konkurrenzkampf sehen. Ich fing an, mein Gehalt beim Poker aufs Spiel zu setzen. Wenn ich nicht gewann, meinte ich, sterben zu müssen.
Etwas fehlte in meinem Leben und ich hatte immer das Gefühl, ich müsse kämpfen, um nicht in ein Loch zu fallen.
Als ich fünfundzwanzig war, verfasste ich die „10 Alexander-Regeln“, eine Liste mit idealistischen Anregungen zur Selbstmotivation, die mich aus meinem Trott herausholen sollten. Eine Regel lautete: Wenn ich jemals 10 000 Dollar habe – das entsprach damals fast einem Jahresgehalt –, dann gebe ich meinen Job auf und mache, was ich will.
Dieser Plan war in meinen Augen der einzige Ausweg aus der Furcht. Ich hatte keine Ahnung, woher ich so viel Geld bekommen sollte, doch ich war überzeugt: Falls ein solches Wunder geschah, dann würde mich die Sicherheit, die mit so viel Wohlstand verbunden war, von meinen drängendsten und tiefsten Sorgen befreien.
Das passierte natürlich nicht. Im Lauf der nächsten Jahre machte ich zwar Karriere und hatte 10 000 Dollar und mehr auf meinem Bankkonto. Was aber noch wichtiger war: Ich wurde Christ und blühte geistlich auf. Ich heiratete eine wunderbare Frau und wir bekamen drei Söhne. Ich lebte ein Leben, das nach außen hin von Erfolg und Erfüllung gekrönt war.
Doch selbst in dieser Zeit verschwand die Furcht nie wirklich. Das Gefühl des Mangels war in mein Leben eingezogen, als ich neun war, und erst viel später zog es wieder aus – durch eine Reihe von Ereignissen, die ich Ihnen im vierten Teil dieses Buches schildern werde.
Alles Geld dieser Welt kann ein tief sitzendes Gefühl des Mangels nicht überdecken. Die Wissenschaftlerin und Bestsellerautorin Brené Brown schreibt dazu: „Sich wegen Mangels Sorgen zu machen ist die Version von posttraumatischem Stress in unserer Kultur. Er tritt auf, wenn wir zu viel hinter uns haben, und statt uns im Interesse der Heilung zusammenzuschließen (was Verletzlichkeit voraussetzt), sind wir ärgerlich und verängstigt und gehen uns gegenseitig an den Kragen.“2
Das ist kein Problem, das nur die Mittelschicht betrifft. Das Gefühl des Mangels wirkt sich auf alle Ebenen der Gesellschaft aus. Bei einer Umfrage unter amerikanischen Millionären aus dem Jahr 2015 sagte mehr als die Hälfte von ihnen, sie fühlten sich finanziell nicht sicher. Die meisten äußerten die Sorge, eine unerwartete Veränderung – der Verlust der Arbeitsstelle, ein Börsencrash oder eine Fehlinvestition – könnte ihr Leben von einem Augenblick zum anderen verändern. 52 Prozent fühlten sich „wie in einer Tretmühle“. Egal auf welchem Niveau sich der Wohlstand der Befragten bewegte, sie alle gaben an, sie müssten doppelt so viel besitzen wie in der Gegenwart, um sich sicher zu fühlen.3
Und doch fand ein kleiner Junge namens Jaden, der fast nichts besaß, einen Ausweg aus diesem Gefühl des Mangels. Was hatte dieser Sechsjährige erkannt, das die reichsten Leute im Land nicht erkannten?