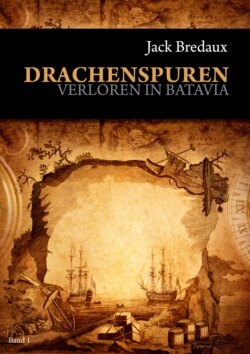Читать книгу Drachenspuren - Jack Bredaux - Страница 4
Kapitel 1
ОглавлениеGerade so, als wollte die Mirte sich mit ihrem Bugspriet direkt in den Meeresgrund bohren, schiebt sich der Bug unter die drohend heranrollenden Wassermassen. Und, als möchte sie sich nur wenige Augenblicke später mit den Naturgewalten messen, reckt sie die Galionsfigur wieder stolz dem Himmel entgegen. Wasser, um uns herum nichts als Wasser, dazu der Lärm der tosenden See und das unheilvolle Pfeifen des Windes.
„Herr van Houten, seht zu, dass Ihr unter Deck kommt“, dringt in Wortfetzen die Stimme des Kapitäns an mein Ohr.
„Kapitän Snijder, unter Deck würde ich nicht mehr Ruhe finden“, schreie ich gegen den Sturm an.
„Wir können es uns aber nicht erlauben, noch mehr Leute zu verlieren, also folgt meinen Worten, Herr van Houten.“
Das Drängen in der Stimme des Kapitäns zeigt deutlich, dass es keine Bitte seinerseits ist, sondern ein klarer Befehl, dem ich folgen sollte.
Als wollte er die erkennbare Schärfe aus seinen Worten nehmen, brüllt er hinterher: „Am Horizont sind Lichtstreifen auszumachen, so Gott will, werden wir es bald überstanden haben. Kümmert Euch um euren Schützling, er wird für Beistand sicher dankbar sein.“
„Ihr ruft Gott an, Kapitän; wäre es nicht besser einen Pakt mit dem Teufel zu schließen, in dessen Händen wir uns gerade befinden?“
Mit diesen Worten und ständig nach Tauen greifend, die mir Halt bieten können, mache ich mich auf den befohlenen Weg unter Deck.
Nicht allzulange war es her, dass ich gelegentlich eine Schänke nahe dem Hafen aufsuchte. Recht gespannt lauschte ich dort den Erzählungen raubeiniger Seeleute. Sicherlich, davon war manches mehr Prahlerei, rasch gesponnenes Seemannsgarn, um sich selbst in ein rechtes Licht zu rücken. Aber vielfach deckten sich auch die Aussagen und ergaben ein wundersames Bild von fernen Ländern und fremden Kulturen. Auf diese Weise keimte in mir die Sehnsucht, selbst einmal an Bord eines dieser Handelsschiffe die Welt zu erkunden.
Doch jetzt auf See verdrängt der tägliche Kampf ums nackte Überleben immer mehr den damals gehegten Wunsch, die salzige Luft auf der Haut zu spüren, gleichsam auf den Lippen zu schmecken. Das gleißende Licht der Sonne und die bisweilen unerträgliche Hitze, machen nicht weniger zu schaffen, als die auf uns hereinstürzenden Wassermassen. Sehnen wir nach unendlichen Tagen, an denen der weiße Feuerball am Himmel uns die Körper ausdörrt, das erfrischende Nass geradezu herbei, dann wechselt die Stimmung rasch wieder ins Gegenteil, wenn sich die Himmelspforten schließlich wirklich über uns auftun.
Nach den gleichsam entbehrungs-, wie auch ereignisreichen Wochen auf See gibt es wohl niemanden an Bord, der sich nicht darauf freut, in Kürze die stets schwankenden Planken verlassen zu dürfen. Hitze und Nässe machen immer mehr unserer Vorräte zunichte, das Wasser schmeckt brackig und der Zwieback beginnt zu schimmeln. Wer sonst, wenn nicht Kapitän Snijder, wäre unter den gegebenen Umständen in der Lage, uns in den sicheren Hafen von Batavia zu führen. Stets las ich in den Geschäftspapieren von diesem Ort, den sich die VOC, die Vereenigde Oost-Indische Compagnie in der Fremde geschaffen hatte. Ein wehrhafter Umschlageplatz für die Güter der umliegenden Inseln, welche den Niederlanden so reichlich Wohlstand bringen.
Es ist meine erste Reise zur See überhaupt und nie zuvor fühlte ich mich der Heimat ferner, als in diesem Moment. Nicht, dass die zu Beginn der Reise verspürte Freude sich nun gänzlich legt. Doch mit je-der Seemeile welche die Mirte hinter sich bringt, wird mir bewusster, um was für eine stete Plackerei es sich handelt. Zwar kann ich beinahe täglich reichlich Neues für mich entdecken, dennoch wäre es völlig falsch, dabei von einem vergnüglichen Abenteuer zu sprechen. Sind es nicht die rauen Winde, die unser Schiff einem Korken gleich, zum Spielball der Wellen werden lassen, dann treibt einen die Sorge um, die wertvolle Fracht zu verlieren oder Ängste machen sich breit, auf Piraten zu treffen. Doch die meisten Gedanken gelten Friedrich, dem mir anvertrauten Buben, der gerade seinen elften Geburtstag vollendet hat.
„Friedrich, Käpt´n Snijder meint, Du benötigst meinen Zuspruch“, bringe ich hastig hervor, bevor ich mehr in die Kammer fliege, als dass ich in sie eintrete. „Er weiß wohl nicht, was für einen zähen Burschen wir uns da an Bord geholt haben“, lobe ich den Knaben.
„Mir ist übel, Herr van Houten und es macht große Mühe, nicht aus der Hängematte zu purzeln, aber trocken ist es hier unten allemal. Ihr hingegen seht aus, als wäret Ihr gerade über Bord gegangen“, lächelt Friedrich verschmitzt.
„So fühle ich mich auch, Friedrich, doch wäre ich wie Du unter Deck geblieben, dann sähe mein Gesicht so grün aus, wie das Deine“, frotzele ich zurück. „Der Käpt´n sagt, dass wir in Kürze in ruhige Fahrwasser gelangen, unsere Geduld wird also nur noch kurze Zeit auf die Probe gestellt werden.“
Tatsächlich ist nach einiger Zeit zu spüren, wie der vermeintliche Ritt auf den Wellen nachlässt und unser stolzes Schiff wieder mehr nach vorne drängt, als seitwärts zu schlingern. Das Heulen des Windes wird weniger und das Knarren von Türen, das Poltern derber Stiefel oder das Tappeln nackter Füßen, ersetzen den bisherigen, unheilvollen Lärm. Endlich scheint das Wüten der vergangenen zwei Tage sein Ende zu finden.
„Komm, Friedrich, lass uns hinauf an Deck gehen und wenn möglich, gar einen Sonnenstrahl entdecken.“
Ein übler Geruch von modriger Nässe, Schweiß und Erbrochenem schlägt uns beim Öffnen der Tür aus Richtung der Mannschafträume entgegen. Bis auf diejenigen, die sich bis hierher den Naturgewalten entgegen-stellten und nun zur Ruhe die Kojen aufsuchen, drängen alle nach oben. Sehr zum Missfallen einiger Offiziere, die durchnässt bis auf die Haut, die Mannschaften immer wieder antreiben, das überall an Bord herrschende Chaos zu beseitigen. Kübel liegen verstreut herum, Taue bilden, wie durch den Sturm verknotet, ein undurchdringliches Dickicht. Hier schlägt ein Stück Segel, welches sich losgerissen hat, wie wild durch die Luft, dort haben Wanten Schaden genommen. Zudem sind nicht mehr alle Waren, die den Bauch der Mirte füllen, noch an ihrem angestammten Platz. Somit ist die Luft nun erfüllt von den schallenden Befehlen und diese verstummen erst, als sich die heisere Stimme des mutigen Mannes hoch oben im Ausguck Gehör verschafft.
„Batavia, Batavia voraus!“
Ein freudiges Gejohle setzt daraufhin ein, wogegen nur die im Sturm erprobte markante Stimme des Kapitäns ankommt.
„Nun Herr van Houten, was habe ich Euch gesagt, Gott hat uns in sicheres Wasser geführt und dem Teufel haben wir ein Schnippchen geschlagen. Wie geht es dem jungen Mann an Eurer Seite?“
„Danke der Nachfrage, Kapitän Snijder, mir geht es recht gut“, erwidert Friedrich beflissen. „Keinen Moment habe ich mich gefürchtet, denn Herr van Houten sagte mir doch, dass Ihr der Beste und Einzige seid, der uns durch dieses Wetter bringen kann“, schmeichelt der Bursche hinterher.
„Dann bin ich froh, dass ich Herrn van Houten unter Deck schickte, bevor er über Bord gespült wurde und Dir Friedrich, diese Nachricht überbringen konnte“, lacht der Kapitän breit, um sich gleich darauf wieder mit neuen Befehlen an seine Offiziere zu wenden.
Aus dem Mastkorb vielleicht, doch von Deck aus ist Batavia noch nicht auszumachen. Aber, wie ein Leuchtfeuer, weist uns nun der in der Ferne erkennbare Feuerberg den Weg. Anmutig, von einem tiefen Grollen begleitet, macht sich dort weißer Rauch auf, dem Himmel entgegen zu streben. Und wie in einem aufwändig gewebten Tuch, präsentieren sich die rotglühenden Fäden darin, die vom Inneren des Berges empor geschleudert werden. Ein Bild, wie von einer anderen Welt, furchteinflößend und schön zugleich.
„Batavia voraus“, ist noch einmal die schwächer werdende Stimme aus dem Korb zu vernehmen, der weitoben am Mast, dem Seemann seit Stunden eine schwankende Heimstatt bietet. Mit schwachem Wind in den Segeln, schiebt sich die Mirte beständig durch eine nunmehr kaum bewegte See. Deutlich sind jetzt auch von Deck aus die festen Mauern auszumachen, die mit jedem Augenblick den wir uns nähern, größer und gewaltiger werden.
Fast gemächlich schiebt sich unser großes Schiff in die gut befestigte und wehrhafte Hafenanlage. Schon seit geraumer Zeit sind die Mannschaften eingeteilt und jeder der Seeleute weiß, welche Arbeiten auf ihn warten. So steht frühzeitig fest, wer zunächst an Bord verbleibt und Wache schiebt oder wer zuerst den lange ersehnten festen Boden unter den Füßen zu spüren bekommt.
Wie immer, wenn ein so großes und schönes Schiff einen Hafen anläuft, so stehen wieder unzählige Schaulustige bereit. Allerdings scheint die Aufmerksamkeit nicht uns zu gelten, sondern vielmehr dem nun deutlich erkennbareren Berg, dessen Grollen ebenfalls klarer an unsere Ohren dringt. Zwar etliche Meilen entfernt hört sich sein Grollen jetzt nicht mehr so sanft an, wie noch wenige Stunden zuvor, sondern eher warnend, vielleicht sogar drohend.
„Schaut, Herr van Houten, das Wasser im Hafenbecken scheint wie in einem großen Topf zu brodeln“ unterbricht Kapitän Snijder meine Ge-danken.
„Ja, Kapitän“, stimme ich zu und hänge ein „als würden die Fische einen Hochzeitstanz aufführen“ daran.
„Ich wusste gar nicht, dass neben dem kaufmännischen Geschick auch noch poetisches Blut durch eure Adern fließt“, kommt es lachend vom Kapitän zurück. „Nehmt euren kleinen Freund an die Hand, damit wir uns aufmachen können, von Bord zu gehen. Ich freue mich schon auf das Badehaus und darauf, endlich was anderes zwischen die Zähne zu bekommen, als eingelegten Kohl oder Pökelfleisch.
Neben Kapitän Snijder und dem mir anvertrauten Buben, gesellen sich noch Herr Wachtendoonk, Herr Juncker, sowie zwei weitere Offiziere dazu.
Trotz der erdrückenden Hitze und kaum zu ertragenden Schwüle erweckt der Tag den Anschein, recht schön zu werden. Dass sich am Horizont die empor geschleuderten Aschewolken verdichten, als würde ein schweres Unwetter aufziehen, trübt keineswegs die Freude auf den Landgang.
Füllte noch bis vor wenigen Augenblicken die frische Luft der See unsere Lungen, so empfängt uns hier in den engen Gassen von Batavia der Gestank des Unrats. Dazu liegt, kaum sichtbar, feiner Staub in der Luft, der einen schwefligen Geruch mit sich führt. Ein Eindruck, als würde Satan selbst seinen heißen Atem ausstoßen.
Wenngleich zahlreiche Schiffe im Hafen liegen und somit überall große Betriebsamkeit herrscht, finden wir doch reichlich Platz in einem der Badehäuser vor. Denn viele hat es nach draußen getrieben, um das immer lauter werdende Spektakel des Berges zu verfolgen.
Obwohl die hoch am Himmel stehende Sonne unerbittlich brennt und die schwere, feuchtigkeitsgeschwängerte Luft, auf uns lastet, ist es dennoch äußerst wohltuend, im warmen Wasser des Zubers zu liegen. Fort mit dem, wie auf der Haut eingebranntem Salz der See.
Während fleißige Hände sich darum bemühen, unsere ramponierte Kleidung in Ordnung zu bringen, gießen andere stets neues, warmes Wasser über uns, so dass ein jeder für sich bald bis zum Halse bedeckt im Zuber liegt. Erfrischt und müde zugleich, aber mit einem gewaltigen Hungergefühl im Bauch, machen wir uns im Anschluss an das Bad daran, ein Wirtshaus aufzusuchen.
Das Glück ist uns hier ebenso wohlgesonnen und unsere kleine Gruppe findet noch Platz auf einer der Bänke, in diesem doch recht gut besuchten Gasthaus. Das Klappern der Teller vermischt sich mit dem Geräusch aneinander stoßender Wein- und Bierkrüge und dieser durchaus angenehme Lärm, wird nur von dem vielfältigen Sprachengewirr übertroffen.
Kaufleute, Seemänner und Händler aus aller Herren Länder geben sich hier ein Stelldichein. Aber so unterschiedlich die Leute in ihrer Kleidung oder ihrem Äußeren auch sind, so verschieden die Gründe, sich hier einzufinden, ein Thema beherrscht so gut wie jeden Tisch. Alle sprechen von dem schaurigschönen, Feuer spuckendem Monster, welches sich, wenn auch Meilen entfernt, dort draußen sehr laut bemerkbar macht.
Aufmerksam das Treiben im Wirtshaus verfolgend, sitzt der aufgeweckte Friedrich neben mir. Kaum dass wir unseren Platz eingenommen haben, werden Krüge und Becher vor uns hingestellt und es dauert nicht zu lange, bis die Teller mit den wohlduftenden Speisen vor uns liegen. Friedrich scheint nicht nur müde und hungrig zu sein, sondern ebenfalls überaus angetan davon, sich jetzt mit etwas anderem beschäftigen zu können, als nur den Gesprächen am Tisch folgen zu müssen.
„Darauf scheinst Du gewartet zu haben, Friedrich“, richtet der
Offizier, Herr Wachtendoonk, das Wort an den Buben.
„Ja, Herr Wachtendoonk, das ist schon etwas anderes, als Salzfleisch und Fisch an Bord oder daheim stets süßes Mandelsulz auf den Teller zu bekommen“, gibt Friedrich mit vollem Munde zurück.
„Ich finde die Speisen auch erfrischend anders. Wahrscheinlich sollten wir die herrlich duftenden und schmackhaften Gewürze nicht nur aufwendig in die Heimat schaffen, sondern sie dort auch mehr benutzen“, mische ich mich in das Gespräch ein.
„Wenn die Kosten in der Heimat nur nicht so hoch dafür wären, Herr van Houten“, gibt nun wiederum Kapitän Snijder sein Wort dazu.
„Ihr, wir alle, profitieren doch recht gut davon, Kapitän“, gebe ich zur Antwort.
Der uns alle um Haupteslänge überragende Herr Wachtendoonk winkt wild mit dem Arm und seine sonore Stimme durchdringt den Gastraum: „Ruben, kommt her und gesellt Euch zu uns, wir haben noch Platz für einen hungrigen Gesellen.“
So aufgefordert, bahnt sich Ruben van Schrieck, unser Steuermann, den Weg durch den Schankraum zu unserer Bank.
„Ah, Käpt´n, findet Ihr es richtig, schon kräftig dem Weine zuzusprechen, während ich noch damit beschäftigt war, die wertvolle Mirte richtig zu vertäuen?“, scherzt der Steuermann zur Begrüßung.
„Herr van Schrieck, Ihr dürftet noch gar nicht im Wirtshaus sein“, entgegnet Kapitän Snijder kurz, um gleich darauf auf den fragenden Blick des Steuermanns einzugehen, „Solltet Ihr nicht auch zuvor das Badehaus aufsuchen?“
Herrn van Schriecks „ich war doch..“, geht im allgemeinen Gelächter unter. Derweil betrachtet Herr Juncker, ganz aus dem Blickwinkel des Botanikers, den vor ihm platzierten Gemüseteller.
So folgt ein Wort dem anderen, bis die Bäuche gefüllt und die Teller nahezu leer sind.
„Wir sollten jedoch nicht zu lange beim Essen verweilen, sondern schauen, dass wir unseren chinesischen Geschäftspartner zu Gesicht bekommen“, mahne ich, immer noch mit dem Essen befasst, bereits vor-sichtig zur Eile. Zwar sind erst wenige Stunden vergangen seit wir Batavia erreichten, doch auf Grund der vor mir liegenden Aufgaben plagt mich die innere Unruhe.
„Herr van Houten, die Mirte ist gut im Hafen auszumachen. Sollten sich unsere Handelspartner bereits in Batavia aufhalten, so werden sie sicherlich von unserer Ankunft erfahren haben und womöglich bereits nach uns Ausschau halten“, versucht Kapitän Snijder mich zu beruhigen. „Wir haben doch reichlich Zeit eingeplant, die Waren an Bord zu nehmen. Den fleißigen Seeleuten sollten wir die Tage an Land gönnen, denn die Rückfahrt mit einer nicht minder vollbeladenen Mirte wird noch beschwerlich genug werden“, ergänzt der Kapitän seine Worte.
„Ihr habt sicherlich Recht, Kapitän, doch versteht meine Unruhe, denn keineswegs möchte ich Herrn van Dyck enttäuschen. Und die Aufgaben, die noch vor mir liegen, habe ich nie zuvor hinter mich gebracht.“
„Wohl wahr, Herr van Houten, wohl wahr, aber Ihr seid umgeben von guten Freunden, die derartige Fahrten nicht zum erstenmal machen. Also geht die Dinge gemächlich an und genießt die Zeit in Batavia. Hier sind wir der Heimat doch viel näher, als während der vorangegangenen Monate auf See.“
„Ja, nur die Hitze und der Gestank in den Gassen zeigt uns auf, wie weit wir von Amsterdam entfernt sind“, bringt Herr Wachtendoonk lachend ein.
So ist das allumgreifende Gespräch über den Feuerberg an unserem Tisch im Moment kein Thema; lautstark werden wir jedoch daran erinnert. Ein Grollen, um ein Vielfaches lauter, als es bislang zu vernehmen war, lässt die Gespräche in der Gaststube verstummen. Die Stille, nach der vor wenigen Augenblicken noch herrschenden Unruhe, wirkt fast gespenstisch. Unser Mahl ist beendet, weshalb auch wir uns von Neugier geplagt aufmachen und die Schänke verlassen. Majestätisch blickt das in der Ferne liegende, feuerspuckende Monster auf uns herab. Mehr und mehr verdrängen die hochemporgeschleuderten Aschewolken das strahlende Blau am Firmament.
„Der Himmel scheint Eure Worte vernommen zu haben, Herr van Houten. Darum ist es wohl besser, wir folgen Eurem Rat und begeben uns zur Mirte, solange uns das Licht des Tages noch erhalten bleibt.“
„Ist recht, Kapitän, wenn auch die verbleibenden Stunden kaum ausreichen werden, den Bauch unseres Schiffes zu leeren und alle Waren in die Lagerräume zu schaffen“, antworte ich beflissen.
Emsig schaffen die Seemänner und angeheuerten Träger die Lasten von Bord. Kiste um Kiste, Sack um Sack und Korb um Korb, kommen aus den Tiefen des Rumpfes nach oben. Zügig muss alles von statten gehen, weshalb die antreibenden Befehle nicht weniger werden. Jede Minute zählt. Denn anders, als in der fernen Heimat, gibt es keine Dämmerung, welche für die Arbeiten genutzt werden könnte. Die Nacht folgt hier dem Tage unmittelbar.
So plötzlich, wie die Nacht dem Tage folgt, endet das geschäftige Treiben und an Bord kehrt Ruhe ein. Lediglich das gelegentliche Tippeln der umhergehenden Wachmannschaft, das im schwachen Wind umsichschlagende Ende eines Segels, die knarrenden Planken oder das regel-mäßige Läuten der Schiffsglocke, bilden die vertraute Geräuschkulis-se. Wäre da nicht der ferne Berg, der Tag und Nacht gleichermaßen hindurcharbeitet und sein Grummeln hören lässt.
Schon früh beginnen am folgenden Morgen die Arbeiten, denn kaum mehr als die Hälfte der mitgeführten Güter sind bislang von Bord geschafft. Der stete Husten des Feuerbergs hüllt ganz Batavia mittlerweile in ein diffuses Licht. Nur weit draußen auf See, spiegelt sich das Blau des Wassers im Himmel wider. Mit der gleichen illustren Truppe des Vortages machen wir uns nach Stunden der Plackerei auf den Weg zu der uns bekannten Schänke. Ein kräftiges Mahl soll Stärkung bringen, denn schließlich gilt es bald noch, den leeren Bauch der Mirte wieder aufzufüllen.
Überall wird indes geschuftet, als gäbe es kein Morgen mehr und überall beherrscht das furchteinflößende Gehabe des speienden Berges die Gespräche.
Weit im Inneren des Gasthauses finden wir diesmal unseren Platz. Und kaum dass wir sitzen und die Bestellungen aufgeben, stehen die Krüge und Becher wieder auf unserem Tisch, folgen die Teller mit den dampfenden Speisen. Doch, noch bevor irgendwer von unseren Leuten den ersten Bissen zum Munde führen kann, lässt ein durchdringender Knall das Gebäude erzittern.
Gläser wackeln, verschütten ihren Inhalt über die Tische. Krüge zerbersten lautstark auf dem steinernen Boden, der sich zu heben scheint. Regale wanken, schwankenden Seeleuten gleich, bevor sie dann mit Getöse umstürzen und zu Bruch gehen. Ebenso fallen zahlreiche Leuchter um, deren verlöschende Flammen den Raum dunkler werden lassen. Bleibt ein Licht jedoch am Flackern, so sucht es einem Raubtier gleich nach Nahrung, so dass die schließlich Flammen hoch auflodern.
Alle drängen zum Ausgang, quetschen sich durch die vermeintlich enger werdende Öffnung, dem schwachen Tageslicht entgegen.
„Raus hier!“, brülle ich in Friedrichs Richtung und greife bei meinen Worten fest nach dessen Hand. Mehr, als dass der Knabe selbst in der Lage ist zu gehen, ziehe ich ihn über alles hinweg, was den Weg versperrt.
Vor der Schänke angekommen, bietet sich kaum ein anderes Bild.
Kreuz und quer laufen die Menschen in alle Richtungen, ohne zu ahnen, in welcher ausreichend Schutz zu finden sei. Zunächst bemühe ich mich, dem hochaufragenden Herrn Wachtendoonk zu folgen. Doch das Gedränge der Verängstigten ist zu groß, als dass dieser Versuch Erfolg verspricht. Längst sind auch Kapitän Snijder und die anderen Begleiter aus meinen Augen verschwunden. Mit Friedrich an der Hand bahne ich mir nicht minder rücksichtslos, als die uns umgebenden Massen, den Weg. Hier fallen Schindeln von den Dächern, dort bricht Mauerwerk ein; der Boden unter unseren Füssen hebt und senkt sich, als möchte er das Spiel der Wellen nachempfinden. Und an manchen Stellen tut sich die Erde gar auf, so, als könnte man direkt in den Schlund des Teufels blicken.
Die Urgewalt, mit welcher der Berg in der Ferne sein glühendes Inneres ausspuckt und die Erde hier zum Beben bringt, hat ihr zuvor schaurigschönes Antlitz verloren. Nach all den vorangegangenen Mühen und Plagen, lecken nun die feurigen Zungen nach uns. Ist Batavia gar selbst die Hölle, die mit Wohlstand lockt, um die davon Berauschten schließlich ins Verderben zu führen und in die Tiefe zu reißen?
Das Geschrei der Menschen um uns herum wird lauter als das stete bedrohliche Grollen, welches der Wind heranträgt. Zudem nimmt es jede Möglichkeit, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich entdecke den gewaltigen Mast unseres Schiffes und versuche, mich daran zu orientieren. So schieben wir uns durch das Durcheinander, bis mich plötzlich etwas schmerzhaft an der Schläfe trifft. Ich spüre noch, wie mir Blut über die Wange rinnt und ich gleichzeitig die Kontrolle über meine Beine verliere. Bevor ich auf den Boden aufschlage, gehen mir die Gedanken durch den Kopf, dass ich als Kind bereits ein ähnliches Durcheinander erlebte. Wie nahe Freud und Leid doch beieinanderliegen geht mir durch den Sinn, bevor ich gänzlich das Bewusstsein verliere.