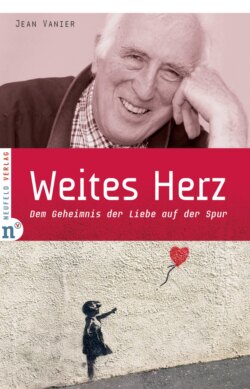Читать книгу Weites Herz - Jean Vanier - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gott beruft uns in die Welt der Liebe
ОглавлениеJesus blickt auf unsere Welt von heute, auf unsere riesigen Städte, auf unsere Länder mit allen ihren Spaltungen, ihrer Ungleichheit, ihrem Hass und ihrer Gewalttat und er weint.
Jesus kam in die Welt, um Frieden zu bringen, um alle Menschen zu einem einzigen Leib zusammenzufügen, in dem jeder Mensch seinen Platz hat. Aber wir Menschen haben aus unserer Welt eine Stätte voller Konkurrenzkampf, Wettbewerb, Rivalität, Konflikt und Krieg zwischen Rassen, Religionen, sozialen Klassen und Ländern gemacht. Die Welt ist zu einer Stätte geworden, an der alle das Gefühl haben, sie müssten sich schützen und verteidigen, auch ihre eigene Familie, ihr eigenes Land, ihre eigene Klasse, ihre eigene Religion. Nuklearwaffen, Raketen und Maschinengewehre sind die äußeren, sichtbaren Zeichen unserer inneren, unsichtbaren persönlichen Waffen. Diese holen wir vor, sobald wir uns bedroht, erniedrigt und abgelehnt fühlen oder wenn wir das Gefühl haben, man gebe uns nicht den uns zustehenden Raum; unseren Raum, auf den wir ein Recht haben. Gewalttätigkeit und Hass existieren heute genauso, wie es bereits im Buch Genesis beschrieben wurde:
Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen groß war …
(Genesis 6,5)
Die Erde war in Gottes Augen verdorben, sie war voller Gewalttat.
(Genesis 6,11)
Die gleiche Gewalttätigkeit und Schlechtigkeit erfüllt die Erde auch heute. Der gleiche Prozess von Hass und Spaltung wiederholt sich immer und immer wieder, Tag für Tag, Jahr um Jahr. Genährt wird er von der Angst und Verletzlichkeit des menschlichen Herzens. Denn wenn wir Menschen gewalttätig sind, dann hauptsächlich deshalb, weil wir so verletzlich sind. Gewalttätigkeit ist eine Reaktion auf ein verwundetes Herz, wenn dieses sich missverstanden, abgelehnt, ungeliebt fühlt. Sobald wir die leiseste Ablehnung spüren, reißt diese Wunde wieder auf und unsere Verteidigungsmechanismen kommen in Gang.
Ich entsinne mich an einen Besuch in einem Hochsicherheitsgefängnis in Kingston, Ontario. Ich erzählte dort den Häftlingen von den Menschen, die wir in die Arche aufgenommen hatten, von ihrem Leiden, ihrem Gefühl, gescheitert zu sein, abgelehnt zu werden; von ihrer Niedergeschlagenheit und zuweilen ihrer Selbstverstümmelung. Ich sprach von ihrer zerbrochenen Kindheit. Während ich diese Geschichten über unsere Leute in der Arche erzählte, wusste ich, dass ich ihnen in Wirklichkeit ihre eigene Geschichte erzählte, die Geschichte ihres Lebens, ihrer eigenen Erfahrungen damit, abgestoßen zu werden, zu trauern, unsicher zu sein und zu scheitern.
Am Schluss meines Vortrags stand einer der Häftlinge auf und schrie mir zu: »Sie haben ein leichtes Leben gehabt! Als ich vier war, musste ich mit ansehen, wie meine Mutter vor meinen Augen vergewaltigt wurde! Als ich sieben war, verkaufte mich mein Vater zum Sex. Als ich dreizehn war, kamen die ›Männer in Blau‹ [Polizisten], um mich zu holen. Wenn irgendjemand in dieses Gefängnis hier kommt und von Liebe daherredet, schlage ich ihm seinen verdammten Schädel ein!«
Ich hörte ihm zu, ohne zu wissen, was ich sagen oder tun sollte. Es war mir, als halte er mich gegen eine Wand gedrückt. Ich betete und dann erwiderte ich: »Es stimmt, was sie sagen. Ich habe ein leichtes Leben gehabt! Es stimmt, ich habe keine Ahnung von dem, was sie durchgemacht haben. Aber was ich weiß, ist, dass alles, was sie gesagt haben, wichtig ist. Die Leute außerhalb dieses Gefängnisses richten oft über sie, ohne zu wissen, was sie alles mitgemacht haben; sie kennen ihre Geschichte nicht, ihre Kindheitserfahrungen. Darf ich den Leuten draußen erzählen, was sie mir heute gesagt haben?« Er sagte: »Ja.«
Dann fügte ich hinzu: »Sie haben uns etwas Wichtiges zu sagen. Aber eines Tages kommen sie aus dem Gefängnis heraus. Dann werden sie wahrscheinlich das Leben außerhalb des Gefängnisses wieder kennen lernen und sich einiges darüber anhören müssen.« Ich fragte ihn, ob ich wiederkommen dürfe, wenn ich wieder einmal in der Gegend sei. Und er gab zur Antwort: »Ja.«
Als die Zeit zum Fragenstellen abgelaufen war, ging ich zu diesem Mann hin und schüttelte ihm die Hand. Ich fragte ihn, wie er heiße und woher er komme. Dann kam mir die Inspiration, ihn zu fragen, ob er verheiratet sei, und als er das bejahte, bat ich ihn, mir von seiner Frau zu erzählen.
Der Mann, der derart gewalttätig gewesen war und so gewirkt hatte, als trage er einen ungeheuren Hass in sich, brach in Tränen aus. Er erzählte mir von seiner Frau, die in Montreal lebe, im Rollstuhl. Er habe sie schon zwei Jahre lang nicht mehr gesehen! Ich stand vor einem verwundeten, verletzlichen kleinen Kind, das weinte und förmlich nach Liebe und Zärtlichkeit schrie. Mein Vortrag über unser Bedürfnis nach Liebe, Gemeinschaft der Herzen und Güte – nach all dem, was ihm versagt geblieben war – hatte die tiefe Wunde in seinem Herzen wieder aufgerissen und er hatte das als unerträglich empfunden!
Er lehrte mich etwas Wichtiges: Die Quelle unserer Tränen und Gewalttätigkeit liegt oft tief unterhalb aller Überheblichkeit und Selbstsucht. Tränen und Gewalttätigkeit können Wege sein, um uns vor dem Unerträglichen zu schützen, vor unserer eigenen Verwundbarkeit, vor unserer Angst vor dem Schmerz.
Inmitten aller Gewalttätigkeit und Korruptheit der Welt lädt uns Gott heute ein, neue Stätten des Dazugehörens zu schaffen, Stätten des Teilens, des Friedens und der Güte; Stätten, an denen niemand sich zu verteidigen braucht; Stätten, an denen alle ausnahmslos geliebt und akzeptiert werden, mit all ihrer Gebrechlichkeit und allen ihren Fähigkeiten und Behinderungen. Das ist meine Vision für unsere Kirchen: dass sie zu Stätten des Dazugehörens werden, zu Stätten des Teilens.
Wir sehen, dass zuweilen in unseren Kirchen, unseren christlichen Gemeinschaften genau die gleichen Machtkämpfe vor sich gehen, sich die gleiche Geschichte voller Spaltungen und Konflikte abspielt, weil unsere Kirchen genau wie unsere Gemeinschaften aus gebrochenen, verwundeten Menschen bestehen, aus genau solchen, wie du und ich es sind. Wir alle müssen unablässig immer wieder zur wesentlichen Botschaft Jesu zurückgeführt werden, zur Botschaft der Liebe, zur Botschaft der Seligpreisungen und der Demut. Wir müssen uns auch immer deutlicher dessen bewusst werden, wie viele verschiedene Wege es gibt, um Spaltung herbeizuführen, Wege, auf denen wir andere schlecht machen. Wir müssen unser Bedürfnis erkennen, zu beweisen, dass wir besser sind als andere.
In den 1960er Jahren berief Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil ein. Das war für die katholische Kirche eine Zeit starker Erneuerung. Damals wurden die Kirchenführer daran erinnert, wie wichtig die Einfachheit ist: Jesus brachte seinen Jüngern nicht bei, wie sie »Kirchenfürsten« werden könnten, sondern wie sie einander die Füße waschen sollten.
Während der Kolonisierung von Nord- und Südamerika beschäftigte einige Kolonisatoren die Frage, ob die dortigen Bewohner volle Menschen seien. Die Theologen diskutierten darüber, ob ein Sklave eine Seele habe. Es brauchte lange, bis die Kirche die Sklavenhaltung verurteilte. Zeigt das nicht deutlich, wie weit wir alle uns von der ursprünglichen Botschaft Jesu entfernt haben?
Im kurz nach dem Tod Jesu geschriebenen Jakobusbrief wird uns erzählt, wie rasch sich die Gemeinschaft der Gläubigen verändert hatte: Die Leute hofierten diejenigen, die in feinen Kleidern daherkamen, während sie die schäbiger Gekleideten anwiesen, in der Versammlung weiter hinten zu bleiben … (vgl. Jakobus 2,4–9). Jakobus nahm daran wütend Anstoß. War Jesus nicht deshalb gestorben, weil er die Armen und Schwachen in den Mittelpunkt der Gemeinde gestellt hatte? Und jetzt schloss diese gleiche Gemeinde diese Menschen nach und nach immer mehr aus!
In jeder neuen Epoche, in jeder neuen Situation der Armut und Unterdrückung beruft Gott Menschen auf neue Weise; Gottes Ruf ist immer neu und dennoch immer der gleiche. Wir sehen, wie damals, als die Wasser die Erde überfluteten und überschwemmten, Gott Noach herausrief,
einen gerechten, untadeligen Mann unter seinen Zeitgenossen, der seinen Weg mit Gott ging.
(Genesis 6,9)
Je stärker wir uns der Gewalttätigkeit und Verderbtheit bewusst werden, die unsere Welt erfüllen, werden wir uns auch dessen bewusst, dass Gott uns beruft, diejenigen bei uns aufzunehmen, die schwach, angeschlagen und unterdrückt sind.
Gott beruft uns, in der Liebe zu wachsen, jeder und jede mit ihrer ganz eigenen Berufung. Der Begriff »Berufung« wurde allzu oft nur auf Ordensleute oder geweihte Priester angewandt. Aber hat nicht jeder und jede von uns eine Berufung? Ergeht nicht an alle ein Ruf von Gott? Ist die Ehe denn keine richtige Berufung? Brauchen denn Eheleute keine eigene Gabe von Gott, um ihr Eheleben in seiner ganzen Fülle verwirklichen zu können? Ist das nicht der Grund, weshalb wir immer wieder des Segens bedürfen und die Sakramente empfangen müssen; weshalb wir uns öffentlich vor anderen zu unserem Engagement bekennen müssen? Haben denn Menschen mit Behinderungen nicht eine ganz eigene Berufung? Paulus erinnert uns sehr nachdrücklich an ihre Berufung:
Seht doch auf eure Berufung! … Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen; das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt …
(1. Korinther 1,26–28)
Es ist wichtig, um Berufungen zu beten, um alle Berufungen! Genau wie Gott Noach herausgerufen hat, so ruft Gott jede und jeden von uns auf unsere ganz eigene Art heraus, um eine »Arche« zu bauen, eine Gemeinschaft der Liebe, in der die Liebe den Hass besiegt, das Einbeziehen das Ausschließen besiegt, das Einssein die Spaltung überwindet. Lasst uns Jesus darum bitten, er möge uns helfen, dass wir alle in unseren Herzen seinen Ruf deutlich hören.