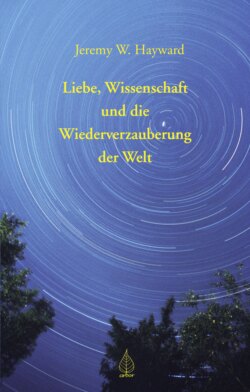Читать книгу Liebe, Wissenschaft und die Wiederverzauberung der Welt - Jeremy W. Hayward - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Brief
Geschichten mit Gefühl,
Geschichten mit Seele
Liebe Vanessa,
wie ich gestern versprochen habe, möchte ich im heutigen Brief etwas über die vielen Gesellschaften schreiben, in denen die Erfahrung der magischen Welt nicht verlorenging. Und ich möchte mit einer gar nicht so fernen Welt beginnen, mit dem mittelalterlichen Europa.
Das mittelalterliche Universum war von lebendigen und fühlenden Wesen aller Art bevölkert – von den Pflanzen und Tieren über Menschen, Geister und Engel bis hinauf zum Geist des einen Gottes der Christenheit oder bis hinunter zum Geist des Teufels. Jedes nur erdenkliche Wesen, so glaubten die Menschen, mußte aufgrund der unendlichen Großzügigkeit des Schöpfers existieren. Diese Große Kette des Seins oder der Wesen reichte vom Teufel und seinen Bediensteten über das Pflanzen- und Tierreich (zu dem auch die Frauen gehörten!) bis zum Menschen (also eigentlich zum Mann) und über ihn hinaus bis zu den Engeln und zu Gott.
Der eine Gott war in der Höhe, außerhalb seiner Schöpfung, aber sein Geist war in allen Wesen lebendig. Die christliche Kirche übernahm also das heidnische Empfinden, daß Gott sich der Welt der Phänomene aufprägt und sich in ihr bekundet. Engel waren damals noch nicht diese etwas dicklichen Kleinkinder mit Flügeln, wie man sie heute sieht, und auch nicht bloße Beschützer, die den Menschen nach Bedarf zur Seite stehen, sondern machtvolle, furchteinflößende Wesen, die dem »allmächtigen« Gott näher standen als die Menschen. Manche waren ursprünglich heidnische Gottheiten, die die Kirche sich aneignete, um den Menschen ein Gefühl von Kontinuität zu geben.
Was im Himmelreich war, spiegelte sich auf Erden wider. Daher der bekannte Satz »Wie oben, so auch unten«. Deshalb verstand man damals unter »Divination« oder Weissagung die Fähigkeit, das Göttliche hinter allen Erscheinungen zu erkennen. Es wurde noch nicht wie heute zwischen psychisch und physisch oder innen und außen oder wörtlich und symbolisch unterschieden. Es herrschte ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Verbundenheit aller Phänomene.
Und neben dem katholischen Glauben und seinen Dogmen bestanden komplizierte Systeme der Astrologie, Alchimie und Magie. Alle diese Traditionen hatten kontemplative Anteile, die das Studium von Sympathiebeziehungen oder Resonanzen einschlossen. Die, die diese spirituellen Traditionen lebten, lernten die Resonanzen zwischen den verschiedenen Ebenen der Schöpfung zu fühlen, etwa zwischen dem Sonnensystem und Teilen des menschlichen Körpers oder auch zwischen den verschiedenen Metallen und Pflanzen. Sie glaubten, daß sie durch die Kontemplation der in der Natur erkennbaren Verbindungen intuitiv die Verbindungen auf anderen Ebenen erfassen konnten.
Für den heutigen Wissenschaftler sieht es so aus, als hätten die Alchimisten untersucht, wie sich die verschiedenen Metalle und andere Elemente, wie etwa Schwefel, verbinden. Das waren, so wird uns gesagt, ganz einfach die Anfänge der Chemie. Doch tatsächlich ging es den Alchimisten auch darum, wie die verschiedenen Elemente der Persönlichkeit, die Metallen und anderen chemischen Elementen entsprachen, sich verbinden. Bei der Arbeit mit den Elementen glaubten die Alchimisten auch, daß sie ihre eigene geistige Natur verwandelten.
Anscheinend waren den Menschen des Mittelalters Bewußtseinsbereiche zugänglich, von denen heutige Wissenschaftler und unsere Kultur im allgemeinen nichts mehr wissen. Manche Autoren sprechen hier vom partizipierenden oder teilnehmenden Bewußtsein, und damit ist echte Erkenntnis durch Einswerden des Subjekts (des Ich) mit seinem Gegenstand gemeint.
Heute glauben wir, daß wir über einen Gegenstand nur dadurch etwas in Erfahrung bringen können, indem wir ihn als etwas von uns Getrenntes untersuchen. Beim partizipierenden Bewußtsein geht es aber gerade darum, daß der Mensch an einem Gegenstand teilhat. Er weiß um die Übereinstimmungen und Entsprechungen zwischen allen Dingen, und er fühlt die Sympathie- und Antipathiebeziehungen zwischen ihnen. So sahen und praktizierten es die Alchimisten, die keinen Unterschied zwischen geistigen und materiellen Vorgängen anerkannten. Der Historiker Morris Berman schreibt: »Es ist nicht nur so, daß sich die Menschen jener Zeit die Materie als mit Geist begabt vorstellten, nein, die Materie besaß damals tatsächlich Geist.« Und er fragt: »Was ist hier der veränderte Bewußtseinszustand? Warum ist die heutige Anschauung leichter zu glauben?«
Die Menschen nahmen Dinge in ihrer Welt wahr, die wir heute schlichtweg nicht mehr kennen. Die mittelalterliche Welt war tatsächlich magisch, sie war verzaubert. Die Leute vermochten neben den gewöhnlichen Menschen noch alle möglichen anderen Wesen zu sehen – Engel, Gespenster, Feen, Naturgeister. Sie glaubten nicht nur an diese Wesen, sondern sahen sie tatsächlich oder meinten das zumindest. Es gibt viele Berichte von Begegnungen zwischen Menschen und Engeln oder Dämonen und Feen, und sie sind so nüchtern abgefaßt, daß wir keinen Grund haben, sie für bewußte Fälschungen zu halten.
Die Historikerin Carolly Erickson beispielsweise berichtet von einem Mönch des Klosters Byland in Yorkshire, der etliche in dieser Gegend vorgekommene Begegnungen zwischen Menschen und Bewohnern anderer Bereiche aufzeichnete. »In einer dieser Geschichten«, schreibt sie, »geht es um einen Schneider namens Snowball, der einem Geist begegnete und dadurch samt seinen Nachbarn und der örtlichen Geistlichkeit in eine längere Auseinandersetzung mit dem Körperlosen hineingezogen wurde.«
Sie erzählt weiter: »Eines Abends auf dem Heimritt umflatterte ein Rabe Snowballs Kopf und fiel dann wie sterbend zu Boden. Als dem Tier Funken aus den Seiten stoben, wußte Snowball, daß er es hier mit einem Geist zu tun hatte. Er bekreuzigte sich in Gottes Namen, damit ihm kein Schaden geschehe.« Er wurde noch zweimal von dem Geist angegriffen, bevor er sich entschloß, ihn zu fragen, was er wolle. Anscheinend war dieser Geist in irgendeinem sehr unerfreulichen Bereich gefangen, weil er in seinem Leben als Mensch etwas Böses getan hatte. Jetzt brauchte er einen Priester, der ihm die Absolution erteilte. Er traf eine Abmachung mit Snowball, der daraufhin für einige Tage krank wurde und dann den Priester holen ging. Der Geist konnte schließlich erlöst werden, und zum Dank sagte er Snowball die Zukunft voraus. Erickson zieht aus solchen Berichten folgenden Schluß:
Hinter der Wahrnehmung mittelalterlicher Menschen stand ein umfassendes Bewußtsein von simultanen Wirklichkeiten … Es bestand ein Wahrnehmungsklima, in dem unkörperliche Wesen für den Klerus wie fürs Volk eine nicht nur vertraute, sondern in gewissem Umfang auch handhabbare Erscheinung darstellten. Überall waren über das normale Sehen hinaus ungewöhnliche Erscheinungen wahrzunehmen – ungewöhnliche Naturereignisse, Omen, Traumbotschaften der Verstorbenen, göttliche und höllische Warnungen, Erleuchtungen, Zukunftsvisionen … Das Mittelalter verstehen heißt sich einer Bewußtseinsqualität anzunähern, die unsere moderne Bildung gerade diskreditieren möchte. Das Visionäre, für den rationalistischen Historiker peinlich und beunruhigend, war im Mittelalter keine Verirrung, sondern Gemeingut, nicht außerweltlich, sondern natürlich, eine Selbstverständlichkeit.
• Und die Begegnung mit unkörperlichen Wesen ist nicht einfach eine Sache der grauen Vergangenheit. W. Y. Evans-Wentz war Anthropologe und Religionswissenschaftler und einer der ersten, die Texte des tibetischen Buddhismus übersetzten. Zu Anfang unseres Jahrhunderts verbrachte er zwei Jahre in Irland, Schottland und Wales und sprach mit alten Leuten, die noch Feen sehen und hören konnten. Diese Feen hatten wenig mit den niedlichen kleinen Wesen gemein, die man in heutigen Kinderbüchern sieht. Sie hatten die Größe von Menschen und sahen auch Menschen ähnlich, nur waren sie durchscheinend und leuchteten und trugen Kleider einer vergangenen Zeit. Man beobachtete sie bei allen möglichen Gelegenheiten – bei Prozessionen und Riten, bei der Jagd oder auch wenn sie Menschen halfen. Und sie wurden nicht nur von einigen wenigen gesehen, sondern von vielen.
Als Evans-Wentz einen älteren Mann auf der Isle of Man fragte, weshalb die jüngeren Leute diese Wesen nicht mehr sähen, erhielt er zur Antwort: »Bevor die Bildung auf diese Insel kam, konnten viele die Feen sehen; jetzt sind es nur noch ganz wenige.« Die schulische Erziehung wird den Menschen wohl gesagt haben, daß es Feen nicht gibt; und wenn Kindern das Sehen von Feen verboten wird, verlieren sie auch bald die Fähigkeit dazu.
Trotzdem gibt es immer noch überraschend viele Begegnungen mit solchen »Märchenwesen«, manche erschreckend, manche wohlwollend. Katharine Briggs beispielsweise, eine bekannte britische Folkloristin, bekam von einer Freundin folgende Geschichte erzählt. Ihre Freundin hatte sich den Fuß verstaucht und saß im Londoner Regent’s Park auf einer Bank. Während sie überlegte, woher sie die Kraft nehmen sollte, nach Hause zu humpeln, sah sie plötzlich ein winziges, grün gekleidetes Männchen vor sich, das sie freundlich anblickte und dann sagte: »Geh nur heim. Wir versprechen dir, daß dein Fuß dich heute nacht nicht plagen wird.« Dann verschwand es. Und auch der heftige Schmerz in ihrem Fuß war weg. Sie konnte mühelos nach Hause gehen und schlief in der Nacht ohne Schmerzen.
Vor ein paar Jahren habe ich in Frankreich in einem zum Zen-Zentrum umgebauten alten Château unterrichtet. Das war eine sehr intensive Zeit, denn dort wurde nicht nur geredet, sondern wir haben auch meditiert und die »Götter« eingeladen, sich zu uns zu gesellen. Eine junge deutsche Teilnehmerin fing nach der Hälfte des Kurses an, einen in grüne mittelalterliche Tracht gekleideten Mann vor dem Fenster zu sehen. Sie wußte, daß das kein Mensch sein konnte, und bekam Angst. Sie sagte, sie habe solche Wesen als Kind gesehen, diese Gabe dann aber unterdrückt und seit zwanzig Jahren nichts dergleichen mehr wahrgenommen. Ich redete ihr zu, keine Angst zu haben, sondern den Herrn zu fragen, was er wolle. Gegen Ende des Kurses erzählte sie, er habe ihr gesagt, er sei der Beschützer des Landes und des Châteaus. Er sehe nur immer wieder mal nach dem Rechten, um sich zu vergewissern, ob wir Zen-Leute das Land auch achtungsvoll behandelten.
• Ähnlich wie die Welt des mittelalterlichen Europas ist auch die Navajo-Welt von einer subtilen Lebendigkeit und Kraft durchdrungen. Die Navajo sprechen von den Heiligen Leuten, diyin dine’e, die das lebendige Herz aller Menschen, Tiere, Pflanzen und unbelebten Dinge sind. Jedes sichtbare Ding hat seine unsichtbare Seite, sein diyin dine’e. Und so gibt es Berg-Leute, Sternen- Leute, Fluß-Leute, Regen-Leute, Maus-Leute und so weiter. Alle in der Natur vorkommenden Dinge wie Berge, Mesas, Caflons, Höhlen, Felsen, Flüsse, sogar die Witterungsbedingungen und das Licht sind Wohnstätten der Heiligen Leute.
»Ich habe als Kind gelernt, daß sie die Seele der Dinge sind«, sagt der Navajo-Künstler Baje Whitethorne von den Heiligen Leuten, »die Seele aller Dinge, aller lebendigen Dinge. So wie Gott die Seele aller Dinge sein muß, weil er ja überall ist, so sind sie es in der Navajo-Tradition, in unserer Religion. Sie sind die Seele der Dinge … Sie waren in den Steinen oder in den Bäumen, eigentlich so gut wie überall.«
»Wenn ich früh morgens nach draußen gehe«, sagt Kalley Musial, ein Navajo-Töpfer, »bete ich zum Wind, zum Neusein des Lebens; nicht zu irgendwem Bestimmten, sondern zu den Vögeln, den Pflanzen, einfach zum Leben überhaupt. Ich bete zum Morgengrauen, das ja das Erwachen des Lebens ist – für die Pflanzen, für die Vögel, für uns.
Wenn ich mittags bete, bete ich zur Sonne, die uns Wärme und Leben und Wachstum schenkt. Wenn ich abends bete, bete ich wieder zum Wind, zu allem um mich her, zur Luft, zu dem, was der Abend bringt. Wir beten zu allen, zu allem. So als wäre Gott da draußen, die Essenz von Leben, Luft, Regen, allem.«
In mancher Hinsicht sind die Heiligen Leute den Navajo sehr ähnlich. Sie sehen wie Menschen aus und leben auch ungefähr so wie die Navajo. Aber sie haben keinen Körper aus Materie. Ihr Körper ist mehr wie Wind oder Licht oder, wie die Navajo sagen, Heiliger Wind.
Wind ist das Symbol der universalen Lebensenergie, die in allen Dingen ist und ihre Lebendigkeit ausmacht. Diese Energien sind normalerweise nicht zu sehen, sondern nur an ihren Wirkungen zu erkennen, wie ja auch der normale Wind nicht direkt, sondern nur an den Bewegungen der Äste oder der Wolken sichtbar wird. Am Menschen bezeichnet man den subtilen, normalerweise nicht sichtbaren Wind als Inneren Wind. Die Heiligen Winde aller Einzeldinge sind eigentlich nichts Getrenntes. Sie sind alle Teil des Einen Windes, und die lebendige Energie des Windes durchströmt jeden noch so fest erscheinenden Gegenstand.
Peter Gold schreibt in seinem Buch über die heilige Weisheit der Navajo und der Tibeter: »Der Heilige Wind ist eine glitzernde, pulsierende, atmende Verschmelzung aller belebenden Energien eines lebendigen Kosmos. Er ist die Kraft hinter dem Universalen Geist, die alle Elemente und Phänomene des Kosmos durchdringt.« Zusammen erzeugen der Heilige Wind und der Universale Geist einen Seinszustand, der ho’zho genannt wird. Dieses Wort wird meist mit »Schönheit« übersetzt, bedeutet aber auch Harmonie, Glück, Gesundheit, Ausgewogenheit.
Der Unterschied zwischen den Heiligen Leuten und uns besteht darin, daß die Heiligen Leute gänzlich in diesem Ho’zho-Zustand leben, sie sind völlig eins mit den Kräften und Rhythmen und der ganzen Ordnung des Kosmos. Auch wir können bei aller Unvollkommenheit den Ho’zho-Zustand erreichen, weil wir aus demselben Stoff sind wie die Heiligen Leute. Wir sind Emanationen der alles durchdringenden Einheit und Kraft des Ho’zho.
Für einen traditionellen Navajo kommt es vor allem anderen darauf an, gemäß dem Ho’zho-Prinzip von Ausgewogenheit, Frieden und Schönheit zu leben. Das ist das Ziel des alltäglichen Handelns und der Gebete. So sagt der Navajo-Künstler Jimmy Toddy: »Jedes Gebet fängst du an mit ›Schönheit vor mir, Schönheit um mich her, Schönheit auf meinem Weg‹. Ho’zho – so geht das Gebet. Jedes Gebet sprichst du damit – Schönheit, Schönheit.«
• Die Shinto-Religion Japans ist der Weg der kami, meist mit »Götter« übersetzt. Aber Shinto ist eigentlich eine Lebensweise, wie der japanische Shinto-Experte Sokyo Ono sagt, »ein Amalgam aus Einstellungen, Ideen und Vorgehensweisen, die im Laufe von mindestens zwei Jahrtausenden tiefe Wurzeln im japanischen Volk geschlagen haben«. Kami ist für ihn ein Ehrentitel für edle, heilige Geister. Es schwingt etwas von Achtung, Liebe und Ehrfurcht darin mit. »Alle Wesen haben solch einen Geist«, sagt er, »und das heißt, daß man in gewissem Sinne alle Wesen als Kami oder potentielle Kami ansehen kann.«
In der Shinto-Welt gibt es wie bei den Navajo keinen allmächtigen Gott als Schöpfer von allem und als Herrscher über alles. Die Welt ist selbsterschaffen, und zu dieser Selbstschöpfung kommt es, weil die Kami – indem jeder seine besondere Aufgabe erfüllt – harmonisch zusammenwirken. Die Kami sind gegenwärtig in Wachstum, Fruchtbarkeit und Produktion, in Naturerscheinungen wie Wind und Donner, in der Sonne, in Bergen, Flüssen, Bäumen und Felsen und in manchen Tieren. Kami sind die Hüter des Landes und die Herz-Energien der Berufe und Fertigkeiten. Sie sind die Geister der Ahnen, der Nationalhelden, der Menschen, die Großes vollbracht haben oder von außergewöhnlicher Tugend sind, und all jener Menschen, die etwas für Zivilisation und Kultur und das Wohl der Menschen getan haben.
Wie erfahren die Japaner ihre Kami? Sokyo Ono schreibt: »Die Japaner selbst haben keine klaren Vorstellungen, was die Kami angeht. Sie wissen auf einer tiefen Ebene ihres Bewußtseins intuitiv um die Kami und kommunizieren direkt mit ihnen, ohne sich eine begriffliche oder theologische Vorstellung von ihnen gemacht zu haben. Das ist seiner Natur nach und grundsätzlich vage und daher nicht explizit und klar darzulegen.«
Dazu paßt eine Geschichte, die der Mythologe Joseph Campbell erzählt. Er nahm an einer Konferenz über Religion in Japan teil und hörte während dieser Konferenz, wie ein Sozialphilosoph aus New York zu einem Shinto-Priester sagte: »Wir haben jetzt eine ganze Menge Zeremonien erlebt und etliche Kami-Schreine besucht, aber Ihre Ideologie, Ihre Theologie, verstehe ich immer noch nicht.« Der Japaner hielt wie gedankenversunken inne, wiegte dann bedächtig den Kopf und sagte: »Ich glaube, wir haben keine Ideologie, wir haben keine Theologie – wir tanzen.«
In Japan findet man auf dem Land allenthalben kleine Kami- Schreine, als deren Standorte stets Kraftpunkte ausgewählt werden. Jeder Garten, jedes Haus hat mindestens einen Schrein, der den Kraftpunkt markiert. Solch ein Schrein muß nicht aufwendig sein; ein Seil oder eine Gruppe von Steinen, die ein Stück Boden abgrenzen, können genügen. Es kann auch ein kleines hölzernes Häuschen sein mit einer Öffnung, in die man frische Blumen stellen kann.
Die meisten alten Japaner achten die Kami noch, und zwar unabhängig davon, ob sie Buddhisten oder Christen oder Shintoisten sind oder gar keiner Religion angehören. Sie spüren die Gegenwart der Kami und wissen, daß man mit ihnen kommunizieren muß, um den richtigen Fluß der Energie in ihrer Welt zu erhalten. Selbst beim Bau eines Bankgebäudes wird man vor dem Beginn der Arbeiten die für diesen Anlaß vorgesehenen Zeremonien ausführen, um den Kami dieses Ortes die gebührende Achtung zu erweisen. Im Verlauf der Bauarbeiten folgen weitere Zeremonien, die die Energie und Kraft der Kami auf diese Stelle lenken sollen.
Die vorbuddhistischen Traditionen Tibets kannten Energiewesen, die drala genannt wurden und offenbar den japanischen Kami, den Heiligen Leuten der Navajo und den heidnischen Gottheiten und Feen des mittelalterlichen Europa sehr ähnlich sind. Drala bedeutet wörtlich »über dem Feind«. Trungpa Rinpoche schreibt in einem seiner Bücher dazu: »Drala ist die unbedingte Weisheit und Macht der Welt, die jenseits aller Dualismen ist; Drala steht über jedem Feind oder Konflikt.« In diesem Sinne meint Feind jede Form von Aggression oder Territorialdenken – alles, was unsere Welt in getrennte, einander bekämpfende Parteien aufteilt. Die Drala-Energien schaffen Harmonie zwischen den Teilen unserer Welt und heilen ihre Zersplitterung. Ich werde den Begriff »Drala« häufiger verwenden, weil er für uns neu und daher noch nicht mit Vorstellungen wie »Gottheiten«, »Feen«, »Engel« und so weiter befrachtet ist.
Chögyam Trungpa Rinpoche glaubte, daß die westliche Welt zwar im Laufe der Zeit zu großem Wohlstand gelangt war, daß aber ein Großteil der Vitalität des Landes durch industrielle Produktion, Ausbeutung der Bodenschätze und so weiter verlorengegangen ist. Und deshalb haben sich die Dralas zurückgezogen. Damit diese Vitalität wiederhergestellt und eine ungesunde Situation geheilt werden kann, lehrte er im Westen den Shambhala-Pfad der heiligen Kriegerschaft, der den Menschen ermöglichen sollte, ihre ursprüngliche Herzensweisheit wieder mit der Energie und Kraft der Dralas zu verbinden. Diese Praktiken, sagte er, können Licht und Würde in die stoffliche Welt und unseren Körper zurückbringen, Überzeugungskraft in unsere Rede und schließlich Mut und die Kraft des Herzens in unseren Geist. Er betonte auch, daß wir tatsächlich Kontakt zu den Dralas aufnehmen können, daß sie nicht bloß eine nette, tröstliche Vorstellung sind. Aber zu diesem Kontakt kommt es nur, wenn wir praktisch daran arbeiten und nicht bloß darüber reden.
• In all diesen Lebensformen – im mittelalterlichen Europa, bei den Navajo, in Japan und Tibet – erleben die Menschen ihre Welt offenbar in vielen Dimensionen. Hier der Bereich der materiellen Wirklichkeit, dort die Regionen der Götter, Geister, Ahnen und Engel. Das sind einfach verschiedene Arten, dieselbe Welt wahrzunehmen.
So berichtet Carolly Erickson beispielsweise von einem Manuskript aus dem dreizehnten Jahrhundert, in dem von drei Mönchen erzählt wird, die zusammen den Ort finden wollten, »an dem Himmel und Erde sich vereinigen«. In zutreffenden geographischen Einzelheiten wird berichtet, wie sie den Tigris überqueren, Persien (den heutigen Iran) durchwandern und schließlich die weiten Ebenen Asiens erreichen. Unterwegs begegnet ihnen allerlei Merkwürdiges: ein Volk von kaum zwei Fuß großen Menschen, eine öde Berggegend voller Drachen, ein von Elefanten bevölkertes Gebirge, ein Ort, an dem Sünder furchtbare Qualen zu erdulden haben, und so weiter. Erickson schreibt:
Der Bericht von der Wanderung der Mönche findet sich in einem eigentlich der Geographie gewidmeten Manuskript, das aber etliche Dimensionen der Wirklichkeit zu einer einzigen bruchlosen Landschaft verschmilzt. Es fließt auch eine spirituelle Geographie mit ein …, die einfach als ein Teil der terrestrischen Geographie behandelt wird.
Die vielgestaltige Wirklichkeit als Hintergrund für die Reise der Mönche ist eine Art verzauberte Welt, in der die Grenzen zwischen Imagination und äußerer Tatsachenbeschreibung ständig wechseln. Mal werden die beobachtbaren Grenzen von Raum und Zeit anerkannt, mal werden sie ignoriert oder, anders betrachtet, transzendiert. Die ständige Ausweitung und Einengung des Wahrnehmungsfeldes geschieht jedoch so selbstverständlich, daß mittelalterliche Autoren sie gar nicht bemerken und daher auch keinen Anlaß sehen, Unstimmigkeiten zu bereinigen.
• Auch das Universum der australischen Aborigines hat zwei Seiten: die gewöhnliche physikalische Welt, in der man seinen Alltag lebt, und eine zweite Welt, die Traumzeit genannt wird. Sie sehen aber beide Welten als gleichermaßen real an. Die Götter der Aborigines, die auch ihre Ahnen sind, wandern genau jetzt durch das Land und singen Geschichten. Dieses Land, das sonst leer und tot wäre, wird Augenblick für Augenblick durch das Erzählen und Wiedererzählen der Geschichten zum Leben erweckt. Die Geschichten lassen die Berge und Täler und Felsen und Tümpel entstehen. Die Songlines eines Ahnen, auch Traumpfad genannt, sind der Weg, den er bei der Erschaffung des Landes geht.
Für traditionelle Aborigines ist es wichtig, die Regeln des Träumens zu erlernen und nach ihnen zu leben. Sie werden nach und nach in immer tiefere Schichten der Deutung ihrer Lieder und Geschichten eingeführt. Und je mehr sie lernen, desto mehr vermögen sie dem Land selbst anzusehen. Das Land selbst ist ihr Lehrbuch. In den Geschichten des Landes verbirgt sich alles, was man über die Dimensionen des Daseins wissen muß. Die Geheimnisse des Landes enthalten alles Wissenswerte.
Die Lieder und Traumpfade sind deshalb so wichtig, weil sie die Wirklichkeit nicht nur beschreiben, sondern gleichzeitig die Kräfte sind, die diese Wirklichkeit in Gang halten. Sie sind die kosmischen Rhythmen und Melodien, die der alltäglichen Welt ihre Gestalt geben. Sie sind nicht von Menschen komponiert, denn dann hätten sie nicht die Kraft, die äußere Welt zusammenzuhalten und mit der Traumzeit zu verknüpfen. Die Lieder kommen von den Ahnen. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben und durch Träume ständig erneuert. Wenn ein Aborigine einen Traumpfad geht und das dazugehörige Lied singt, wird er ein Teil jenes Ahnen und damit zum Mitschöpfer des Landes. Ein Navajo würde vielleicht sagen: »Er geht in ho’zho.«
Für viele traditionelle Völker lebt das Land auf diese Weise, zugleich enthält es die Weisheit der Ahnen. Der als Cree-Indianer geborene Autor und Universitätsprofessor Stanley Wilson berichtet von einem Erlebnis, das er während einer Konferenz in Georgia hatte. Er stand auf dem Campus und unterhielt sich mit seiner Frau Peggy auf Cree, als plötzlich ein noch nie erlebtes Hochgefühl über ihn kam, gefolgt von einer furchtbaren Depression. Als er später einen der Ältesten seines Stammes zu diesem Erlebnis befragte, erzählte dieser ihm, das Land bewahre uralte Erinnerungen an die Vorfahren, und diese Erinnerungen seien auch in den Zellen seiner eigenen Knochen gespeichert. Sie seien durch das Betreten dieses Landes wachgerufen worden.
Um diese Geschichte verstehen zu können, mußt Du wissen, daß die Universität, an der die Konferenz stattfand, auf dem »Pfad der Tränen« lag – auf jenem Weg, den die Ureinwohner Amerikas zu Tausenden gehen mußten, als man sie aus ihrer angestammten Heimat in Georgia vertrieb, um sie in Reservaten in Oklahoma wieder anzusiedeln. Unzählige waren auf diesem Weg gestorben. Wilsons Ahnen gaben zuerst ihrer Freude darüber Ausdruck, daß sie jemanden Cree sprechen hörten, und erzählten ihm dann vom Kummer des Landes.
• Welche Bedeutung könnten diese Geschichten für uns haben, Vanessa? Existieren Götter, Engel, Feen, Geister, Heilige Leute, Ahnen, Kami und Dralas wirklich? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Sie existieren wohl nicht als gänzlich eigenständige Wesen. Welche Form sie annehmen, ist eindeutig durch die jeweilige Kultur bestimmt. Aber sie sind auch nicht einfach subjektive Einbildungen, nicht bloß »in unseren Köpfen«. Was ich damit meine, wird hoffentlich im weiteren Verlauf klar werden, wenn wir die Natur der Erfahrung untersuchen und der Frage nachgehen, wie unsere sogenannte reale Welt zustande kommt.
Es wird sich dann zeigen, daß wir dies auch von allem sagen können, was unserer Meinung nach in unserer Welt existiert, von Bäumen, Steinen, Vögeln, unserem Hund Sernyi, von Mama und mir: Nichts davon ist im Grunde von Dir getrennt, und nichts davon ist lediglich Deine subjektive Imagination. Mit Dralas und dergleichen ist das nicht anders. Und weil wir nicht grundsätzlich von ihnen getrennt sind, können wir Kontakt zu ihnen aufnehmen und ihre Energie in unser Leben herüberziehen. Und weil sie nicht einfach »nur in unserem Kopf sind«, können sie uns Kraft geben und uns helfen.
Bei den Völkern, von denen ich Dir in diesem Brief erzählt habe, und darüber hinaus bei den meisten Naturvölkern der Erde, finden wir ein gemeinsames Thema: Die Welt ist lebendig, von lebendiger Energie, Mitgefühl und Bewußtsein durchdrungen. Und alles, was wir in unserer Welt sehen, hören und berühren, hat teil an diesem mitfühlenden, lebendigen Bewußtsein.
Wir können sagen, daß Naturvölker mit der Seele der Welt verbunden sind – und damit ist nicht die Seele als ein besonderes »Ding« gemeint, das wir alle angeblich haben. Der irische Dichter Thomas Moore schreibt, daß die Seele »kein Ding ist, sondern eine Qualität oder Dimension der Erfahrung unserer selbst und des Lebens«. Das ist eine Qualität, die in allem ist, wie der Heilige Wind der Navajo. Ein Pulsieren, eine Schwingung, so wie das Herz bebt, wenn wir etwas Schönes oder Häßliches sehen. Seele meint eine nicht zu benennende Tiefe des Fühlens: mit Herz und Geist allen Dingen zugetan sein und auf sie eingehen. Und darin liegt zugleich eine Sehnsucht, uns mit den Dingen zu vereinigen, die Sehnsucht nach dem teilnehmenden Bewußtsein, das es im Mittelalter gab. So nämlich erkennen wir das Wesen der Dinge, wenn die Seele in uns im Einklang ist mit der Seele der Dinge.
Lebendige, mitfühlende, energiegeladene Bewußtheit – das ist der gemeinsame Nenner aller Überlieferungen, die alle auf ihre je eigene Weise von unsichtbaren, aber erfahrbaren Wesen sprechen. Die Geschichten erzählen auch, wie die Menschen mit den lebendigen Mustern dieser Bewußtheit kommunizieren oder tanzen. Ich bin in diesem Brief besonders auf die mittelalterliche Tradition eingegangen, weil sie uns besonders nahe steht und auch in unserer Zeit gleich unter der Oberfläche der Modernität zu finden ist. Vergessen wir nicht, daß alle diese Wesen, auch die Feen oder Engel des Mittelalters, ganz und gar nicht die netten und harmlosen Gestalten sind, zu denen sie in neuerer Zeit umgedeutet wurden. Sie besaßen (ich sollte wohl sagen besitzen) gewaltige Macht. Wir müssen also nicht unbedingt fremde Länder und Völker besuchen, um die Kraft und Heiligkeit der natürlichen Welt wiederzufinden. Wir müssen nur hier, wo wir sind, unsere Augen, unseren Geist und unser Herz öffnen.