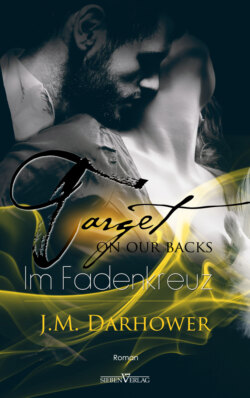Читать книгу Target on our backs - Im Fadenkreuz - J.M. Darhower - Страница 7
Kapitel 1 Karissa
Оглавление„Niemand kann aus seiner Haut.“
Giuseppe Vitale nimmt normalerweise kein Blatt vor den Mund. Er spricht oft in Rätseln, was sein Sohn von ihm geerbt hat. Doch der springende Punkt ist immer unmissverständlich. Er weiß, was er weiß und fühlt, wie er fühlt und letzten Endes zögert er nicht, zu sagen, wie es ist.
Niemand kann aus seiner Haut.
Er spricht von Ignazio.
„Aber er ist anders“, sage ich. Mein Blick schweift zu dem kleinen Holztisch zwischen uns, als würde ich unterbewusst an meinen eigenen Worten zweifeln. Er ist anders, das stimmt, doch das heißt nicht, dass er sich tatsächlich geändert hat.
Kann er sich ändern? Ich weiß es nicht.
Sollte ich mir das überhaupt wünschen?
Es ist über ein Jahr her, dass mich im Eingangsbereich unseres Hauses in Brooklyn eine Kugel traf, doch meine Brust schmerzt immer noch so, als wäre es gestern passiert. Die körperliche Verletzung ist geheilt, aber mein Herz ist eine andere Sache. Ein Teil davon bleibt gebrochen. Wahrscheinlich wird das immer so bleiben.
Vor sechs Wochen hat Naz mich gebeten, ihn zu heiraten. Im Gegensatz zum ersten Mal hat er mich wirklich gefragt. Und als ich dieses Mal ja sagte, wusste ich genau, auf was ich mich einließ. Ich weiß, was für eine Art von Mann er ist. Ich weiß, was er getan hat und was er tun wollte. Wir gaben uns noch am selben Abend im MGM Grand Hotel in Las Vegas das Ja-Wort und seitdem habe ich jede Nacht in der Überzeugung verbracht, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Weil er anders ist.
Das ist er wirklich.
Aber was genau bedeutet anders?
Giuseppe legt seine raue, schwielige Hand auf meine und drückt sie leicht, um meine Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken. Er lächelt, aber es ist kein glückliches Lächeln. Es wirkt eher mitleidig.
Ich kann fast hören, was er denkt.
Armes kleines Mädchen, du weißt nicht, in was du hineingeraten bist.
„Man sagt, wenn man einen Frosch in kochendes Wasser setzt, springt er sofort wieder heraus“, sagt er. „Aber wenn man einen Frosch in kaltes Wasser setzt und die Temperatur stetig erhöht, bleibt er, wo er ist, als ob nichts passiert wäre. Weißt du, worauf ich hinaus will?“
Ich runzele bei diesem abrupten Themenwechsel die Stirn. „Nein.“
„Du bist der Frosch, Mädchen. Und Ignazio? Er kocht dich bei lebendigem Leib, ohne dass du es bemerkst.“
Ich will widersprechen. Ich will ihm sagen, dass er Unrecht hat. Denn so ist es. Er hat Unrecht. Aber das Einzige, was mir dazu einfällt, ist ‚er ist anders‘. Und ich kann nicht erklären, was genau das bedeutet. Er ist immer noch Naz, immer noch derselbe einschüchternde Ignazio, aber Vitale hat sich nicht gezeigt – jedenfalls nicht in meiner Gegenwart.
Ich weiß allerdings, dass Giuseppe nicht zwischen den Masken unterscheiden kann. Er blickt seinen Sohn an und sieht nur das Monster, in das er sich im Laufe der Jahre verwandelt hat. Er sieht nicht den Mann, der er gewesen ist oder den Mann, der er jetzt ist, den Mann, der er versucht zu sein.
Manchmal verschwindet er nachts immer noch. Gelegentlich gibt es noch geflüsterte Telefongespräche. Er ist immer noch paranoid, überfürsorglich und extrem vorsichtig, aber er ist nicht grausam. Er ist nicht arglistig. Ich verstehe ihn. Er versteht mich. Er fasst mich nicht mit Samthandschuhen an, geht mit mir aber auch nicht so um, dass ich es nicht ertragen könnte. Er behandelt mich wie einen Menschen, nicht wie einen Besitz – obwohl seine besitzergreifenden Züge manchmal sehr stark ausgeprägt sind.
Der Mann ist ein Mysterium. Ein schönes, manchmal erschreckendes Puzzle, das ich immer noch Stück für Stück zusammensetze.
Giuseppe interessiert sich jedoch nicht für den Heilungsprozess seines Sohnes. Soweit es ihn betrifft, ist Naz so gebrochen, dass es für ihn keine Rettung gibt.
Bevor ich mir überlegen kann, was ich Giuseppe antworte – abgesehen von ‚aber er ist anders‘, öffnet sich die Tür des Feinkostladens und die Glocke bimmelt laut. Ich muss nicht einmal hinsehen, um zu wissen, dass es er ist. Das liegt an der Art, wie er hereinkommt, wie sich die Luft abzukühlen scheint, während gleichzeitig sein Blick Hitze ausstrahlt. All das sagt mir, dass Naz da ist.
Giuseppe dreht sich nicht um, aber ich weiß, dass er es auch spürt.
„Porcavacca“, murmelt er, seufzt laut, zieht seine Hand von meiner, schiebt seinen Stuhl zurück und steht auf. Sein Blick bleibt auf mein Gesicht gerichtet, das Mitleid wird von Frust verdrängt. „Möchtest du Kekse? Wie wäre es mit ein paar Snickerdoodles?“
Er wartet nicht auf meine Antwort, sondern geht.
Ein paar Sekunden später wird der Stuhl mir gegenüber wieder bewegt und jemand anderes nimmt darauf Platz. Ich sehe zu ihm auf und lächle, als er leise sagt: „Ich fühle mich hier wie eine Hure in der Kirche.“
Naz und sein Vater ähneln sich sehr, aber ich werde mich hüten, ihnen das zu sagen. Diese sturen Männer.
„Warum ausgerechnet hier“, sagt er, hebt die Brauen und starrt mich über den Tisch hinweg an. „Ich hätte auch in letzter Minute einen Tisch im Le Bernardin kriegen können, hätte dich wieder ins Paragone ausführen können. Aber nein, du willst dich mit mir zum Mittagessen bei Vitale’s Italian Delikatessen treffen.“
Ich zucke mit den Schultern. „Das Essen hier ist gut.“
„Da widerspreche ich nicht, aber die Atmosphäre lässt doch zu wünschen übrig.“
Giuseppe kommt zurück und stellt einen Teller mit Keksen vor mir auf den Tisch. Sie sind so frisch, dass ich noch den warmen Zimt riechen kann. „Oh, dich schickt der Himmel“, sage ich, nehme einen Keks und beiße hinein. Köstlich.
Naz verdreht die Augen. Er verdreht die Augen.
Ich glaube nicht, dass ich jemals gesehen habe, dass dieser Mann die Augen verdreht.
„Willst du etwas bestellen?“, fragt Giuseppe ungeduldig und sieht sein einziges Kind finster an. „Oder hast du nur vor, hier eine Weile rumzuhängen?“
„Kommt drauf an“, antwortet Naz.
„Auf was?“
„Darauf, ob du bereit bist, mir etwas zu bringen oder nicht.“
Giuseppe geht grummelnd davon, stapft hinter den Verkaufstresen und schiebt grob die Schwingtüren auf. Er verschwindet in der Küche.
„Heißt das jetzt, dass wir hier essen?“, frage ich.
„Es heißt, dass ich bestelle“, sagt Naz. „Er ist entweder nach hinten gegangen, um Essen für uns zu machen, oder er ruft die Polizei an, weil ich sein Geschäft widerrechtlich betreten habe. Aber so hungrig, wie ich bin, gehe ich dieses Risiko ein.“
Naz steht auf, geht zum Verkaufstresen und bestellt zwei Italian Specials.
Nachdem er bezahlt hat, will er zum Tisch zurückgehen, zögert aber. „Sie haben nicht zufällig eine Zeitung von heute, oder?“, fragt er den jungen Mann, der hinter der Kasse steht. Er ist einer von nur drei Angestellten, die Giuseppe dabei helfen, das Geschäft zu führen. Er neigt dazu, den größten Teil der Arbeit selbst zu erledigen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht Stolz. Wahrscheinlich Dickköpfigkeit.
Bevor der Mann antworten kann, poltert Giuseppe aus der Küche: „Kauf dir deine eigene Zeitung!“
Kopfschüttelnd setzt sich Naz wieder. „Ich denke, dass inzwischen offensichtlich ist, von wem ich meine Arschloch-Gene habe.“
„Er ist kein Arschloch“, sage ich, wobei ich mir weiterhin Kekse in den Mund schaufele. „Und du auch nicht. Ihr seid nur … ein bisschen intensiv.“
„Intensiv“, wiederholt Naz. „So kann man es auch nennen.“
Er ist intensiv. Seine Intensität ist unübertroffen. Seine hellblauen Augen scheinen sich in mich zu brennen, während sein Blick langsam und sorgfältig über mein Gesicht wandert. Er beobachtet mich beim Kekse essen, als würde es ihn heiß machen. Ich spüre wie meine Wangen warm werden, als das Blut hineinschießt. „Warum starrst du mich so an?“
Er beugt sich zu mir. Ein Lächeln spielt um seine Lippen und bringt seine Grübchen zum Vorschein. „Warum nicht?“
Es dauert nur ein paar Minuten, bis unser Essen fertig ist. Giuseppe hat also doch beschlossen, ihn zu bedienen. Sobald das Essen vor mir auf dem Tisch steht, haue ich sofort rein, doch Naz zögert. Er starrt auf sein Sandwich, pflückt es auseinander und inspiziert die Bestandteile mit zusammengekniffenen Augen.
„Um Himmels willen, Ignazio“, schreit Giuseppe und kommt aus der Küche gerannt. „Iss das verdammte Ding einfach!“
Eine Sekunde vergeht. Dann noch eine. Und noch eine.
Ich glaube nicht, dass er es essen wird, aber dann … tut er genau das. Er nimmt es, beißt ein bisschen ab und kaut sorgfältig. Heilige Scheiße.
Ich will keine große Sache daraus machen, dass er im Feinkostladen seines Vaters isst. Bis vor Kurzem hätte er dieses Essen nicht angerührt. Ich will keinen Staub aufwirbeln, indem ich darauf hinweise, dass Giuseppe mehr als einmal gedroht hat, ihn hinauszuwerfen. Ich will nicht triumphieren, kann es aber nicht verhindern. Ich spüre, dass ich zufrieden lächle. Er ist anders. Es ist wirklich so. Es drängt mich ‚habe ich es dir nicht gesagt‘ zu sagen.
„Siehst du“, sage ich fast aufgedreht, während ich Naz beim Essen beobachte „ich wusste, dass ihr beiden …“
Ich habe nicht die Chance, meine selbstgefällige Bemerkung zu beenden. Die Worte ersterben auf meiner Zunge, als ein lauter Knall durch den Feinkostladen dröhnt. Und dann noch einer und noch einer.
Bevor ich reagieren kann, ist Naz auf den Füßen, schnappt den Tisch vor uns und dreht ihn herum. Dann schubst er mich auf den Schachbrettboden dahinter. Ich falle zu Boden. Hart. Ich zucke entsetzt zusammen, spähe um den Tisch herum und beobachte geschockt, wie die Scheibe, die die Hausfront einnimmt, durch einschlagende Kugeln zerbirst.
Kugeln. Verdammte Kugeln. Jemand schießt auf das Geschäft.
Alle lassen sich zu Boden fallen und robben instinktiv weg. Alle bis auf Naz – und seinen Vater. Beide Männer stehen nur da und starren, während das getönte Glas zwischen den Metallstreben springt und splittert, aber nicht nach innen bricht.
Kugelsicher.
Ein paar Sekunden. Länger dauert es nicht. Ein Dutzend Gewehrschüsse in schneller Folge, dann rast draußen ein Auto mit quietschenden Reifen und in aufsteigendem Gummiqualm weg. Durch die zerstörte Scheibe kann ich kaum etwas sehen, aber ich erkenne, dass das Auto schwarz ist, eine schattenhafte Masse Metall, die davonrast, bevor es erwischt werden kann.
Mein Herz hämmert, meine Brust schmerzt von der Kraft seiner Schläge. Keuchend versuche ich, zu Atem zu kommen, doch das ist schwierig. So verdammt schwierig. Nach den Gewehrschüssen senkt sich Totenstille über den Feinkostladen. Wir sind alle wie betäubt. Schließlich dreht Naz den Kopf und sieht zu mir herunter. Ich kauere immer noch auf dem Boden, und er streckt mir die Hand entgegen.
„Ist alles in Ordnung?“, fragt er, obwohl er nicht wirklich beunruhigt zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob dieser Mann gegenüber solchen Dingen einfach abgestumpft ist, oder ob er vielleicht wusste, dass uns nichts passieren konnte.
„Ich, äh …“ Meine Stimme zittert, mein Körper bebt. Ich lasse mich von ihm auf die Füße ziehen. „Ja, ich glaube schon.“
Er mustert mich von Kopf bis Fuß, wobei er weiterhin meine Hand hält. Dann wendet er seine Aufmerksamkeit dem Fenster zu. Die Leute um uns herum stehen wieder auf, einige fliehen vor Angst. Und Giuseppe steht einfach nur schweigend da und starrt vor sich hin.
Er hat einen Schock. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Irgendjemand hat gerade auf den Feinkostladen geschossen. Etwas sagt mir, dass dieser Jemand dafür einem Vitale schwer büßen muss. Im Moment bin ich mir nur nicht sicher, welcher der beiden Männer es sein wird.
„Du“, grollt Giuseppe. Seine Stimme ist so voller Wut wie ich sie seit dem Tag, an dem Naz mich zum ersten Mal hierher brachte, nicht mehr gehört habe. Es ist der Klang von schwelendem Zorn, von Wut und Abscheu. Er dreht den Kopf und sieht seinen Sohn an. Naz wendet sich mit gelassener Miene seinem Vater zu. „Raus hier! Raus, und komm niemals wieder!“
Ich bin zu entsetzt, um etwas anderes zu tun, als dazustehen und zuzusehen. Naz wirkt kein bisschen überrascht. Er sieht seinen Vater ein paar Sekunden an, dreht sich dann zu mir und zieht mich in seine Arme. Er schlingt die Arme um mich, und ich erwidere die Umarmung ganz fest.
„Das nächste Mal“, flüstert er, „bestimme ich, wo wir essen gehen.“
Danach lässt er mich los und ist verschwunden. Es passiert von einem Augenblick zum anderen. Die Türglocke bimmelt, und Naz ist nicht mehr neben mir, bevor ich begreifen kann, was vor sich geht. Ich runzele die Stirn und stürze, immer noch am ganzen Körper zitternd, zur Tür. Es überrascht mich, dass meine Beine mich tragen. Ich ziehe die Tür auf, renne auf den Bürgersteig hinaus und rufe seinen Namen. „Naz? Naz!“
Ich drehe mich suchend im Kreis, doch er ist nicht da. So schnell. Er verschwand aus dem Feinkostladen und hat mich zurückgelassen. Er hat mich einfach … zurückgelassen. Wie ich schon sagte, er ist anders. Der alte Naz hätte das niemals getan.
In der Ferne heulen Sirenen. Sie kommen näher, während ich dastehe und mein Blick zur Hausfront des Feinkostladens schweift. Glassplitter liegen auf dem Bürgersteig verstreut, ebenso ein paar Kugeln, die von Querschlägern stammen. Das Glas hat verhindert, dass sie nach innen gelangten, doch es ist dabei zerbrochen. Es ist ein Chaos.
Menschen rennen die Straße auf und ab, schreien sich etwas zu, die ganze Nachbarschaft ist in heller Aufregung.
Schüsse aus einem Auto am helllichten Tag.
Das ist eins der Dinge, vor denen meine Mutter mich gewarnt hat, Horrorgeschichten von Monstern, die sich in diesen Straßen herumtreiben. Naz hat mir immer gesagt, dass ich niemals Angst haben solle, dass es nichts gebe, vor dem ich mich fürchten müsse, aber jetzt habe ich Angst.
Was zur Hölle ist gerade passiert?
Als die Polizei eintrifft, gehe ich in den Feinkostladen zurück. Giuseppe tut endlich etwas, hilft Menschen wieder auf die Beine und versucht, seine verbliebenen Kunden zu beruhigen. Seine Stimme ist ruhig und besänftigend. Alle Anzeichen von Wut sind zusammen mit seinem Sohn verschwunden.
Ich lehne mich an die Wand neben der Tür, lasse mich zu Boden gleiten und schlinge die Arme um die Knie, während die Polizei auf der Bildfläche erscheint. Ich bin wie betäubt, höre alles, verstehe jedoch nichts. Die ganze Welt ist verschwommen, bis jemand mich ruft.
„Miss Reed?“
Ich blicke auf und sehe ein vertrautes Gesicht auf mich herabstarren. Er steht so dicht bei mir, dass sein Schatten über mich fällt und mich in einen düsteren Kokon einhüllt. Es ist unheilvoll. Detective Jameson.
Das letzte Mal, als ich den Mann gesehen habe, war ich angeschossen worden. Er kam ins Krankenhaus, wo ich mich erholte und wollte die Geschichte aus meiner Sicht hören. Es war, als würde er erwarten, dass ich Naz‘ Aussage widerspreche und ihm sage, dass Naz irgendetwas falsch gemacht habe. Aber das konnte ich nicht. Auch wenn Naz mich vielleicht mehr als einmal in Gefahr gebracht hatte, an dem Tag rettete er mir das Leben. Das sagte auch der Arzt. Der Detective ging mit den Worten, dass seine Tür mir immer offenstände, wenn ich es mir anders überlegen würde. Aber ich zog nicht ein einziges Mal in Erwägung, mich gegen den Mann zu wenden, den ich liebe.
Denn trotz allem was passiert ist, liebe ich ihn wirklich. Ich liebe ihn mehr, als ich es je für möglich gehalten hätte.
Ich räuspere mich und bin überrascht, dass meine Stimme funktioniert. „Vitale.“
Jameson runzelt die Stirn und geht vor mir in die Hocke, als ob meine Worte mehr Sinn ergäben, wenn er mit mir auf einer Höhe ist. „Was?“
Ich strecke die linke Hand aus und zeige ihm den Ring an meinem Finger. „Ich bin nicht mehr Miss Reed.“
Ich sehe an seinem Gesicht, dass der Groschen fällt. Sein kühles Auftreten ist wie weggewischt. Er greift nach meiner Hand und neigt sie etwas, um einen besseren Blick auf den Ring zu bekommen. Er ist einfach, relativ gesehen, jedenfalls so einfach, wie das bei Naz möglich ist. Nur ein goldener Reif verziert mit ein paar kleinen Diamanten. Es war der Ehering seiner Mutter gewesen.
„Sie … Sie haben ihn tatsächlich geheiratet.“ Seine Stimme passt zu seiner Miene. „Wann ist das passiert?“
„Vor ein paar Wochen“, sage ich und ziehe meine Hand weg, weil ich es nicht mag, dass er mich berührt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Naz auch nicht gefallen würde. Es würde ihm nicht einmal passen, dass dieser Typ mit mir redet.
„Also gut, Mrs. Vitale“, sagt er, steht auf und ragt wieder mit seiner gewohnten kühlen Miene über mir auf. „Ich möchte Ihnen ein paar schnelle Fragen stellen, wenn Sie nichts dagegen haben.“
„Sie hat etwas dagegen“, mischt sich jemand ein und drängt sich in den kleinen Abstand zwischen uns. Giuseppe. Er ist einige Zentimeter größer als der Detective. „Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie mir. Sie weiß nichts. Sie war nur zum Essen hier. Eine unbeteiligte Dritte.“
Jameson kneift bei dieser Einmischung die Augen zusammen. „Wenn das so ist, verstehe ich nicht, warum sie mir das nicht einfach sagt.“
„Sie ist schon traumatisiert genug, weil irgendein Schwachkopf auf sie geschossen hat, während sie aß“, sagt Giuseppe und zeigt hinter sich auf den umgeworfenen Tisch und das Essen, das auf dem Boden verstreut liegt. „Das Letzte, was sie braucht, ist ein aufdringlicher, nichtsnutziger Detective, der ihr deswegen im Nacken sitzt, als ob sie etwas falsch gemacht hätte.“
Ich würde weiterhin keinen der beiden Männer als Arschloch bezeichnen, aber ich sehe, woher Naz seine Heftigkeit hat. Whoa. Selbst der Detective stockt einen Moment und denkt über seinen nächsten Zug nach. Bevor Jameson noch etwas sagen kann, ruft ihn jemand draußen vor dem Feinkostladen, und er entschuldigt sich und geht hinaus.
Giuseppe sieht ihm nach, schüttelt den Kopf und wendet sich dann an mich. „Ist alles in Ordnung?“
Ich nicke. „Vielen Dank.“
„Ach, das war doch nichts. Wenn Ignazio auf jemanden sauer wird, weil er gequatscht hat, bin es jetzt ich.“
Ich stehe wieder auf und bin dankbar, dass meine Beine nicht mehr zittern. „Ich weiß nicht, warum dieser Kerl überhaupt hier ist. Er ist Detective im Morddezernat. Es ist doch niemand gestorben, oder?“
Oh Gott, es ist niemand tot, oder etwa doch? Den Leuten im Feinkostladen ist dank der Sicherheitsfenster nichts passiert, aber vielleicht ist Passanten draußen etwas geschehen.
„Nein, es geht allen gut“, sagt Giuseppe und vertreibt damit meine Sorge. „Sie sind vielleicht erschüttert, aber es wurde kein Blut vergossen.“ Er unterbricht sich und sieht sich um. „Zumindest nicht hier drinnen.“
„Warum ist der Detective dann da?“
„Was glaubst du wohl?“ Giuseppe sieht mich an und hebt die Brauen. Seine Stimme klingt ungläubig, also sollte ich die Antwort auf diese Frage kennen. Und so ist es auch. In der Sekunde, in der sich unsere Blicke treffen, macht es Klick. Er ist wegen Naz hier. Deswegen ist er an jeglichem Ort. Es ist ihm egal, ob es in seinen Zuständigkeitsbereich fällt oder nicht. Der Mann befindet sich auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen Naz.
„Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier rumschnüffeln, und es wird nicht das letzte Mal sein, solange Ignazio frei und unbehelligt herumläuft. Sie stellen mir Fragen, und ich beantworte sie wahrheitsgemäß.“
„Und was ist die Wahrheit?“
„Ich habe ihn nicht gesehen und beabsichtige das auch zukünftig nicht.“
Plötzlich kommt mir etwas in den Sinn, was ich vorher nie in Erwägung gezogen habe. Giuseppe hält sich beständig von seinem Sohn fern und Naz glaubt, dass es daran liegt, dass der Mann ihn abgrundtief hasst. Ganz sicher gefällt ihm nicht, in was Naz verwickelt ist, aber vielleicht, wirklich nur vielleicht, hält ein Teil von Giuseppe Naz von sich fern, damit er sich auf Unwissenheit berufen kann. Damit er nicht dafür eingesetzt werden kann, seinen Sohn in irgendeiner Form zu verletzen. Glaubhafte Bestreitbarkeit.
Auf eine gewisse Art ist das selbstlos, denn er opfert jegliche Beziehung zu seinem Sohn, damit dieser sicher ist. Und auch wenn ich Giuseppe nicht so gut kenne, wie ich es gerne hätte, scheint mir das etwas zu sein, was er tun würde.
„Du solltest hier verschwinden“, sagt Giuseppe, ohne mich anzusehen. Sein Blick ist durch die zerbrochene Scheibe seines Ladens nach draußen gerichtet. „Geh durch die Küche zur Hintertür raus, damit sie nicht versuchen, dich aufzuhalten.“
Ich zögere, doch etwas an seinem Ton hält mich davon ab zu widersprechen. Ich glaube nicht, dass Giuseppe in solchen Situationen eher zum Diskutieren bereit ist als Naz. Die Polizisten sind so damit beschäftigt, entlang der Straße Beweismittel zu sammeln, dass sie sich nicht die Mühe machen, den Hintereingang des Feinkostladens zu überwachen. Ich schlüpfe unentdeckt in die Gasse und halte mir die immer noch schmerzende Brust, während ich schnell an den mit Graffiti beschmierten Müllcontainern vorbeilaufe, weg vom Tatort.
An der nächsten Straßenecke steht ein Taxi. Ich winke dem Fahrer und bin froh, dass mir niemand anders zuvorkommt.
„Nach Brooklyn, bitte“, sage ich dem Fahrer und rassle mit angespannter Stimme unsere Adresse herunter. Ich mache es mir bequem, lege den Sicherheitsgurt an und halte den Kopf gesenkt, denn ich habe Angst davor, nach draußen zu blicken, weil es sich fast anfühlt, als würde ich vor der Polizei flüchten. Bitte verfolgt mich nicht. Der Fahrer ist jung, vielleicht Mitte zwanzig. Er lächelt mich im Rückspiegel mit aufblitzenden Zähnen an, als er sich in den Verkehr einfädelt.
Wenn Naz mir eins in unserer gemeinsamen Zeit beigebracht hat, dann auf meine Umgebung zu achten, zu beobachten und zu lernen. Man schnappt mehr auf, als man bewusst lernt. Das hat er mir einige Male gesagt. Mein Blick wandert instinktiv zu dem Führerschein des Fahrers, der an das Armaturenbrett geheftet ist. Abele Abate. Ein unglückseliger Name.
Naz gefällt es nicht, wenn ich Taxi fahre. Er traut anderen nicht zu, dass sie Schaden von mir abhalten. Aber in dieser Situation bin ich der Meinung, dass er nicht das Recht hat, sich zu beklagen.
Während der Fahrt gehen meine Gedanken auf Wanderschaft. Ich frage mich, wohin er verschwunden ist und was er gerade macht. Ein Teil von mir hat Angst davor, es zu erfahren.
Bei dem Verkehr dauert es fast eine Stunde, bis ich zu Hause bin, und die Fahrt kostet sechzig Dollar. Oh Mann. Ich gebe dem Fahrer hundert Dollar und sage ihm, dass der Rest für ihn ist. Das scheint ihn zu überraschen, denn er lächelt mich noch mal an und dankt mir leise. Er hat während der ganzen Fahrt nicht versucht, mit mir zu sprechen. Das weiß ich zu würdigen.
Das Haus ist so still, dass es fast unheimlich ist. Mir gefällt es nicht mehr sonderlich, hier zu sein, besonders nicht allein. In dem Haus werde ich von Erinnerungen verfolgt, von denen einige nicht gut sind … Erinnerungen daran, wie wir uns gestritten haben, wie ich Betäubungsmittel in Naz‘ Essen gemischt habe … Erinnerungen an die Zeit, als er es in Erwägung zog, mir das Leben zu nehmen und ich erkannte, dass ein Monster in ihm schlummert. Wir beide wären in verschiedenen Nächten beinahe im Eingangsbereich gestorben, und obwohl alles vor langer Zeit gereinigt wurde, meine ich manchmal noch Blutspuren zu sehen.
Wir reden über einen Umzug … wir reden ständig darüber … aber aus irgendeinem Grund haben wir den Absprung noch nicht geschafft. Wir sind zu sehr im Alltagsleben gefangen, um eine Entscheidung zu treffen. Zu sehr damit beschäftigt, uns an neue Realitäten zu gewöhnen. Er ist so offen, wie es jemand wie er nur sein kann. Ich bin jetzt seine Frau.
Verrückt.
Ich schließe die Haustür auf, gehe hinein und schließe hinter mir wieder ab. Killer, mein Hund, schläft im Wohnzimmer. Als ich hereinkomme, sieht er erschrocken hoch und kommt dann schwanzwedelnd auf mich zu und will spielen. Ich kraule ihm den Kopf, kratze ihn hinter den Ohren, bin aber zu erschöpft, um heute noch mehr zu machen.
Seufzend streife ich die Schuhe von den Füßen und gehe mit dem Hund auf den Fersen Richtung Arbeitszimmer. Vielleicht mache ich ein Schläfchen auf der Couch, wenn ich es schaffe, abzuschalten und einzuschlafen. Gott weiß, wann Naz nach Hause kommt. Das könnte Stunden dauern, vielleicht sogar Tage.
„Du hast ja nicht lange gebraucht.“
Mir entschlüpft ein Schrei, als ich die unerwartete Stimme höre. Sie erschreckt mich sogar mehr als die Schüsse. Was zum Teufel? Meine Knie knicken ein, und ich wäre fast gestürzt. Panisch suche ich nach dem Ursprung der Stimme. Naz sitzt im Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch, in den Händen eine geöffnete Zeitung, auf die er den Blick gerichtet hält.
„Himmel, Naz, was machst du da?“
„Ich lese die heutige Zeitung.“
„Du liest die Zeitung“, wiederhole ich.
Er liest die verfluchte Zeitung? Wirklich?
„Ja“, sagt er. „Ich habe mir auf dem Heimweg eine gekauft.“
„Du hast dir eine gekauft“, sage ich ungläubig. „Auf dem Heimweg.“
Sein Blick gleitet zu mir, er hebt eine Braue. „Warum wiederholst du alles, was ich sage?“
„Warum ich alles wiederhole, was du sagst?“
Meint er das ernst? Himmel, er meint das tatsächlich ernst.
Ernsthaft?
Naz schüttelt den Kopf, legt die Zeitung vor sich auf den Schreibtisch, lehnt sich im Stuhl zurück und dreht ihn etwas, um mich anzusehen. „Jetzt verstehe ich, warum du es hasst, wenn ich das tue. Das ist ziemlich nervig.“
„Ich …“ Was zum Teufel? „Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Du … was machst du bloß?“
Er runzelt die Stirn, als ob das, was ich sage, keinen Sinn ergibt, und ich bin total verwirrt. Warum ist er hier? Er ist aus dem Feinkostladen verschwunden, sodass ich mir selbst überlassen war und ist direkt nach Hause gefahren, um die verdammte Zeitung zu lesen? Das ergibt keinen Sinn.
„Wie bist du nach Hause gekommen?“, fragt er und mustert mich misstrauisch.
„Ich habe ein Taxi genommen.“
„Ich dachte, ich hätte dir gesagt …“
„Klar“, unterbreche ich ihn, bevor er auch nur anfangen kann, mir eine Gardinenpredigt zu halten, weil ich nicht auf ihn gehört habe, „und wie sonst hätte ich nach Hause kommen sollen?“
„Du hättest den Autoservice rufen können“, sagt er. „Es hätte höchstens zwanzig Minuten gedauert, bis sie bei dir in Hell’s Kitchen gewesen wären.“
„Es wäre erst gar nicht zum Problem geworden, wenn du nicht einfach verschwunden wärst.“
„Er hat mir gesagt, dass ich abhauen soll“, sagt Naz beiläufig, nimmt seine Zeitung und wendet sich wieder von mir ab. „Was hätte ich sonst tun sollen?“
„Äh … mich mitnehmen. Du hättest mich nicht dalassen müssen.“
„Du warst in Sicherheit.“
„Ich war in Sicherheit?“ Ich schnaube. „Woher willst du das wissen?“
„Ich war nicht mehr da.“
Seine Stimme klingt sachlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. „Aber wie willst du wissen …“
Er senkt die Zeitung wieder, dieses Mal mit einem übertrieben genervten Schnaufen, als ob er nicht über dieses Thema sprechen will. Ich sollte ihn wahrscheinlich nicht dazu drängen, aber ich will wissen, was er zu sagen hat. Ich will eine Erklärung. Das verdiene ich.
„Du bist nicht dumm, Karissa, also benimm dich nicht so“, sagt er und starrt mich eindringlich an. „Du weigerst dich weiterhin, das große Ganze zu sehen, obwohl es direkt vor deiner Nase ist. Woher ich weiß, dass die Schüsse mir galten? Sag mir, Süße … wer sonst dort hatte eine Zielscheibe auf dem Rücken? Es gibt nur einen Grund für das, was passiert ist – und der sitzt direkt vor dir.“ Er zeigt auf sich selbst. „Ich wusste also tatsächlich, dass du in Sicherheit warst, weil ich nicht da war. Reicht dir die Antwort?“
Ich will sagen, dass mir das nicht reicht, weiß aber, dass er das nicht akzeptieren wird. Trotzdem kann ich mich nicht zurückhalten. „Es ist nicht deine Schuld, weißt du.“
„Wessen dann? Deine?“
„Warum muss irgendjemand schuld sein?“, frage ich, gehe zu ihm hinüber und hocke mich auf die Kante des Schreibtischs. „Manchmal passieren Dinge einfach.“
„Hör mal, ich weiß zu schätzen, was du versuchst zu tun – aber lass es einfach“, sagt er. „Ich habe vor langer Zeit akzeptiert, dass ich so liegen muss, wie ich mich gebettet habe. Nichts, was ich heute tue oder nicht tue kann das auslöschen, was ich gestern getan habe.“
„Was hast du gestern getan?“
Er wirft mir einen scharfen Blick zu und ich weiß, dass ich aufpassen muss, denn er ist nicht in Stimmung für meine Mätzchen. Er sieht wütend aus. Er sieht fast wie Vitale aus. „Du weißt, was ich meine, Karissa. Die Gegenwart macht die Vergangenheit nicht wieder gut.“
„Ja, ich verstehe“, sage ich. „Nur weil man sich entschuldigt, heißt das nicht automatisch, dass einem verziehen wird.“
„Genau. Und in meinem Fall habe ich mich nicht mal entschuldigt.“
„Tut es dir leid?“
„Nein.“
Ich sollte nicht lachen, weil es nicht lustig ist, tue es aber trotzdem. Ich bin immer so ungehobelt. Naz sieht mich an und nicht das kleinste Lächeln spielt um seine Lippen, doch seine Miene und Haltung entspannen sich ein bisschen.
Wir sitzen eine Weile schweigend da – ich beobachte ihn und er sieht in die Zeitung – bis es mir zu viel wird. „Es ist dennoch nicht deine Schuld.“
Mit einem Stöhnen knallt er die Zeitung auf den Tisch und reibt sich übers Gesicht.
„Karissa …“
„Ich sage doch nur, dass wir für unsere eigenen Handlungen verantwortlich sind. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was andere Menschen tun.“ Er wirkt überhaupt nicht, als würde er mir abnehmen, was ich sage, aber ich fahre trotzdem fort. „Was immer du also gestern getan hast, ist deine Schuld, ja. Aber das, was jemand deswegen heute macht? Das ist deren Schuld, Naz. Niemand wurde je dazu gezwungen, Rache zu nehmen.“
„Wir müssen wohl akzeptieren, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind.“
„Pff, ich habe recht, das weißt du. Vergeltung ist eine Wahl, so einfach ist das. Man beschließt, Rache zu nehmen. Dabei hat man immer die Option, stattdessen Größe zu zeigen.“
Naz starrt mich an, als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm durchdringe oder nicht, aber ich hoffe es. Denn ich will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Vielleicht hoffe ich da bei unserer Lebensweise auf ein Wunder, aber es schadet nicht, darum zu bitten, denke ich.
„Weißt du“, sagt er nach einer Weile und wendet den Blick von mir ab, „du warst viel gefügiger, bevor ich dich geheiratet habe.“
Ich lache erneut – obwohl ich es eigentlich nicht sollte.
„Was auch immer“, sage ich und verdrehe die Augen, als er wieder anfängt zu lesen. Ich sehe ihn neugierig an, während mir meine Worte weiterhin im Kopf herumgehen. Vergeltung. Irgendwie hatte ich geahnt, dass es darum ging, als er so schnell aus dem Feinkostladen verschwand und mich zurückließ. „Wie bist du überhaupt nach Hause gekommen?“
„Gefahren.“
„Wirklich? Dein Auto stand nicht in der Auffahrt.“
„Ich habe es in die Garage gestellt.“
Ich runzele die Stirn. „Hast du auf dem Heimweg irgendwo angehalten?“
Er schüttelt seine Zeitung und liest weiter. Er hat angehalten, um die Zeitung zu kaufen, wie er mir vorhin sagte.
War das alles? „Du warst nirgendwo anders?“
Langsam gleitet sein Blick zu mir, er kneift die Augen etwas zusammen. „Nein.“
Ich lasse das Thema fallen, denn ich weiß, dass ich ihn in Rage bringe. Wir haben jetzt Richtlinien, an die wir uns beide halten: Ich stelle keine Fragen, mit deren Antworten ich nicht umgehen kann, denn er lügt mich nicht an, egal um was es geht. Unwissenheit, sagt er, ist ein echter Segen. Aber wenn ich etwas wissen will, sagt er es mir. Man könnte es einen Vorzug der Ehe nennen. Doch das ist für mich schon zum Bumerang geworden, besonders wenn es um seine Offenheit geht.
Beispielsweise als ich ihn nach Professor Santino fragte und er mir unverblümt sagte, dass der Zeigestock in den Rippen des Mannes abbrach.
Wenn er mir also sagt, dass er kein weiteres Mal angehalten hat, dann beschließe ich, ihm zu glauben.
Wahrscheinlich tue ich das, weil ich fürchte, dass er sich weiterhin für Vergeltung entscheidet.