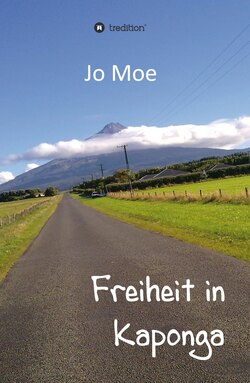Читать книгу Freiheit in Kaponga - Jo Moe - Страница 10
ОглавлениеKapitel 2
Erste (große) Reise - Australien
Bevor ich auf meine eigene Geschichte zu sprechen komme, mag ich bloß kurz darauf hinweisen, dass ich ein paar auserwählte Sätze zur Historie Australiens im Anhang hinterlegt habe. Gern hätte ich auch schon jene Passagen genau hier an jene Stelle eingefügt, aber da mir bewusst ist, dass nicht jeder an geschichtlichen Fakten interessiert ist sowie jene Zeilen meine eigene Geschichte auch zu sehr unterbrechen würden, habe ich diese in den Hintergrund des Buches gepackt. Für all die dann folgenden Länder, von denen ich berichte, handhabe ich es auf dem gleichen Weg. Klar kann jeder solch Informationen selber aus der virtuellen Welt in Windeseile fischen, hingegen mein Gedanke ist dabei, dass es doch noch einfacher und zudem irgendwie auch gemütlicher ist, wenn man dafür mein Buch nicht extra aus der Hand legen muss. Also wer mag, darf gern in die Geschichte Australiens im Anhang hineinschnuppern.
Am 26.1.2001 stieg ich gänzlich eingenommen von purer Aufregung und Flugangst in das Innere einer größeren Boing, auf den Weg gen Melbourne. Zu dem Zeitpunkt hoffte ich, dass die Tablette, die ich kurz zuvor geschluckt hatte, ihr Versprechen halten und mich vor der wahrscheinlich vereinnahmenden Übelkeit beschützen würde. Doch schon der Gedanke daran, insgesamt 24 Stunden in einem Flieger eingeschlossen zu sein, ließ mir ein paar Schweißperlen über meine Nase flitzen. Zum Glück aber wirkte das Medikament und ich konnte zwei Kalendertage später, nach einem kurzen Zwischenstopp in Dubai und ohne irgendwelche Komplikationen, australischen Boden betreten. Ja, dieser Moment war tatsächlich noch aufregender, als dass ich mir dies zu Friedhofszeiten des Öfteren so bunt ausgemalt hatte und so fühlte ich bei meinen ersten Schritten sogar einen leichten Anflug von Schwindel in mir aufsteigen. Nachdem ich dann mit ein wenig zittrigen Händen in einem Hostel in der Altstadt eingecheckt hatte, sehnte ich mich aber zunächst erstmal nur auf eine ausgiebige Dusche. Und wie gut das tat, all den angesammelten Flugangstsenf vom Körper zu schruppen. Nach der Erfrischung spazierte ich durch die Hauptstadt vom Bundesstaat Victoria und war auch in diesen wenigen Momenten recht angetan vom spürbar lässigen Verhalten der Australier.
Melbourne hatte in der Zeit, als die ersten Siedlungen in Australien entstanden, das Glück, dass es nie als Strafkolonie genutzt wurde und deshalb machten sich die damaligen Architekten dieser Stadt mehr Gedanken um wohnlicheres Flair mit zahlreichen angelegten Parks. So genoss ich es, durch die grüne Landschaft zu wandern und entspannte meine Knochen hin und wieder damit, mich in eine der Straßenbahnen1 zu hocken. Auf diesem Weg lernte ich die Stadt sowie ein paar Geschichten kennen, wie beispielsweise die Story eines Aussis älteren Semesters, der mir berichtete, dass Melbourne einst von einem gewissen Herrn Batman gegründet wurde. Ja, genau solche und ähnliche Begegnungen stimmten mich fröhlich, da es so leicht war, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen.
Am zweiten Tag gesellte sich Sebastian, meine Internetbekanntschaft, zu mir und ich war durchaus froh, nicht mehr alleine durch die Straßen spazieren zu müssen. Gemeinsam machten wir uns am nächsten Tag auf den Weg nach Sydney und waren schwer beeindruckt von dieser Stadt sowie seinen entspannten Bewohnern, sodass wir uns schnell einigten, ein paar Tage zu bleiben und stürzten uns öfters am berüchtigten Bondi Beach in die gefährliche Brandung. Anschließend zogen wir weiter über Newcastle und Port Macquarie bis zur Goldcoast. Und auf all diesen Wegen bemerkte ich in immer mehr Situationen, dass dieser Kerl aus der virtuellen Welt eigentlich überhaupt nicht zu mir passt, oder auch ich nicht zu ihm … Er war völlig unentspannt und wollte am liebsten bereits kurz nach der Ankunft an einem beliebigen Ort schon die weitere Route planen. Für mich aber zählte erst einmal das Ankommen selber und dann mal schauen, was sich alles ergibt. Wegen dieser Dishamonie, die uns beiden auf die Nerven ging, entschieden wir uns in Surfers Paradise dazu, getrennte Wege zu gehen und ich hoffte darauf, schnell jemand Passendes für die weitere Reise zu finden. Doch bevor es so weit wäre, würden wir noch gemeinsam ein für mich sehr prägendes Erlebnis erleben. Ja, leider sollte das meine bis dato schlimmste Erfahrung werden und das an einem Ort mit solch einem vielversprechenden Namen. Das traurige Ereignis passierte am späteren Nachmittag am Strand von Surfers Paradise.
Ich liebte es schon immer besonders, am Meer rumzuhängen, wenn sich die Sonne mit nicht mehr allzu großer Macht am Himmel präsentiert und so war es dann auch an diesem Tag. So blieben wir in diesen beschaulichen Momenten noch im Sand hocken, als schon die meisten Menschen das Weite gesucht hatten und beobachteten ein paar Surfer. Selbst die Lifeguards, die ansonsten den Strandabschnitt bewachen, entschieden sich dazu, ihre Sachen einzupacken und sich vom Acker zu machen. Kurz nachdem sie verschwunden waren, wollte ich mich dennoch nochmals in die Fluten stürzen. Sebastian blieb hingegen im Sand hocken und wollte aus dem Grund, weil ja keine Beschützer mehr vor Ort waren, nicht mehr ins Wasser. „Ach, komm schon Junge, was soll schon passieren, du kannst doch schwimmen“, winkte ich ihm während dieser Worte auffordernd zu und rannte ins Meer. Doch bereits nach wenigen Augenblicken — ich war eigentlich gerade erst ins Wasser gesprungen — spürte ich plötzlich, dass sich irgendetwas anders verhielt als sonst. Aber bemerkte erst nach wenigen Sekunden, was tatsächlich passiert war und erschrak, als ich erkannte, dass sich der Strand von mir ungeheuerliche 60 bis 80 Meter entfernt hatte. „Ach du Scheiße, was soll jetzt dieser Mist!“, fluchte ich panisch in die Fluten. Ich bekam Angst und versuchte dummerweise mit all meinen Kräften gegen die starke Strömung zurück zum Ufer zu schwimmen, aber es geschah rein gar nichts. Ich kam einfach keinen Meter vorwärts. Mein Herz pochte dabei so stark, dass ich nicht nur wegen der Anstrengung kaum mehr Luft zum Atmen hatte. In diesen Momenten brüllte ich um Hilfe und blickte in alle Richtungen, ob vielleicht ein Surfer in der Nähe sei und mich retten könnte. In vielleicht 20 Metern Entfernung entdeckte ich einen anderen Treibenden und musste erschreckenderweise feststellen, dass auch er sich quälte, da er ebenso in eine dieser verfluchten Strömungen geraten sein musste. In diesem Augenblick wurde mir glasklar, dass ich ganz auf mich alleine gestellt war.
Mir wurde bewusst, dass ich um mein Leben kämpfen musste, was bedeutete, dass instinktiv mein ganzer Körper einen puren Adrenalinstoß entwickelte, dabei gleichzeitig die Angst ihren Platz räumte und mein Inneres nochmals all seine Kräfte mobilisierte, um an sein äußerstes Limit zu gehen. Ja, ich spürte nahezu jede kleinste Faser meiner Muskulatur, als ich wie ein Maulwurf im Wasser herumwühlte und noch immer nur kleckerweise vorankam. Natürlich hatte ich keine Lust zu ertrinken und nahm selbstverständlich den ungerechten Kampf gegen die Fluten an. Wild brüllte ich um mich, aber das Meer zeigte kein Erbarmen mit mir, dafür jedoch, dass es viel stärker als ich ist und dazu schluckte ich pausenlos das salzige Wasser. Allerdings nach einigen aussichtslos zu erscheinenden Minuten hatte ich mir das Glück erkämpft und trieb nun leicht schräg durch die Wellen, ja irgendwie geriet ich instinktiv auf den richtigen Weg zurück zum Strand. Genau dieses aufblitzende Aha-Erlebnis brauchte ich auch, um weiterhin meinen Kopf über Wasser zu halten und konnte den mich rettenden Sand schon förmlich riechen, bis ich letztlich nach gefühlten unendlichen Minuten des Gefechts sprichwörtlich völlig erschöpft ans rettende Ufer kroch! Und dann … lag ich erstmal einfach nur da. Meine Lunge schnappte beängstigend nach Luft und ich spürte in meinem gesamten Körper einen einzigen großen mich überziehenden Krampf. Aber ich war heilfroh, am Leben zu sein. Wenige Augenblicke später sprintete Sebastian und ein hektischer, sehr besorgt erscheinender junger Asiate auf mich zu und beide zeigten auf den anderen Lebensmüden, der noch immer mit den Wellen rang.
Mit letzten Kräften stellte ich mich an ihre Seite und erkannte schließlich auch den Kopf, der noch immer zu weit vom Strand entfernt war und wusste, dass der Asiate den Kampf gegen die Strömung nicht gewinnen würde, wenn nicht ganz bald Hilfe käme. „Die Liveguards sind schon auf dem Weg“, sagte Sebastian. Irgendwann, ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren, waren sie endlich da, hechteten sich auf ihre Surfbretter und schossen zu dem in diesem Zeitpunkt für mich kaum mehr zu erkennenden Menschen. Es wirkte planlos, wie die Retter umhertrieben und nach dem Kerl suchten, bis ein Helikopter eine hoffnungsvolle Unterstützung leistete. Zeitgleich wurde am Strand und um uns herum der Andrang an gaffenden Menschen stets größer und sogar ein TV-Team glotzte durch die großen Kameras, aber viel schlimmer verhielt sich die Tatsache, dass der junge Asiate nicht mehr zu sehen war … Die Suche erwies sich leider als umsonst und der junge Mensch blieb spurlos in den Tiefen des Meeres verschwunden. Schnell hatte sich der Menschenschwulst wieder gelöst und der Hubschrauber das Weite gesucht, doch ich hockte noch immer am selben Fleck und hatte Bauchschmerzen, was nicht vom viel zu viel geschluckten Wasser herrührte. Ich hatte überlebt, aber ein anderer hatte nicht so viel Glück. Ja, es hätte auch mich treffen können …
Zwei Tage später wachte ich nicht nur wegen der Hitze schweißgebadet von dem nun schon zum zweiten Mal erlebten und unseligerweise wahren Albtraum, auf. Wo bin ich?, dachte ich mit echter Furcht. Und jedes Mal dauerte es ein paar Augenblicke, bis ich erleichtert erkannte, dass ich nicht mehr gefangen in der Strömung, sondern alleine in einem trockenen Bett in einer winzigen Kammer bei einer Familie auf einer Farm lag. Das Zimmer war aber so klein und zudem vollgepackt mit staubigen Büchern, dass ich tatsächlich nach Luft schnappen musste.
Einen Tag zuvor hatte ich mich weg vom Wasser und von Surfers Paradise bewegt, auf der neuen Spur hinein in den Dschungel und zu meiner ersten WWOOF-Farm, wo ich am Tag um die vier bis fünf Stunden zu arbeiten hatte und dafür freie Kost sowie Logis bekam. Damals hieß die Abkürzung WWOOF ausgesprochen noch „Willing Workers on Organic Farms“, aber diese Bezeichnung wurde etwas später in „World-Wide Opportunities on Organic Farms” umbenannt. Die Idee dahinter ist und bleibt jedoch die gleiche: man bringt Menschen zusammen, welchen es auf einer Farm ermöglicht wird, einen naturverbundenen Lebensstil kennenzulernen. Natürlich empfand ich diesen Einfall auch damals schon als sehr interessant, allerdings möchte ich dabei nicht leugnen, dass ich mit dem Programm nicht nur einen tieferen Einblick in das Leben der Menschen in Australien bekommen wollte, sondern mit dieser Art des Reisens etwas Geld sparen konnte.
Die Farm befand sich mitten im Wald, circa 50 Kilometer entfernt von Surfers Paradise, umschlossen von riesigen Eukalyptusbäumen und völlig abgeschieden von nervigen, über den Zaun blickenden Nachbarn. Die Arbeit, die ich dort zu verrichten hatte, bestand größtenteils daraus, das gesamte Grundstück zu „säubern“, wie Bäume zu beschneiden und verrottete Sträucher aus dem Grund zu rupfen, was aber bei dieser extremen Hitze nicht unbedingt eine leichte Aufgabe und überhaupt nicht mit der Arbeit auf dem Friedhof zu vergleichen war. So freute ich mich schon zu Beginn der Tätigkeit auf den feierabendlichen Sprung in den Pool, wobei der Schweiß schnell vom Körper glitt, aber meinen Durst zu stillen, war hingegen ein größeres Unterfangen, da es sich bei dem Wasser, was ich erhielt, um ein ungewöhnlich stinkendes, gefiltertes Regenwasser handelte. Ja, diese Plörre war tatsächlich das einzige Wasser, das es dort gab — so schwitzte ich mehr, als ich trank und wurde zum Glück darüber nicht noch krank. Das Getränk stank nicht nur widerlich, sondern schmeckte zudem fürchterlich und dennoch gab ich mich gedanklich damit zufrieden, weil es immer noch besser war, als Salzwasser zu schlucken. Ich war einfach froh, am Leben zu sein und nahm mir deshalb fest vor, mich nicht mehr mit solchen belanglosen Dingen zu beschäftigen. Ja, dieses traurige Erlebnis, so paradox es vielleicht klingen mag, stimmte mich weitaus friedlicher. Bis mich an einem sehr heißen Vormittag, als ich mit beiden Händen im Gestrüpp herumwühlte, doch tatsächlich eine Spinne in den Arm biss. Schnell ließ ich alles liegen, rannte sofort zum Haus und betete vor mir her: Na hoffentlich war das keine giftige Spinne …
„Mich hat eine Spinne gebissen!“, raunte ich in Richtung Haustür. Wenige Augenblicke später versammelte sich die halbe Familie um mich herum. Natürlich mussten sie mich zunächst beruhigen und schauten während der vielen auf mich niederprasselnden Worte völlig entspannt auf meinen Arm, welchen sie fürsorglich musterten, inwieweit der Spinnenbiss welche Reaktion zeigen würde. Und jene Ruhe der Aussiefamilie übertrug sich zum Glück auf mich und nach vielleicht zwei vergangenen Minuten entschieden sie einstimmig, dass der Biss wohl harmlos sei. Meine Furcht verflog und zudem drückte mir die Hausdame ein äußerst wässriges Wassereis in die Hand. Wahnsinn, schon der zweite Schocker hier in Australien … was soll mir das bloß sagen?
Nach einer halben Stunde durfte ich meine Handschuhe wieder überstreifen und wurde mit dem Spruch „Take it easy“ zurück zum Gebüsch beordert. An dieser Stelle verdrückte ich mir aber das vielleicht zu diesem Zeitpunkt normal einsetzend aufgesetzte Grinsen, glotze dafür etwas komisch und stolperte schließlich übervorsichtig zurück ins Gestrüpp. Zum Glück hatte mich jedoch jener Schreck um den Spinnenbiss herum trotzdem davon abgehalten, dem Abenteuer auf der Farm vorzeitig zu entfliehen, denn es handelte sich insgesamt um sehr interessante Tage mit vielen lehrreichen Erfahrungen. Gerade die haarsträubende Begegnung mit dem Getier empfand ich im Nachhinein sogar als Gewinn, da ich ab diesem Zeitpunkt mit noch wachsameren Augen durch Australien pilgerte und jeden Morgen, bevor ich in meine Schuhe schlüpfte, den Tipp der Aussiefamilie nun auch ernst nahm und meine Schlumpen auf Spinnen untersuchte.
Ja, die zehn Tage in „Gefangenschaft“ im Eukalyptuswald vergingen trotz der wenigen freizeitlichen Abwechslung recht schnell. Nachdem ich auch das Farmabenteuer überlebt hatte, hockte ich mich in einen Bus und machte mich auf den Weg nach Brisbane. Auf dieser Strecke zurück in die Zivilisation erblickte ich zum ersten Mal eine ganze Kängurufamilie an der Straße entlanghoppeln. „Juhu, ich bin wirklich in Australien!“ Aber die kurze Freude über die Tierfamilie hielt leider nur ein paar Augenblicke, denn schon wenige Wimpernschläge später übermannte mich abermals das sehr unangenehme Gefühl des Alleinseins und blitzartig schossen sogar Gedanken in mein Hirn, vielleicht doch schon verfrüht zurück nach Deutschland zu fliegen. Diese Grübeleien überkamen mich ab und an und dennoch war ich froh, weil der Bus in Brisbane und nicht in Frankfurt hielt. Schnell schnappte ich mir meinen Rucksack und war gerade dabei, mich auf die Suche nach einem Hostel zu begeben, als der Busfahrer mir noch Folgendes mit auf den Weg gab: „Zur Orientierung in Brisbane dienen im Stadtkern Frauensowie Männernamen. Die Straßen mit Männernamen verlaufen von Nord nach Süd, und von West nach Ost das sind die Wege mit Frauennamen.“
Mit diesen Worten verabschiedete sich der Fahrer von mir und ich begab mich entlang der Männer-Straßennamen zu irgendeinem Hostel. Es dauerte eine Weile, bis ich dann eine Unterkunft gefunden hatte und mich sofort nach dem Check-In völlig überhitzt sowie mit glühend rotem Kopf auf mein Bett in ein Viermannzimmer schmiss. Zu diesem Augenblick war es zwar erst früh am Abend, jedoch hoffte ich darauf, vor den drei anderen Menschen einzuschlafen, welche ganz offensichtlich durch den vielen herumliegenden Müll ins Zimmer stürzen würden.
Noch war ich alleine, aber ich fand trotz der Stille im Zimmer einfach keine Ruhe, da mich zu viele Gedanken ärgerten, die mich natürlich vom Schlafen abhielten. Wegen dieser Unruhe in meinem Körper lag ich Stunden später immer noch wach herum und glotzte zum Gitterrahmen an das Doppelstockbett über meinem Kopf. Bis schließlich die Ruhe in der Kammer zusätzlich durch meine Mitbewohner gestört wurde, die in unregelmäßigen Abständen in den kahlen Raum reinplatzten, worauf ich erst recht krampfhaft versuchte, meine Augen zu schließen. Irgendwann waren sie dann alle da, lagen irgendwann in ihren Betten und irgendwann hatte dann endlich auch der Letzte das Licht ausgeknipst. Aber ehe das passierte, begann bereits der Erste, kurz darauf der Zweite und natürlich zu all dem Übel noch irgendwann der Dritte mit dem gruseligen Geräusch des Schnarchens. Wie soll ich hier denn pennen? Das kann doch echt nicht wahr sein! Die Nacht hätte ich mir wirklich sparen können, denn es gab keinen einzigen Moment, an dem nicht irgendeiner von den drei Schnarchnasen mal keine Geräusche von sich gelassen hatte. Doch nach einem weniger schönen Augenblick folgt ja meist wieder ein positiver und so strahlte ich über beide Ohren, als ich am nächsten Tag eine E-Mail von meinem einzigen Cousin in meinem Posteingang entdeckte. Robert studierte zu dieser Zeit an einer Universität in Brisbane, teilte sich mit seiner Freundin für diesen Zeitraum eine kleine Wohnung in der Stadt und freute sich schon auf meinen Besuch. Sobald ich seine Zeilen gelesen hatte, ging es mir von ein auf den anderen Moment schon viel besser und das beklemmende Gefühl des Alleinseins hatte sich in diesem Augenblick von mir verabschiedet.
So machte ich mich fröhlich auf den Weg in die sonnige Stadt, hockte mich bis zum Abend an den Brisbane River und beobachtete den Umgang der Menschen untereinander. Als ich dann wieder zurück ins Hostel kam, waren sie plötzlich auf einmal alle da — die netten Leute, die ich um mich herum vermisst hatte. Ja, sie waren bereits in meiner Nähe in eben jenem Schnarchkonzert Hostel. Und die meisten von denen reisten auch alleine durch Australien und suchten wie ich nette Begegnungen, deshalb schlossen wir uns zu einer Gruppe zusammen, spielten Fußball, schmissen uns Frisbeescheiben vor die Köpfe oder tanzten gemeinsam auf ein paar Partys. Auf diesem Weg zogen plötzlich die Tage in einer rasenden Geschwindigkeit an mir vorbei und das mich kurz zuvor so bedrückende Gefühl des Alleinseins hatte sich komplett verflüchtigt. Aber unglücklicherweise verschwanden in einem ähnlich erschreckenden Tempo die Moneten aus meinem Geldbeutel und somit war der Zeitpunkt für mich in mehrfacher Hinsicht einfach perfekt, um ein paar Tage bei meinem Cousin unterkommen zu dürfen. Robert nahm mich damals mit zu seiner Uni, wir gingen schwimmen, kochten und hatten einfach eine tolle Zeit zusammen. Für meinen letzten Abend und quasi als Abschiedsgeschenk organisierte mein Cousin einen Grillabend bei sich im Garten und lud dazu ein paar Nachbarn sowie Freunde ein. Es floss reichlich australisches Bier in meinen Körper und dazu gesellten sich auch einige Stücke von totem Känguru in meinen Magen. Ja, irgendwie schien sich beides nicht so richtig miteinander zu vertragen, denn in der kommenden Nacht ging es mir sehr schlecht. Selten lag ich im Bett, stattdessen hüpfte ich öfters vernebelt zum Bad und kniete vor der Toilette …
Am nächsten Morgen schlich ich aus diesem Grund mit gesenktem Kopf und bei brütender Hitze zum Bus. Ich wäre aber am liebsten einfach im Bett geblieben, doch hatte ich bereits einer freundlichen Stimme am Telefon versprochen, an genau diesem Tag bei ihr zu erscheinen. Darum quälte ich mich, immer wieder stützend, entlang etlicher Hauswände, zur Bushaltestelle und erreichte kreidebleich im letzten Moment den wartenden Greyhound Bus. Die Fahrt in die nur 130 Kilometer entfernte Stadt namens Noosa dauerte zum Glück nur drei Stunden, was mein Magen gerade noch so verkraften konnte. An der dortigen Haltestelle empfing mich eine ältere Dame und drängte mich euphorisch in ihren uralten Jeep. Danach ging es raus aus Noosa, über sandige Schotterpisten und in die absolute Einsamkeit. Als wir schließlich die Farm der Frau erreicht hatten, gesellte sich zu meiner unangenehmen körperlichen Verfassung noch ein fast ebenbürtiges ungutes psychisches Gefühl. Irgendwie mochte ich diesen einsamen Ort von Anfang an nicht besonders und wusste schon bei der Ankunft, dass ich wahrscheinlich nicht viel Zeit auf dem derartigen Grund und Boden verbringen wollen würde. Die Hütte der Dame mitten im „Märchenwald“ erinnerte mich sofort an das Hexenhaus bei Hänsel und Gretel, doch die zwei Geschwister waren nicht da und so fragte ich mich, welche Versuchung an diesem Platz wohl lauern würde …
Ich schwitzte und fühlte mich noch immer kreidebleich, aber die ältere Dame zeigte keinerlei Empathie, sondern zog mich in ihr Haus und wollte mir meine zukünftige Kammer präsentieren. Zunächst spazierten wir durch den Flur und erreichten in einer Ecke, nach nur wenigen Schritten, mein Zimmer. In dem Moment, als die Frau die Tür öffnete, war ich nicht mehr in der Lage, mir mein bitteres Lachen zu verkneifen. Ich sollte doch tatsächlich in einer Besenkammer übernachten. An der Stelle des Besens hingegen lag auf dem Fußboden bloß eine alte, ranzige Matratze … ja, mehr gab es in dieser Kammer tatsächlich nicht. Oder etwa doch? Ja, aber noch war die Zeit nicht gekommen, mich in meinem Kabuff zu verkriechen sowie der Sache gründlicher auf die Spur zu kommen. Nein, vorher sollte ich der älteren Dame noch Gesellschaft leisten und so stellte sie mir zwischen den vielen Fragen nebenbei auch mein Abendbrot zusammen, welches sich aus einem Brot mit Erdnussbuttercreme und einer Mandarine zusammensetzte. Mehr gab es tatsächlich nicht, doch da mir beständig etwas flau im Magen war und mir der Gedanke von Hänsel und Gretel stets im Kopf herumschwirrte, empfand ich das wenige Essen genau passend zu sein. Mir war somit klar, dass sie mich schon mal nicht mästen wollte. Danach verabschiedete ich mich in die Nacht, stiefelte in meine Besenkammer und bevor ich mich auf die Matratze schmiss, schüttelte ich ein paar Mal allen Staub aus der Decke. Anschließend hockte ich mich eher behäbig auf die Matratze, starrte in die triste Räumlichkeit und fühlte mich wieder allein …
Aber ganz alleine war ich dann gar nicht, denn meine Mitbewohner hießen nämlich Spinne, Kakerlake und Co. Und in diesem Augenblick, als ich diese Tiere, vor denen ich mich wirklich ekel, entdeckte, fühlte ich mich erst recht k.o. und war auch nicht mehr in der Lage dazu, irgendetwas zu unternehmen, um der einzige Bewohner der Besenkammer zu werden. Um sieben Uhr in der Früh klopfte mich die Hausdame aus meinen komischen Träumen. Bin ja mal gespannt, was es zum Frühstück gibt.
Als ich mich dann vor dem Frühstückstisch wiederfand, entdeckte ich zwei Toastbrote mit Honig, die für mich reserviert waren. Das Festmahl dauerte vielleicht drei Minuten, machte mich natürlich alles andere als satt und so glotzte ich etwas krumm, als mir die verschlafene Dame im karierten Nachthemd ein großes Küchenmesser und nicht etwa das dritte Toast in die Hand drückte. Im Anschluss folgte ich ihr entlang eines schmalen Weges durchs Gebüsch bis zur Plantage. Ok, das ist also mein neuer Arbeitsplatz.
Meine Aufgabe war es dort, mich zwischen Mandarinenbäumen auf die Knie zu hocken und diese mit dem Messer vom Unkraut zu befreien. Ich tat, wie mir geheißen und schwitzte bei jeder noch so winzigen Bewegung. Knapp drei Stunden später stand die Chefin erneut vor mir, schickte mich in die Pause und ich durfte eine saftige Mandarine zerbeißen sowie etwas Flüssigkeit schlucken und sollte mich anschließend nochmals unter die Mandarinenbäume gesellen. Zwei Stunden später wurde ich endlich in den verdienten Feierabend entlassen. Ganze drei Tage verbrachte ich nach diesem Muster — kriechend unter Zweigen in der Einsamkeit und zwischen den Bäumen im dichten Dschungel. Klar, dass ich nach diesen Stunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, da sie einfach nicht vergehen wollten, damit liebäugelte, wieder zurück in die Zivilisation zu fahren. Als ich später zurück in Noosa war, belohnte ich mich sofort bei der Ankunft in einem kleinen Reisebüro mit der Buchung eines zweitägigen Trips und freute mich riesig auf Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt. Nur einen Tag später konnte es losgehen und meine Reisegruppe bestand aus zehn Abenteuerlustigen, drei Fahrern und drei Jeeps. Und da auf der Insel keinerlei Straßen gebaut wurden, pfefferten wir direkt am Strand entlang, vorbei an zahlreich aufgescheuchten Dingos, türkisfarbenen Lagunen, Mangrovensümpfen und großen Eidechsen, die aussahen, als kämen sie von einem anderen Planeten. Hin und wieder durften wir auch zu Fuß die Gegend erkunden und uns die von den Gezeiten geformten, farblich sehr schönen Sandfelsen an der Küste sowie alte Schiffswracks, welche rostend am Strand lagen, ansehen. Der Ausflug war eine wirklich schöne Abwechslung und verschaffte mir neue Energie. Nach der Tour brachte mich abermals ein Greyhound Bus zurück nach Brisbane und zu meinem Cousin. Zwei Tage blieb ich bei Robert, machte mich anschließend nochmal für eine Nacht in ein Hostel und verabredete mich per Telefon für den darauffolgenden Tag mit einer verwirrt klingenden Frau. Die Frage danach, was denn meine Aufgaben bei ihr wären, beantwortete sie beiläufig einfach so: „Ach, es ist nicht viel zu machen, ich brauche einfach nur eine kleine Unterstützung im Haus.“
Die Adresse hatte ich, wie die anderen auch, in einem WWOOFing-Buch, wo sich all die Farmen sowie Haushalte et cetera vorstellten und sich für die Suchenden als Gastgeber anbieten, gefunden. So machte ich mich auf den Weg zu meiner dritten WWOOF-Stelle, in einen Vorort von Brisbane und als ich dort ankam sowie ein paar Mal an die Haustür geklopft hatte, öffnete sie mir schließlich besagte Frau. Sie reichte mir, und ohne mir dabei in die Augen zu schauen, ihre lasche, schwitzige Hand und winkte mich in ihre Wohnung, bereitete mir eine warme Apfelsaftschorle zu und sagte in einem unfreundlichen Ton: „Du brauchst es dir erst gar nicht gemütlich machen, denn ich brauch schon gleich mal deine Hilfe.“ Dabei richtete sie beide Hände zum Küchenfenster und verkündete mir, dass ich den Fensterrahmen aus den Angeln nehmen und diesen dann in den Keller bringen solle, um ihn folgend abzuschleifen und zu guter Letzt neu zu bestreichen.
Nur ‘ne Kleinigkeit, schon klar … dachte ich, machte mich jedoch sofort an die Arbeit, rupfte irgendwie den blöden Fensterrahmen aus der Wand und verschwand für die nächsten Stunden im dunklen Keller. Sowie ich dann verdattert und schlecht gelaunt im Keller stand und den blöden Rahmen bestrich, fasste ich meine farblosen Gedanken zusammen und erfreute mich an der Vorstellung, am nächsten Tag wieder die Biege zu machen. Die Alte kann mich mal. Denkt wohl, ich bin ihr dummer Sklave oder was!
Als ich schließlich endlich fertig war, stolperte ich mit einem komischen Gefühl die Stufen zurück in den Wohnraum, wo sie am Herd in der Küche stand, in eine hässliche, graue Schürze gewickelt, und sich nicht etwa für meine Arbeit bedankte, sondern mir stattdessen ihre ganze Unaufmerksamkeit schenkte. Wahnsinn, die hat se doch nicht mehr alle!
Ihr Blick war dabei tief in den Topf gerichtet und es dauerte noch ein bisschen, bis sie mir zurief, dass ich doch am Wohnzimmertisch Platz nehmen solle. Danach stampfte ich mit extra lauten Schritten ins Wohnzimmer und erschrak beinah, als ich einen dicken Mann entdeckte, der bereits breitbeinig am Esstisch fläzte und vor Schweiß nur so triefte. Etwas zaghaft brachte ich ein „Hello“ aus mir heraus und stellte mich kurz bei ihm vor. Doch was macht dieser Fettsack? Ja, der blieb natürlich in seiner gespreizten Position, brabbelte irgendwas in seinen schmierigen rothaarigen Bart, schaute dabei apathisch an die eintönige Wand und kippte sich in diesem Augenblick einen großen Schluck Bier in den Wanst. Na dann, prost Mahlzeit! In was für einem Irrenhaus bin ich denn hier gelandet?
Aber es blieb mir nichts anderes übrig, als mich neben diesen fetten Sack an den Tisch zu hocken und mich mit ihm im Schweigen zu battlen, bis die Krähe mit einem ungenießbaren Eintopf an den Tisch kroch und für einen Moment die bedrückende Stille durchbrach. Danach fraßen sowie schwiegen wir zu dritt und ich beschwor den Zeitgott, dass er schnell die Morgendämmerung heraufbeschwören möge. Noch nie zuvor hatte ich in solch einem Tempo so eine ekelerregende, heiße Suppe in mich hineingeprügelt und verabschiedete mich bereits vor dem letzten Löffel in die Nacht. „Ich bin müde und brauche Schlaf.“
„Gut, dann mach dich ins Bett. Morgen früh um acht Uhr gibt es Frühstück.“ Ja ja, das glaubst du doch selber nicht, dass ich mich morgen mit euch noch einmal an den Tisch setzen werde und rannte mit dem Gedanken auf mein Zimmer. Dummerweise steckte in meiner Zimmertür kein Schlüssel und so kramte ich etliches, was ich im Raum fand, auf einen Stuhl und stellte ihn behutsam vor die Tür. So baute ich mit Absicht eine sehr wackelige Konstruktion aus Büchern und einer Trinkflasche zurecht, im Glauben, dass ich sofort wach werden würde, falls einer dieser Störche auf die dumme Idee käme, mich in meinem Zimmer besuchen zu wollen. Doch all der Aufwand wäre überhaupt nicht nötig gewesen, denn jene Nacht fühlte ich mich einfach viel zu aufgeregt, als dass ich auch nur ein Auge hätte zumachen können. Frühs um sieben Uhr am nächsten Morgen stand ich auf, packte meine Sachen zusammen und wollte mich einfach davonschleichen. Die Krähe war jedoch bereits munter, krächzte mir nach und rief völlig verzweifelt: „Du fauler, dummer Junge!“ Kaum hatte sie ihr Gebrüll beendet, drehte ich mich nochmal um, richtete dabei den Blick zur Tür, streckte ihr den längsten Finger meiner rechten Hand entgegen und fühlte mich freier als je zuvor.
Zurück in Brisbane graste ich ein paar Hostels ab und quartierte mich letztendlich in ein Sechsbettzimmer ein. Die Nächte nervten, da ich es jedes Mal mit rücksichtslosen Menschen zu tun hatte, die einfach das Licht brennen ließen oder sich lautstark mitten in der Nacht im Zimmer auf RTL2 ähnlichem Niveau unterhielten. Dennoch verbrachte ich in diesem Hause wieder ein paar tolle Tage mit einigen interessanten jungen Menschen wie einem Iren, der mir Zaubertricks zeigte, einem Argentinier, der fleißig an der Gitarre zupfte und wieder anderen, welche von fast allen Kontinenten dieses Planeten kamen und von ihren spannenden Abenteuern erzählten.
Trotz der vielen netten Bekanntschaften und dem wohligen Gefühl, nicht alleine sein zu müssen, wollte ich nach wenigen Tagen wieder weiterziehen. Gerne hätte ich meinen Weg in den Norden fortgesetzt, aber hatte dummerweise bei der Flugbuchung nicht daran gedacht, einen anderen Abflugort zu wählen und somit war klar, dass ich wieder zurück nach Melbourne musste. Also war für mich die Zeit gekommen, wieder umzukehren, mir auf dem Rückweg noch ein paar Orte anzusehen, die ich noch nicht besucht hatte und entschied ich mich zunächst in den circa 200 Kilometer entfernten Surferort Byron Bay zu fahren. Ja, ich wollte nun endlich und unbedingt bei einem Surfkurs das Wellenreiten erlernen.
Nachdem ich das erste Mal auf einem wackligen Brett gestanden hatte und mir ein ziemlich abgespacter Surflehrer das Surfen beigebracht hatte, wusste ich, dass das nicht das letzte Mal für mich gewesen sein sollte. Aber nicht bloß diese Ausbilder waren verrückt, sondern beinah jeder, dem ich in diesem Örtchen begegnete, schien auf irgendeine Art irr zu sein, so auch ein Israeli, dem ich im Hostel begegnete und der mich fragte, ob ich mit ihm gemeinsam in seinem Schlitten nach Sydney fahren wolle. Dennoch kam der Typ wie gerufen, denn ich musste ja schließlich in dieselbe Richtung und der Gedanke, einmal nicht mit dem Bus durch die Landschaft fahren zu müssen, ließ mich zusätzlich grinsen. Also sagte ich ihm spontan zu und schon am darauffolgenden Tag stieg ich in seinen alten, verrosteten Wagen. Die Karre war nicht nur fast komplett durchgerostet, sondern schlimmer noch war die Tatsache, dass der Auspuff kaputt war und der gesamte Gestank ins Fahrzeug geblasen wurde. Trotzdem war die Zeit mit dem Kerl aus Israel, das „an-der-Küste-Entlangcruisen“, das „im-Zelt-an-abgelegenen-aufregenden-Orten-Übernachten“ und das „faule-Koalas-Beobachten“ einfach großartig sowie abenteuerlich und das Gefühl absoluter Freiheit wuchs dabei von Tag zu Tag mehr.
Wir verbrachten eine ganze Woche zusammen, bis wir am Bondi Beach wieder getrennte Wege gingen und ich genau in diesem Moment das erste Mal die Emotion verspürte, alleine sein zu können. Etwas mehr als zwei Monate nach meiner Ankunft in Australien waren inzwischen vergangen und das erst kürzlich aufgekommene Gefühl bereitete mir tatsächlich neue Räume für ganz andere Eindrücke. Plötzlich nahm ich meine Umwelt anders wahr und war nicht mehr auf der ständigen Suche nach Reisebegleitungen und Unternehmungen mit anderen Menschen. Ich begann es zu genießen, mich alleine auf eine Parkbank zu setzen, das Treiben der Leute zu beobachten und erlebte nicht nur deshalb Australien aus anderen neuen Blickwinkeln. Dadurch, dass ich bewusster umherblickte, bemerkte ich nicht nur die positiven Dinge, also wie cool und lässig die meisten Australier doch waren, sondern entdeckte auch die unschöneren Flecken, wie jene arme, missbilligenden Zustände, an welchem die meist obdachlosen Aborigines hausen mussten.
Mir fiel auf, dass diese nicht allzu viel Anschluss am „normalen“ gesellschaftlichen Leben der Australier hatten und dass sie ausgeschlossen, verachtet und so gut wie auf keinerlei Ebene integriert werden. Mir wurde erzählt, dass sie wenigstens Sozialhilfeleistungen erhalten, wobei sie aber das Geld meist dafür nutzen, um sich mit Alkohol oder anderen Mitteln zu betäuben und dadurch ihre wirklich schlimme Situation weit von sich weg zu schieben.
Der Anblick jener Menschen, welche eigentlich nur verwahrlost in irgendwelchen Ecken herumsaßen, stimmte mich stets traurig und mein Bild von Australien änderte sich dadurch. Mir wurde bewusst, dass vieles in diesem Land gar nicht so toll ist, wie ich es mir selbst zu Beginn meiner Reise noch vorgegaukelt hatte und dass man sich sogar in manchen Situationen in Deutschland freier bewegen kann. Ich fand es zum Beispiel gar nicht lustig, dass sich vor den meisten Bars oder Kneipen fast immer grimmige Securitys platzierten und mir den Eintritt in die dunkle Stube verweigerten, weil ich entweder eine kurze Hose trug oder aber Flip-Flops unter den Füßen hatte. Auch den vielleicht etwas lächerlich klingenden Punkt, dass man sich dort nirgends in der Öffentlichkeit mit einer Flasche Bier in der Hand blicken lassen durfte, empfand ich als eingrenzend.
Sicherlich kann man unterschiedlicher Meinung in Bezug auf das Thema Alkohol an öffentlichen Orten sein, allerdings in gewissen Momenten fühlte ich mich hier in meiner Freiheit etwas eingeschränkt. Die letzten zwei Wochen meiner Reise traf ich meinen jüngeren Bruder Jonas und seinen Kumpel in Sydney, die nach einer längeren Tour durch Neuseeland vor ihrem Rückflug nach Deutschland nochmal australischen Boden betreten wollten. Gemeinsam verbrachten wir zwei Nächte im berüchtigten Stadtviertel Kings Cross und besuchten das Olympiastadion, das nur wenige Monate nach dem gewaltigen Weltspektakel schon wieder seinen ganzen Glanz verloren hatte, so als läge die Olympiade bereits mehrere Jahre in der Vergangenheit. Anschließend reisten wir weiter über die langweilige Hauptstadt Canberra und dessen Regierungsviertel über Melbourne und bis zur verregneten Apollo Bay, die kurz vor der Great Ocean Road liegt.
Nach einer Nacht bei strömendem Regen im Zelt entschieden wir uns für die letzten Tage in der Apollo Bay zu bleiben, mieteten einen geräumigen Caravan und schauten relaxt dem kommenden Herbst und seinen Veränderungen entgegen. Und da in Deutschland bereits der Sommer vor der Tür stand, freuten wir uns alle drei wieder auf „Good Old Germany“. Mein Bruder und sein Kumpel reisten schon drei Tag vor meinem Rückflug ab und somit durfte ich die letzten Tage nochmal alleine sein und empfand diese Angelegenheit überhaupt nicht mehr unangenehm.
Am 25. Mai ging es wieder über den großen Ozean zurück nach Deutschland und ich hockte abermals in einem großen Flieger, verzichtete aber jenes Mal auf die Antiübelkeitstablette. Stattdessen ließ ich nach dem Start das Mediaprogramm unberührt, lehnte mich zurück und dachte darüber nach, ob mich diese Reise vielleicht sogar ein wenig verändert haben könnte. Die Zeit über den Wolken verging beim Rückflug bedeutend zügiger als der Hinflug und ich freute mich, dass mir auch ohne das Medikament nicht ein einziges Mal übel wurde.
Zurück auf deutschem Boden und nachdem ich dann meinen Rucksack vom Band gepflückt hatte, war ich nicht bloß froh, mein weniges Hab und Gut wieder in den Händen zu halten, sondern viel mehr glücklich darüber, dass ich mit vielen wunderbaren, ergreifenden und unvergesslichen Momenten zurück nach Hause kommen würde. Oder habe ich meistens meinem Tagebuch die eher wenig erfreulichen Momente anvertraut, um auf irgendeine Art und Weise Dampf abzulassen?
In jenem Jahr sollte noch ein weiterer gedenkwürdiger, aber leider auch schrecklicher Moment dazukommen, ein Augenblick, den ich zum Glück nur aus weiter Ferne erlebte. Es war der 11. September 2001: der Tag, an dem die Welt aus ihren normalen Bahnen gerissen wurde … eindeutig. Dieser hässliche Anschlag auf die zivile Bevölkerung bedeutete sowohl einen riesigen Einschnitt für die Freiheit, als auch eine Bedrohung der Sicherheit des gesamten Planeten, welche nun zu Recht in Frage gestellt werden durfte. Ja, ab diesem Datum gab es auf die Frage nach der Freiheit plötzlich ganz andere Antworten auf der Welt. Natürlich wird sich wohl ein jeder an diesen Tag erinnern und wahrscheinlich wissen, was er an diesem so gemacht hat, denn so ist es leider mit grässlichen Momenten. Nicht nur aufgrund des schrecklichen Ereignisses kam erneut eine Überlegung in mir auf: Kann man wirklich sagen, dass man im großen, starken, freien Amerika und im oft selbst erklärten freiesten Land der Erde, wo jeder eine Waffe tragen darf, um das Eigentum zu schützen, wirklich frei ist?
Ja, zu dieser Zeit stellte ich mir viele Fragen zur Freiheit und nicht bloß zu meiner eigenen. Die kommenden Jahre blieb ich meistens in Deutschland, denn das Studium folgte und beschäftigte mich selbstverständlich sehr. Auch meiner damaligen Freundin zuliebe hielten wir uns gemeinsam lieber mit kleineren Reisen in Europa auf, aber in einigen und vielleicht sogar in mehreren Momenten in jener Zeit überkam mich hin und wieder das Verlangen nach einer nächsten und größeren Reise, jedoch der schnöde Mammon, der noch schnarchte, hielt mich leider davon ab und nicht nur der. Zudem beschlich mich manchmal ein fremdes Gefühl, in Zukunft vielleicht doch lieber sesshaft zu bleiben. Je mehr ich hingegen in mich hineinhorchte, umso stärker erkannte ich, dass diese unvertraute Emotion keine selbstbestimmte war und ich entdeckte, dass ich das einfach nicht bin. Und dennoch sollten sagenhafte neun Jahre vergehen, bis ich keinen Bogen mehr machen wollte vor der immer größer werdenden Sehnsucht nach der Ferne und schon bald sowie endlich war ich in der Lage dazu, die nächste große Reise anzutreten. Aber noch bevor es dazu kam, zog ich nach Berlin.
„Warum ausgerechnet nach Berlin?“, fragten mich viele bekannte Gesichter. Sicherlich wäre es bei weitem zu einfach, wenn ich sage, dass mir das Leben in Gotha zu langweilig wurde, so kamen ganz bestimmt mehrere Gründe für meine Wahl zusammen. Der wichtigste dabei ist sehr wahrscheinlich jener, dass meine damalige Freundin, mit der ich eine lange und sehr gute Beziehung hatte und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Ich war wieder „frei“. Das heißt „frei“ für eine Veränderung und Berlin reizte mich schon seit längerem. Bei jedem Besuch empfand ich, dass diese unsere schöne, abwechslungsreiche Hauptstadt, nicht nur der Geschichte wegen einfach die Stadt ist, welche im Ganzen die Freiheit in sehr vielen Bereichen verkörpert und wirklich lebt. Keine andere Metropole in Deutschland kann da mithalten und so zog es mich im Jahre 2008 in jene aufregende Stadt. Zudem rückte der Gedanke, wieder mal eine größere Reise anzutreten, immer mehr in meinen Fokus. Denn seit der letzten war der Mond auch schon viel zu oft um die Erde gekreist, aber noch immer war der Zeitpunkt nicht gekommen, an welchem ich mich ganz alleine auf eine Tour bewegen wollte. Doch auch dieses Mal war keiner meiner Freunde und Bekannten bereit, sich mit mir ins Ungewisse zu stürzen. Es schien hingegen eher so, als wären sie alle in einer Schublade im Wohnzimmerschrank gefangen, welches durch ein großes schwarzes Schloss von der Firma Gesellschaft verriegelt worden wäre.
Manche von meinen Freunden hatten zwar Lust mitzukommen, doch niemand von ihnen fasste den Mut, sich mal eine Auszeit zu nehmen und sich mir einfach anzuschließen. Immer und immer wieder hörte ich leicht über die Lippen gehende Ausreden, wobei das gesellschaftliche Schloss wahrhaftig als Sicherheit vor den Riegel geschoben wurde. Aber sollte mich das nun wirklich daran hindern, in das doch nicht ganz so ungefährliche Südamerika zu reisen? Ich wollte unbedingt und endlich mal auf echte Indianer treffen und sehen, wie sie heutzutage leben sowie ob es sie überhaupt noch gibt?
Zunächst begab ich mich allerdings im Internet auf die Suche nach einem Menschen, welchen ich nicht lange zum Verreisen überreden brauchte und lernte in einem Weltreiseforum Karina kennen. Wir chatteten ein paar Mal hin und her und waren uns trotz des digitalen Kennenlernens recht sympathisch. Zu diesem Zeitpunkt hatte die vorweihnachtliche Zeit bereits begonnen, überall roch es nach Glühwein und so verabredeten wir uns in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt des Gendarmenmarktes auf einen heißen Wein. Dieses kurze Treffen sollte unser einziges bleiben und da die Zeit vor dem Abflug immer knapper wurde sowie keiner von uns beiden noch großartig Lust verspürte, nach anderen Mitstreitern zu suchen, verabredeten wir uns auf ein zweites „Date“ in Miami. Doch vor dieser zweiten Begegnung kam es zu einem echt angenehmen Zufall. Mein großer Bruder und sein Kumpel beabsichtigten, Ende Januar nach Jamaica in den Urlaub zu fliegen und fragten mich, ob ich mich ihnen nicht anschließen wollen würde. Selbstverständlich brauchte ich nicht lange darüber nachzudenken und buchte wenige Tage später ebenfalls einen Flieger auf die Insel.
1 Diese Straßenbahn rollt auf dem größten Straßenbahnnetz des Planeten