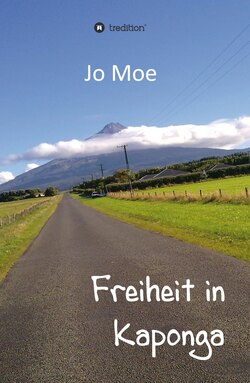Читать книгу Freiheit in Kaponga - Jo Moe - Страница 12
ОглавлениеKapitel 4
Eine Reise zu zweit durch Thailand und Vietnam
Am 27.8.2010 war es dann endlich so weit und die Amsel und ich hockten vergnügt im Flieger nach Bangkok. „Der eigentliche Thai-Name dieser Stadt aber“, sagte er und begann mit seinem Vortrag zur Geschichte Thailands, „hat insgesamt 168 lateinische Buchstaben und ist somit der längste Name einer Hauptstadt auf unserer Erde.“ Wahrscheinlich wanderten die ersten Thai im 11. Jahrhundert in die heutige Region Thailands aus Südchina oder jedoch auch aus dem Nordwesten Vietnams ein, zu einer Zeit, in der weite Teile Südostasiens durch die Khmer besetzt wurden. In den kommenden Jahrhunderten entwickelten sich mehrere Königreiche, die sich später vereinigen sollten. Allerdings konnte sich Siam6 noch bis ins 19. Jahrhundert zu keinem echten Nationalstaat herausbilden. „Warte mal Amsel, steht da nichts von irgendwelchen Eroberern aus Spanien, Portugal oder Holland?“ „Nö, oder … ja, hier bekommst du nun deine Antwort. Thailand gelang es in den Zeiten des Kolonialismus, von Eroberern weitestgehend verschont zu bleiben und sicherte damit seine Unabhängigkeit. Nichtsdestotrotz gab es Ausnahmen: ein paar portugiesische Eroberer, die etwa um das Jahr 1511 einmarschierten und ein Gebiet namens Malakka einnahmen.“
Dann verlor mein Kumpel noch ein paar weitere Worte, bis ich ihn bei dem folgenden Satz unterbrach: „Im Jahre 2001 schaffte es zunächst ein Telekommunikationsmogul an die Macht.“
„Ein was? Was für ein Muggel?“
„Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es kam jemand an die Macht, welcher wahrscheinlich alle Telefone im Land kontrollierte und über sie verfügte, also ein Mensch, der sich somit die absolute Kontrolle über Thailand sicherte. Dadurch ging es bei dieser Wahl mit Sicherheit nicht nur undemokratisch zu, sondern auf diese Weise wurde höchstwahrscheinlich probiert, einen kompletten Überwachungsstaat zu errichten“.
Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb folgten etliche Militärputsche. Sogar in unserer heutigen Zeit, erst vor Kurzem, kam es am 22.5.2014 erneut zu einem Militärputsch und dieser Tage thront ein General am Regierungshebel. Und das, obwohl ein König das Staatsoberhaupt ist, sich das Regierungssystem als konstitutionelle Monarchie bezeichnet und mit einer sogenannten Erbmonarchie als Staatsform ausgestattet ist. „Ein Chaos, blickst du da noch durch?“, fragte die Amsel.
„Nö, aber soweit, wie ich da durchblicke, gibt es dort auf jeden Fall keine wirkliche Demokratie oder?“ „Mal sehen, ob wir das in irgendeiner Form mitbekommen“, sagte die Amsel.
„Naja, hmm, mir fällt dazu noch ein, dass es ja auch noch die parlamentarische Monarchie gibt. Aber ich denke, dass all diese Formen von Monarchien nicht wirklich was gemein haben mit einer Diktatur, oder?“
Wegen der vielen etwas verwirrenden Sätze nahm ich mir nochmals die Geschichte des Landes zur Hand und erkannte, dass die Versuche, eine Demokratie im Staat einzuführen, sich so schwierig darstellten, wie ich es auf meinen Reisen und am jeweiligen Interesse zu der Geschichte der einzelnen besuchten Länder noch bei keinem anderen Land gelesen hatte. „Und ausgerechnet Thailand wurde mal nicht von den Europäern erobert. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?“ Doch beide, wussten wir nach meiner Frage nur blöd zu glotzen und bestellten uns lieber noch ein paar kühle Bier.
„Zu zweit fliegen ist einfach schöner Amsel, Prost!“
Die Zeit verging wunderbar zügig und schon bald war der Zeitpunkt der Landung gekommen. Ein Taxi parkte direkt vor unseren steifen Füßen und da wir keine Lust hatten, den Taxipreis bei anderen Taxifahrern zu vergleichen, stiegen wir sofort ein. Je näher wir dann auf die Stadt zusteuerten, umso träger und seltener wurden unsere Worte, denn beide schauten wir gespannt und mit großen Augen durch die verstaubten Scheiben. Ja, auch ich hatte vorher noch nie so ein Durcheinander und buntes Treiben der Menschen auf den Straßen und Gassen gesehen. Und auch wie der kleine Herr Taximann uns durch die überfüllten Straßen mit seinem schnittigen Schlitten manövrierte, war wirklich bemerkenswert.
Leicht beschwipst und natürlich sehr verschwitzt erreichten wir bei brütender Hitze unser gebuchtes Hotel in der Innenstadt der „Stadt der Engel“. An der Rezeption wurde uns von zwei freundlichen Gesichtern ein Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt und wir stampften ein paar Treppen hinauf zu unserer Kammer, in der wir uns fühlten, als hätten wir die Tür zu einem Brutkasten geöffnet. Deshalb schmissen wir bloß unser Gepäck in zwei Ecken und marschierten zurück in die bunte und nicht ganz so heiße, aber turbulente Welt und suchten nach Nahrung.
An einem kleinen Imbisse an der Straße kroch uns leckerer Duft in unsere Nasen, sodass wir uns dort in zwei rote Kinderstühle aus Plastik hockten und unsere hungrigen Mägen auffüllten. Das Essen war echt spitze, kitzelte alle Sinne auf der Zunge, kostete vielleicht umgerechnet drei Euro und zudem wurde der graue Teller mit farbenfrohen Blumen geschmückt. Darüber waren wir natürlich sehr verzückt, stießen unsere Chang Bierflaschen in der feuchten Luft zusammen und hofften auf eine tolle Zeit.
In den folgenden Tagen schauten wir uns auf den verschiedensten Wegen im Taxi, mit dem Tuk-Tuk oder Boot die im Wechsel von schrillen, spannenden und mit modernen Hochhäusern und zahlreichen schönen, buddhistischen Tempeln verzierte Stadt an.
Das Leben der Menschen war an diesem Fleck der Erde schon recht chaotisch, doch trotz alledem irgendwie nicht hektisch. Öfters ließen wir uns von Tuk-Tuks durch die Gegend chauffieren und besichtigten auch einmal eine Tempelanlage, die von Wat Pho. Ja, und bei wirklich jeder Fahrt versuchten uns die Lenker der Autorikschas in irgendwelche Schmuck- oder Anzugsgeschäfte zu zerren. In der berühmten sowie sehr touristisch und völlig mit Menschen aus aller Herren Länder vollgestopften Khao San Road beantragten wir brav in einem Touristenbüro unser Visum für Vietnam. Außerhalb des Büros, direkt auf dieser berüchtigten Straße, bekommt man aber bei einigen Ständen sämtliche gefälschte Ausweise, Papiere, Dokumente sowie Führerscheine aller Art dieser Welt. Wir allerdings wollten nichts Gefälschtes und machten uns lieber auf Entdeckungstour. Neben all diesen Marktbuden schmückten hunderte T-Shirt Geschäfte sowie Fressbuden mit den verschiedensten und eigenartigsten Kreaturen dieses großen Planeten, wie Schlangen, Kakerlaken oder Skorpione, das Bild dieser Stadt.
Mit der Amsel zusammen war es möglich, absolut spontan und ohne großen Plan einfach drauf los zu pilgern. Daher entschieden wir uns völlig unkompliziert, weiter in den Süden zu fahren. Wir stiegen in einen Zug, der uns über Nacht in einem Schlafwagen ohne Schlaf und zwischen hässlichen Kakerlaken nach achtstündiger Fahrt in die Richtung der Insel Ko Tao brachte.
Anschließend hüpften wir auf eine Fähre und erreichten nach rund anderthalb Stunden die „Schildkröteninsel“.
„Einst war diese kleine Insel von zahlreichen dieser behäbigen Tierchen bevölkert und so entstand jener Name, bis es mal wieder der Mensch war, der es schaffte, nahezu alle Panzertiere einfach auszurotten“, wusste mir die Amsel zu berichten. Doch auch ohne die Besonderheit der armen Tierchen ist die Insel auch in heutigen Tagen ein beliebtes Taucherparadies. Allerdings hatten wir auf dieses Erlebnis, nur weil das vermutlich jeder dort macht, keine Lust und stiegen lieber auf zwei Motorräder, die wir uns ohne großartiges Tamtam recht günstig liehen und schossen über die wirklich tolle, tropische Insel. Aber als wir die Motos nach vielen gefahrenen Kilometern wieder abgeben wollten, wurde es weitaus teurer als wir dachten und das Dumme war, dass wir selbst daran schuld waren.
Vielleicht macht man bloß so einen Blödsinn, wenn man sich so gut kennt und jeder sich in der Nähe sowie mit den Taten und Worten des Freundes sicher fühlt?
An unserem letzten Abend auf der Insel wurde vor einer Strandbar eine Party direkt am Meer und mit Menschen, die Feuer spuckten, veranstaltet. Wahrscheinlich wäre ich, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, auch auf diese Fete gegangen und hätte vielleicht zwei Bier in meinen Hals geschüttet. Mit der durstigen und trinkfesten Amsel trank ich jedoch mindestens doppelt so viele davon.
Die Feier war wirklich lustig, aber neigte sich natürlich irgendwann dem Ende entgegen und selbst noch dann waren wir total bunt mit irgendwelcher Farbe eingeschmiert. Außerdem sahen wir beide bestimmt aus wie zwei bekloppte Clowns, die aber nach zusätzlichen Belustigungen keinerlei Drang mehr verspürten und deshalb entschieden wir uns, zurück zum Hotel zu fahren. Aber wie? Wir schauten und verharrten, doch nirgends war ein Taxi oder Tuk-Tuk zu sehen. Unsere zwei Motorräder hingegen standen seelenruhig wie zwei ältere Hunde vorm Eingang zur Bar und warteten nur darauf, bewegt zu werden. Und so guckten wir uns kurz in unsere fragenden Gesichter und meinten dann fast synchron: „Ach komm, lass uns fahren, soviel Alkohol war‘s nun auch wieder nicht und außerdem gibt es hier doch überhaupt keinen Verkehr und schon gar nicht um diese Uhrzeit!“
Der Weg zurück zum Hotel verlief dann wirklich einfach, denn es ging für die drei Kilometer immer nur geradeaus. Zudem gab es auch keinerlei Betrieb auf der Gasse und beinah verlief es tatsächlich so, wie wir uns das ausgemalt hatten. Doch plötzlich, kurz bevor wir unsere Unterkunft erreicht hatten, passierte es! Zu diesem Zeitpunkt tuckerte ich ein paar Meter vor dem anderen Clown und entdeckte zwei kreischende Affen, die sich von Baum zu Baum durchs Geäst jagten. Ja und um dieses lustige Schauspiel kurzzeitig weiter zu verfolgen, ruhte mein Blick für Sekundenbruchteile weiterhin in den Bäumen und nicht auf der Straße. Die Affen waren schnell wieder verschwunden und so schaute ich erneut zurück nach vorne, aber in diesem Augenblick sah ich nur noch den Straßengraben auf mich zukommen und war lediglich dazu in der Lage, mein Motorrad unsanft auf dem Rücken im Graben zu „parken“.
Zum Glück jedoch war die Geschwindigkeit zuvor sehr gering und so passierte mir nichts, allerdings mein fahrbarer Untersatz holte sich dennoch zwei harmlose Kratzer. In diesem Augenblick rollte die Amsel belustigt an mir vorbei, bremste schließlich ab, blieb stehen, doch geriet dabei irgendwie wankelmütig ins Wackeln und krachte einfach auf die Seite. Dieses Mal musste ich lachen und mein Kumpel stimmte nach kurzem Besinnen darüber, was geschehen war, mit in das Gelächter ein. Ihm war glücklicherweise nichts passiert, jedoch hatte sein Motorrad kurioserweise mindestens zwei Kratzer mehr als meins.
Am nächsten Tag brachten wir also die Roller wieder in den Moped Laden und die arme Amsel musste fast das Doppelte an Strafe für die lächerlichen Kratzer zahlen als ich.
Nach dieser Lehre stiegen wir erneut auf eine Fähre, die uns zu einer weiteren Insel bringen sollte. Koh Panghan lag erneut etwa eineinhalb Stunden Fahrt entfernt. Bei dieser Überquerung aber herrschte nun ein übler Seegang und zudem war uns vom Vorabend noch sehr flau im Magen. So hockten wir uns bei sengender Hitze jeder in eine Ecke, beide zerknittert sowie völlig blass und sprachen kein einziges Wort miteinander. Am späten Nachmittag erreichten wir dann endlich das rettende Ufer der etwas größeren Insel. Mehr weiß ich tatsächlich nicht von diesem Eiland zu berichten …
Ja, auch auf einer dieser legendären Full Moon Partys waren wir nicht, da wir das Pech hatten, dass bei unserem Besuch einfach keine stattfand, wobei dieser Nichtbesuch ja definitiv auch keine Entschuldigung für mein Vergessen sein kann. Und auch meinem Reisetagebuch hatte ich in dieser Zeit kein einziges Wort anvertraut und ich finde in meinem Kopf auch keinerlei Erinnerungen daran.
Beim Alleinreisen in Südamerika habe ich jeden Tagin mein Buch geschrieben, selbst wenn es an manchen Tagen bloß ein einziges Gefühl war. Das zu zweit reisen ist eben einfach anders …
Anschließend machten wir uns über Ko Samoi wieder zurück aufs Festland in die Hafenstadt Krabi. Als wir dort ankamen, verspürten wir beide keinerlei Lust dazu, nach einer Unterkunft zu suchen und entschieden uns deshalb für das erstbeste Hotel, parkten im Zimmer unsere Sachen, sprinteten zurück an den gemütlichen Fischerhafen und speisten lecker Fisch. Gegen Mitternacht waren wir zurück im Hotelraum und waren bloß noch im Begriff, uns schlafen zu legen, als plötzlich meine sensible Nase kapitulierte. Das Zimmer stank einfach bestialisch!
„Amsel, ich halte das hier nicht aus. Das stinkt nach einer Mischung aus Fäkalien und ätzender Chemie, hier kann ich wirklich kein Auge, geschweige denn ein Nasenloch zumachen, nicht mal bloß für eine Nacht!“ Meinem Kumpel erging es ähnlich, doch weil er schon am Einschlafen war, störte es ihn nicht allzu sehr. Aber er erkannte den seltenen Ernst in meiner Stimme und war sofort mit meinem Vorschlag einverstanden, uns schnellstens aus diesem Stinkeloch zu verkrümeln. Also reichten wir dem verwirrt dreinblickenden Mann an der Rezeption unseren Schlüssel und fanden nach wenigen Schritten ein viel sauberes und vor allem geruchloses Zimmer. „Ach Amsel, hier gefällt‘s mir, vielen Dank, dass ich dich nicht überreden brauchte und dass du ohne Theater mit mir zusammen aufgebrochen bist.“ Ja, wir beide verstanden uns blind sowie blendend und ich war froh, ihn als Reisepartner an meiner Seite zu wissen.
Am nächsten Tag machten wir eine Tagestour mit einem Kajak durch den Dschungel, wobei uns schwimmende, gierige Äffchen auf dem Boot besuchten. Anschließend bekamen wir die Möglichkeit, auf einem Elefantenrücken durchs Gestrüpp zu stampfen. Wir willigten ein, doch noch während wir auf dem Dickhäuter hockten, mischte sich ein fader Beigeschmack bitter zu unserem Ritt hinzu, denn der kleine Typ, welcher sich selbst als der Herr des sanftmütigen Riesen betrachtete, schlug ständig mit einem pickelähnlichem Ding auf die großen, empfindlichen Elefantenohren ein, sie bluteten. Und uns bluteten dabei unsere Herzen … also rieten wir ab diesem hässlichen Moment allen Reisenden, welche wir später auf dem Weg unserer Reise begegneten, davon ab, solch eine Elefantentour mitzumachen.
Einen Tag später hockten wir im Fußballstadion von Krabi und schauten uns ein Spiel der zweiten thailändischen Liga an. Das Match war langweilig, doch dafür hatten wir einen interessanten Platz als einzige Männer zwischen bestimmt fünfundzwanzig Frauen, welche kreischend um uns herumsaßen.
In den darauffolgenden Tagen ließen wir uns auf der Insel Ko Phi Phi nieder, schipperten einmal zu der sehr berühmten Nebeninsel, auf der man den Film „The Beach“ gedreht hatte und wurden dabei auf verschiedene Art und Weise enttäuscht. Überall lag Müll umher, tausende Touris tummelten sich in allen möglichen Ecken herum und zerstörten somit zusätzlich noch die gefälschte Kulisse. Denn für den Film wurde per Computer die wirkliche Szenerie bearbeitet, um eine echte Bucht entstehen zu lassen, und zwar indem man zwischen zwei Felsen, welche normalerweise das Tor zum offenen Meer bilden, einfach einen weiteren Felsen digital dazu zauberte. „Ich würde nur allzu gerne mal wissen, wie viele Menschen bloß hierhergekommen sind, seitdem und weil bekannt wurde, dass auf dieser Insel „The Beach“ gedreht wurden ist? Wieso muss man eigentlich überhaupt zu irgendwelchen Filmschauplätzen pilgern? Was ergibt das für einen Sinn?“
„Hmm, denke auch, dass die Insel bestimmt fast unbesucht sowie sauber wäre, wenn da nicht dieser Film gewesen wäre. Schon echt bescheuert, dass manche Orte erst durch die unechte Welt eines Films interessant werden.“ Natürlich waren mein Kumpel und ich auch gewöhnliche Touristen und stiegen in das Boot zu jenem Schauplatz. Warum wir uns aber dazu verleiten ließen, das wussten wir selber nicht. Vielleicht lag es jedoch am „Wir“ oder an der echten Kulisse, die wir erwarteten? „Amsel, wäre es nicht großartig, wenn man an faszinierenden Plätzen der einzige Touri wäre?“
Als wir wieder auf der Hauptinsel landeten, mieteten wir uns einen Bungalow direkt am Strand, ließen kaum eine Party aus, speisten dazu bestes thailändisches Essen und trafen erneut auf das mysteriöse Mädchen von Ko Samui. Und wie uns bei all dem die Zeit davonraste, ja es also viel zu früh so weit war, dass wir uns schließlich wegen des baldigen Fluges wieder auf den Weg zurück nach Bangkok bewegen mussten. So stiegen wir zwangsläufig in einen Nachtbus, erreichten nach einer anstrengenden elfstündigen Fahrt die Metropole und hockten uns am Abend in den Baiyoke Tower 2 und waren uns mehr als einig darüber, dass man weitaus mehr Zeit als zwei Wochen benötigt, um Thailand wirklich zu erkunden. Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns aus dem „Land des Lächelns“, doch freuten uns natürlich auf Vietnam.
Zwei Stunden sollte in etwa der Flug nach Hanoi dauern, so klaute ich mir das schlaue Buch von der schlummernden Amsel und stöberte in der interessanten Geschichte des Staates. Während ich die ersten Zeilen las, bemerkte ich, dass die Historie der Menschen in dieser Region schon sehr früh begann — bis zu 500 000 Jahre alte, erste menschliche Spuren kann man dort nachweisen.
Merkwürdig, waren die ersten Spuren des „Homo sapiens“ nicht in Afrika entdeckt worden und zudem auch nicht vor einer ganz so lang verstrichenen Zeit? Somit war ich etwas durcheinander sowie ungeduldig und wollte das nun genauer wissen. Ich kenne die Amsel schon seit Schulzeiten und weiß daher, dass er gerade in Biologie sehr gut war und so genügte ein etwas lauteres, aber kurzes krächzendes: „Heeeeeääääähmm“, wie man es bei einem kratzenden Hals so gerne tut und der Kerl war hell erweckt. „Ja, was gibt’s? Bin doch wach.“ Ich weihte ihn in meine Gedanken ein, bis er sich daraufhin kurz an der Nase rieb wie Wicky, der schlaue Wikinger und meinte: „Die eigentliche Geschichte des Menschen beginnt schon vor ungefähr zehn Millionen Jahren, also der Entwicklungsprozess des Menschen, wo er zum Menschen wurde. Vor etwa zwei Millionen Jahren entwickelte sich im Osten Afrikas der heute als Urmensch angesehene ‚Homo habilis‘ und aus ihm soll sich dann der „Homo erectus“ herausgebildet haben. Man fand den Nachweis dieser Spezies im heutigen Java. Das ist eine der vier Großen Sundainseln, die in der Republik Indonesien liegen.“ „Also ist der ‚Homo erectus‘ selbstverständlich vor dem „Homo sapiens“ einzuordnen“, meinte ich. „Klar“, sagte die Amsel.
„Doch wie schaffte es dennoch der ‚Erectus‘, von Asien nach Afrika oder doch umgekehrt? Denn vor rund 100 Millionen Jahren drifteten im sogenannten ‚Kontinentaldrift‘ die Kontinente, so wie sie auch heute vorzufinden sind, auseinander“, wusste ich dieses Mal zu klugscheißern. „Hm, wahrscheinlich nicht mit dem Boot, sondern bestimmt mit seinen behaarten Füßen! Irgendwie scheinen aber der ‚Erectus‘ und der ‚Sapiens‘ zwei unterschiedliche Spezies zu sein, wobei der ‚Erectus“ und das gilt, so glaube ich, als belegt, der erste ‚Mensch‘ gewesen zu sein scheint, welcher Feuer machte. Jetzt wird es allerdings noch kurioser, denn diese Spezies gilt als ausgestorben. Und somit haben wir uns höchstwahrscheinlich nicht aus dem ‚Homo erectus‘ entwickelt.“
„Ach herrje. Und was nun?“, fragte ich. „Ja, da staunste, was?“ Tatsächlich habe ich einen weiteren interessanten Fakt in meinem modernen Gehirn abgespeichert“, sagte mein Kumpan: „Ein circa 280 000 Jahre alter Schädel wurde in China entdeckt. Dieser gilt als eine Vorstufe zum ‚Homo sapiens‘ und wird als ‚Homo sapiens daliensis‘ bezeichnet.“ „Oh Mann, oh Mann, jetzt sind wir völlig ab vom Thema gekommen und ich bin noch verwirrter als vorher, dann warte mal lediglich wenige Jahrzehnte ab, mal sehen, was bis dahin die Wissenschaftler noch alles herausfinden und von wem wir noch so alles abstammen … Leg du dich mal wieder schlafen und ich lese weiter!“ Doch vorher dachte ich: Alle Menschen dieser Welt sind irgendwann einmal, irgendwo hin zugewandert.
Am frühen Vormittag landeten wir in Hanoi, hatten somit noch den ganzen Tag vor uns und entschieden uns deshalb dazu, in einem kleinen, gemütlich rustikalen Café bei Kaffee und Mürbekuchen nur eine Nacht in der Stadt bleiben zu wollen. „Mann, Bangkok war dagegen ja der reinste Kurort.“ Denn was in dieser Stadt an Verkehr mit und ohne Moped, und an Massen von Leuten los war, die allesamt zielloser herumzuirren vermochten wie Ameisen in einem nur für uns Menschen ungeordnet zu scheinenden Ameisenhaufen im Wald, war beeindruckend.
Ja, so ein Chaos hatten wir beide zuvor noch nie erlebt und doch war das Erlebnis mehr als spannend, so wie es einst Ulrich Wickert bei einem Filmdreh in Paris demonstrierte, als er sich, ohne nach links und nach rechts zu schauen, einfach in den Wahnsinnsverkehr hechtete und dabei „blind“ über eine breite Straße latschte. So taten wir es ihm nach und nein, lebensmüde musste man dazu nicht sein, weil so chaotisch es auch aussah, die Menschen dort jedoch tatsächlich Rücksicht nehmen. Vielleicht wäre das Durcheinander bedeutend größer, wenn es Ampeln gäbe!“, sagte die Amsel.
Wir waren beeindruckt und der alte Stadtkern mit seinen zahlreichen Gassen war äußerst interessant. So stellt jeweils eine schmale Straße beispielsweise eine bestimmte Berufsgruppe, wie Schmied, Korbflechter, Maler oder Drechsler dar. „Perfekt, hier sind wir richtig, komm lass uns mal einen Schuhmacher suchen.“ Wir spazierten von der Gasse mit der Berufsgruppe der Schmiede in die der Drechsler7, welche ihre Arbeiten und ihr Handwerk Geschäft an Geschäft direkt auf dem Fußweg verrichteten. Ja, auch all die anderen Berufsgruppen nutzten diesen als offene Werkstatt.
Bei unserer Tour durch die Gassen hätten wir hin und wieder nichts gegen Ohrstöpsel oder aber zudem Schutzbrillen einzuwenden gehabt, so laut war es nämlich teilweise und zudem spritzten uns ständig irgendwelche Funken vor die Füße. Bis wir in einer Ecke, auf einem kleinen Sockel, der nicht größer als eine halbe Katze war, einen alten Mann mit tiefen Furchen im Gesicht und Schuhmacherutensilien sitzen sahen. „Vielleicht kann er mir ja helfen?“ Dabei blickte ich dem Herrn ins Gesicht, senkte meinen Kopf als Geste des “Hallo Sagens“ und streckte ihm vorsichtig meinen linken Fuß mit dem kaputten Flip-Flop entgegen. Bei diesem kurzen Akt schaute er mir nicht eine Sekunde in meine Augen, sondern blieb eisern und ohne sich dabei groß zu bewegen auf seinem Schemel hocken, nahm sich meinen „Schuh“ und machte sich gewissenhaft an sein Werk. Nach weniger als vier Minuten bekam mein linker Fuß seinen FlipFlop zurück, welcher wieder wie neu aussah.
Im Anschluss daran stiegen wir in ein albern buntes Tuk-tuk und rollten zwischen vielen alten, traditionellen Hütten und Häusern, bei welchen öfters der französische Einfluss unverkennbar war, zu einer sehr alten Zitadelle hin. Hier setzten wir letztlich unsere Schritte rein und erhielten die Info, dass das große Grundstück des Gebäudes, das aus dem Jahr 1000 nach Christus stammt, noch unbeschadet ist, weshalb Hanoi auch eine der ältesten, noch gut erhaltenen Städte Südostasiens ist. Danach hockten wir uns wieder in ein Tuk-tuk und rasten durch die Metropole. Wir mussten währenddessen feststellten, dass diese trotz des französischen Einflusses an keiner Ecke ihre eigene vietnamesische Identität verloren hat. Und im Vergleich zu Bangkok entdeckten wir viel weniger herumschleichende Touris mit ihren großen Fotoapparaten. Am darauffolgenden Tag fläzten wir uns für drei Stunden in einen Bus und betrachteten bei dieser Fahrt die nahezu endlos scheinenden Reisplantagen, bis wir in Halong City landeten. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir keine zwei Wochen mehr Zeit, das Land zu erkunden. Und was war mit dem Leute Kennenlernen?
In Thailand hatte ich schon gespürt, dass das Zusammenreisen und somit das die ganze Zeit über permanente Zusammensein anders ist als das Alleinreisen. Denn als ich in Südamerika dann komplett alleine unterwegs war, bemerkten das die Leute natürlich und kamen gerne auf mich zu und sprachen mich an. Reist man zu zweit, passiert das viel seltener bis gar nicht. Spaziert man alleine durch die Gegend, wird man ganz anders wahrgenommen und behandelt, als wenn man zu zweit unterwegs ist. Auch ich selbst bin davon betroffen und nehme dann meine Umwelt auf ganz andere Weise wahr und bin achtsamer sowie aufmerksamer in vielerlei Hinsicht.
Beim zu zweit Reisen hat man einen Vertrauten an seiner Seite: das ist jemand, welcher einem in gewissen Momenten beschützt und einen vor manch „Angemache“ schützt. Ich bin mir sicher, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, dass mich garantiert in einigen Situationen dutzend mehr fliegende Händler in ihr Visier genommen hätten. Im Beisammensein mit der Amsel kam das natürlich hin und wieder trotzdem vor, doch mit Sicherheit viel seltener, verhaltener und es war einfach anders. Das ist allerdings der eine Aspekt; der andere ist der, dass ich mir in Situationen, wenn ich alleine reise, ab und an eine Pause gönne und dazu auf einer Parkbank Platz nehme sowie von Einheimischen angesprochen werde, weswegen meistens spannende Bekanntschaften und natürlich auch Gespräche entstehen. Dennoch haben definitiv beide Reisearten seinen Reiz.
Aber welches Argument wird wahrscheinlich in einer Liste im positiven Feld für die Variante des zu zweit Reisens ganz oben stehen? Genau: das Erleben von schönen Momenten ist zusammen doch viel schöner und man kann jene miteinander teilen! Und was ist mit dem Teilen von weniger schönen Augenblicken? Zunächst möchte ich jedoch auf die schönen Momente eingehen, welche man sich dann zu zweit teilt: Als ich in Australien war, hatte ich diese Erklärung, dass man zusammen mit einem vertrauten Menschen erlebte Momente mehr genießen könne als alleine, zu hundert Prozent unterstrichen. Mittlerweile habe ich einen noch besseren Vergleich, zudem bin ich ein paar Wochen älter geworden und muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass das Auskosten eines schönen, besonderen Augenblicks, während man alleine ist, viel intensiver ist als beim zu zweit sein.
Heutzutage kann ich diese ganz anders genießen und vermisse in diesen Zeiten wirklich niemanden. Denn manches Mal erging es mir tatsächlich schon so, dass, wenn ich mich in einem einzigartigen Momentum befand, während ich mit einem anderen Menschen zusammen gewesen bin sowie dabei der Person ganz aufgeregt mitgeteilt hatte, wie schön und toll ich doch gerade diese Zeit empfand, leider schon öfters jener ganz kühl und nüchtern antwortete: „Jetzt krieg dich doch mal wieder ein, so toll ist es nun auch wieder nicht!“ Dadurch wurden diese Augenblicke für mich zerstört und blieben mir auch leider nicht mehr als besondere Momente in meiner Erinnerung …
Wir waren an diesem Tag schon recht früh in Halong City angekommen und ich fragte mich zum ersten Mal, da mir plötzlich bewusst wurde, wie sehr die letzten Tage mit der Amsel nur so verflogen waren, ob es von diesem Zeitpunkt an ein Gehetze durch das Land werden würde, da unser Rückflug von Ho-Chi-Minh-Stadt, ganz im Süden des Landes gelegen, etwa noch 1600 Kilometer entfernt lag und wir lediglich zwölf lächerliche Tage dafür übrig hatten!
Deshalb entschieden wir uns am gleichen Tag für einen Boottrip zu der wunderschönen Halong Bucht, die rund 2000 meist unbewohnte Inseln beheimatet. Nach kurzen und schmerzlosen „Verhandlungen“ mit dem Kapitän stiegen wir auf eine kleine, familienbetriebene und uralte Dschunke8.
Der knurrige Vater des kleinen lebhaften Mädchens war der Chef sowie zugleich Kapitän des Schiffs und seine Frau hielt sich schüchtern und putzend im Hintergrund auf. Im Vordergrund versuchte das Kind seine Schulaufgaben verpflichtend zu erledigen und wir durften es uns „frisch, fromm, fröhlich und frei“, wie dies einst der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn zelebrierte, über Stühle und Tische springend, die ungeniert im Weg standen, gemütlich machen. Wir entschieden uns für die Reling, glotzten staunend in die Nähe und beobachteten, wie die Menschen in dieser Region direkt mit und auf dem Wasser wohnen. So schipperten wir an schwimmenden Dörfern vorbei, die aus kleinen Holzhütten zusammengezimmert worden waren und sahen viele interessante, von der Natur erschaffene, bizarre Felsformationen, bis wir in den purpurroten Sonnenuntergang hineintrieben. Dabei vergaß ich das noch am Morgen aufgekommene Gefühl des Gejagdwerdens von der Zeit.
Nach einer dreizehnstündigen Fahrt mit dem Zug erreichten wir einen Tag später die 800 Kilometer entfernte Stadt Hue. Sie liegt ungefähr zwanzig Kilometer vom Meer entfernt und direkt an einem großen Fluss, welcher als „Parfumfluss“ bezeichnet wird. Warum das fließende Gewässer diesen Namen trägt, fanden wir nicht heraus; es roch paradoxerweise nicht besonders gut und deshalb entschieden wir uns wahrscheinlich dafür, gleich am nächsten Tag nach Hoi An weiterzuziehen. Jene Altstadt, durch die ein Fluss vorbei an alten, äußerst farbenfrohen sowie gut erhaltenen, kolonialen Häusern fließt, fanden wir besonders schön. Hinzu kam ein tägliches, immer zur Dämmerung stattfindendes, wunderbares Schauspiel, bei dem die zahlreichen roten und runden Laternen eingeschaltet wurden und sich der Schatten des roten Lichtes dabei malerisch im fließenden Wasser spiegelte. Wahrhaftig, in diesem Örtchen fühlten wir uns wohl und trafen erst am letzten von den vier Tagen Aufenthalt die Entscheidung, wieder aufzubrechen und begaben uns vorerst auf einen Tagesausflug zur alten Tempelstadt „My Son“.
Dort standen wir zwischen uralten Tempeln, dem eifrigen Tourguide und einigen gierigen Touristen, die in karierten Hemden immer vor unseren Nasen herumturnten und hatten plötzlich keine Lust mehr. Wir folgten aber dennoch in einem immer größer werdenden Abstand und wie zwei pubertierende Pickelteenager dem Mob und seinem Führer. Weil wir die englischen Worte des Reiseleiters kaum verstanden und das nicht mal wegen der stets steigenden Entfernung von ihm zu uns, spalteten wir uns von der Gruppe ab und entdeckten lieber auf eigene Faust die Anlage. Schließlich legten wir uns in den friedlichen Schatten eines Baumes und schlummerten ein wenig.
Am Abend stiegen wir in einen Nachtbus in die nächstgrößere Stadt und buchten ein Hotel am Meer. Wir lungerten dort dann oft einfach am Strand rum, schnorchelten oder getrauten uns mal wieder ein Moped zu mieten. Auf diese Weise tauchten wir völlig planlos in das interessante Hinterland der Stadt ein. Nha Trang beheimatete zur Zeit unseres Aufenthalts circa 370 000 Einwohner und gefühlt doppelt so viele Motorräder. Somit bestand für uns die erste Herausforderung darin, heil aus der Metropole zu fahren. Ohne Navi und Karte schlängelten wir uns plan- und ziellos, aber in einem wirklich großen, aufregenden Abenteuer durch die überfüllten Straßen dieser Stadt. Wir rollten danach über schwingende Hängebrücken, an zahlreichen Dörfern, Feldern und Wäldern vorbei und fühlten uns beide total befreit. „Wie toll und was für ein Gefühl von Freiheit muss das denn sein, mit einem Motorrad auf eine große Reise zu gehen?“, schrie ich durch den Fahrtwind zur Amsel und wir verfielen beide zwischen angenehmen Wind und strahlendem Sonnenschein ins Schwärmen. Es war wirklich traumhaft, einfach drauf los zu fahren und dabei nicht zu wissen, wo wir landen werden. Auf diesem kleinen Weg, durch den Dschungel, gerieten wir nicht bloß einmal an dessen Ende und mussten wieder umkehren, bis wir in einen abgelegenen Ort gelangten. Als wir dort in die Nähe einer Schule fuhren, wurden wir umzingelt und fast von unseren Mopeds gerissen. Letztendlich mussten wir anhalten und dieser Moment wurde für uns beide zum bis dato schönsten auf unserer gesamten Reise.
Ja, in so viele ehrliche, strahlende, fröhlich lachende Gesichter von bestimmt fünfzehn Schulkindern zu blicken und dabei herzallerliebst in Empfang genommen zu werden. Ja, das war was ganz Besonderes. Mit weit aufgerissenen Kinderaugen musterten sie uns von oben bis unten und steckten dabei in einer uns aus DDR-Tagen bekannten Jungpionieruniform mit blauen aalglatten Halstüchern. Sie alle wollten uns am liebsten zur gleichen Zeit anfassen und grinsten uns dabei unentwegt an sowie redeten pausenlos auf uns ein. Natürlich ließen wir uns dann davon anstecken, lachten mit den Kindern zusammen und zwar so sehr, dass wir ein paar Freudentränen aus unseren verstaubten Gesichtern reiben mussten. Wahrscheinlich hatten die fröhlichen Kinder solch komische Außerirdische, wie wir beide es bestimmt für sie waren, noch nie zuvor vor ihre niedlichen Gesichter bekommen. Für ein paar Minuten genossen wir unseren „Empfang“ und mussten uns regelrecht dazu zwingen, wieder weiterzufahren. Im Anschluss daran kreuzten wir ein anderes Dorf, hielten kurz für zwei amüsierte Blicke unter einem großen, Schatten spendenden Baum und beobachteten einen kleinen Fleischerstand mit Fleischer und seiner Kost, der auf einem großen Holztisch stehend bei dreißig Grad im Schatten und unter dem Besuch tausender ekelhafter Fliegen fröhlich sein Fleisch präsentierte und wie das erst roch … Schnell machten wir uns wieder vom Acker und entdeckten wenige Kilometer später ein sehr spannendes Gefährt. Daraufhin stoppten wir unsere Räder und beobachteten einen Mann, der schwer mit seinem Motorrad kämpfte. Dies hatte er mit etwa um die 150 Kilo Bananen beladen und probierte tatsächlich, damit loszufahren. Zunächst jedoch blieb es bei einigen krummen Versuchen, bis er es irgendwie schließlich dann doch schaffte; allerdings landete er schon rund zehn Meter später mitsamt Gepäck im Graben.
Hatte der ein Glück, das wir neugierig stehen blieben und aus diesem Grund schnell zu ihm eilen konnten. Wir halfen ihm unter schweißtreibenden Körpereinsatz dabei, seinen „Lieferwagen“ aus dem Abgrund zu angeln und pflückten danach sämtliche Bananen aus der Mulde sowie von der Straße. Er bedankte sich und schien seine Ladung sowie dessen Befestigung nochmal durchdenken zu wollen, doch wollte dies lieber alleine machen, schenkte uns zwei Bananen und sagte: „Good Bye“.
Danach tuckerten wir auf irgendeinem Weg und irgendwie zurück in die Stadt. Als wir dort dann ankamen und fast 200 Kilometer auf dem Erfahrungszeiger stehen hatten, fühlten wir uns jenes Mal mit der Hektik im Straßenverkehr schon um einiges vertrauter. Selbstbewusst jagten wir unsere Roller mit 90 Klamotten durch die engen Gassen und erreichten mit pochenden Herzen sowie durchaus glücklich und unbeschadet den Motorradverleih. „Was für ein toller, beeindruckender Tag“, sagte die Amsel.
Die darauffolgende Nacht träumte ich mal wieder. Ich schwelgte in Träumen von der DDR und wie ich es als Jungpionier in Friedrichswerth nie schaffte, einen aalglatten Knoten in das blaue Halsband zu bekommen. Am nächsten Tag erzählte ich meinem Kumpel von meinem Traum und so versuchten wir beide uns nochmals Folgendes vor unsere müden Augen zu führen: „Was war denn eigentlich nochmal der Unterschied zwischen einem roten und blauen Halsband?“
Der Amsel schoss es plötzlich, wie kleine Federn vom Haupte fliegend, in sein großes Gedächtnis: „Es gab zwei Arten von Pionieren: Zum einem die Jungpioniere, welchen man ab der ersten bis zur dritten Klasse angehörte und dabei ein blaues Halsband trug sowie zum anderen die Thälmannpioniere, zu denen man ab der vierten bis zur achten Klasse zählte, wobei man ein rotes Halstuch tragen musste.“
„Kannst dich noch an den Pionierausweis erinnern?“
„Klar, hab meinen noch zu Hause.“
„Ich auch“, freute ich mich.
„Da standen doch irgendwelche bekloppten Gebote drinnen? Gä?“ „Weißt auch noch, wie die waren?“
„Hmmm, glaube, die gingen so: Wir Jungpioniere lieben die DDR. Wir lieben unsere Eltern. Wir lernen fleißig und sind diszipliniert. Irgendwie war das doch in dieser Richtung!“ Dabei bemerkte die Amsel gar nicht, dass er diesen Text schon beinah etwas stolz sang. „Ja, haha, kann sein“, lachte ich und sagte kühl: „So versuchte man schon den Schulkindern mit aller Macht den Sozialismus ins Gehirn zu blasen. Einfach Ätzend.“
„Ob den Schulkindern, die wir gestern sahen, auch auf diesem Weg das staatliche System vermittelt und ins Gehirn gehämmert und gesichelt wird?“, fragte etwas besorgt mein Reisebegleiter. „Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ob die auch jeden Morgen stramm zum Fahnenappell in Reih und Glied stehen müssen und dabei „Seid bereit“ und „Immer bereit!“ brüllen müssen? Wir schwiegen und schwelgten beide in unseren kindlichen Erinnerungen …
Nach circa 450 Kilometern und ungefähr zehn Stunden später erreichten wir die größte Stadt Vietnams. „Bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1976 hieß die am Mekongdelta gelegene Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt, zuvor noch Saigon; der Süden Vietnams wurde erst sehr spät von den Vietnamesen erschlossen; dann folgten ja schon etwas später die Franzosen und trugen dort ihren westlichen Stempel oben drauf“, wusste mein Kumpel mir zu berichten. Wir empfanden auch, dass die Stadt bei weitem nicht den Charme von Hanoi hatte und eher einer riesigen Metropole glich, welche sich auch irgendwo anders auf der Welt hätte befinden können. Und so waren wir froh, dass wir nur noch eine Nacht sowie dreiviertel des nächsten Tages Zeit eingeplant hatten, um in ihr ein wenig durch die Gassen zu schlendern. Doch es kam anders. Am letzten Tag wurde mein Kumpan krank und hatte natürlich überhaupt keine Lust auf das Gewusel der Metropole. Deshalb entschieden wir total relaxt, unsere wirklich freie Reise durch die beiden undemokratischen Staaten hinter Gittern ausklingen zu lassen.
Wir spazierten in den Zoo, sahen den armen gefangenen Tieren und ihrem tristen, traurigen Leben zu und stellten wieder einmal fest, wie wahnsinnig gut wir es doch haben. Kurze Zeit später hockte die Amsel mit verschnupftem Schnabel neben mir im Flieger zurück nach Berlin. „Und Johannes, was meinst‘, hast du irgendwie gemerkt, dass wir durch zwei Länder ohne echte Demokratie gefahren sind?“, krächzte die Amsel.
„Hm, schwierig zu sagen, eigentlich nicht wirklich. Ich denke, man muss sich ganz sicher länger in den Ländern aufhalten, um das ernsthaft beurteilen zu können. Vielleicht hättest‘ es aber gemerkt, wenn du einen Pauschalurlaub in einem all-inclusive Hotel gebucht hättest?“
15 Stunden später waren wir zurück im kühlen Deutschland. Der Herbst stand unmittelbar bevor und empfing uns bei elf Grad Willkommenstemperatur. Dabei ummantelte uns eine beinah unangenehme Ruhe. Alles lief geordnet und geregelt ab, kaum einer hupte oder raste im überhöhten Tempo mit einem Moped an uns vorbei. Berlin kam uns beiden in diesen Augenblicken eher so vor, als wären wir in einem Kurort gelandet. Als wir wenig später in meine kleine, dunkle Hinterhofbude einkehrten, fühlten wir uns noch immer etwas fehl am Platz. Ja, ganz offensichtlich fehlte uns das Licht und ich war froh, dass ich am Abend nicht einsam auf der Couch sitzen musste. Aber schon einen Tag später war ich wieder alleine in meiner Höhle, fühlte mich träge und hatte deshalb überhaupt keine Lust, in den verregneten Alltag zu gehen. Es war still um mich herum, da ich den Fernseher und das Radio einfach mal ausließ. Stattdessen setzte ich mich auf die verlassene Couch, starrte auf eine verwelkte Pflanze und beobachtete, wie sie mit gesenktem Kopf im Abseits stand und grübelte: Nächstes Jahr werde ich schon 31! Ist denn spätestens dann die Blüte meines Lebens vorbei? Sollte ich in Zukunft besser auf das Reisen verzichten und endlich so richtig sesshaft werden? Sollte ich mein geliebtes Single-Leben aufgeben und eine Familie gründen? Sollte ich mir endlich einen festen und vernünftigen beständigen Job bis ins Rentenalter hinein suchen?
Der Fernseher blieb aus und auch das Radio schwieg. All diese Fragen beschäftigten mich in diesem Moment sehr und ließen trotz größer werdender Müdigkeit nicht zu, dass meine Augenlider die Klappen senken konnten. Doch wusste ich auf all diese Fragen keinerlei Antwort und zusätzlich durchströmten weitere Gedanken mein melancholisches Gehirn. Ich dachte darüber nach, dass meine Eltern mit 21 Jahren für das erstgeborene Kind Sorge zu tragen hatten und sich kurze Zeit später sogar schon die ewige Treue schworen. Und ich? Ich bin immer noch der Vagabund …
Es vergingen einige Minuten, aber nach dieser Zeit wollte und konnte ich einfach zu keiner der mir selbst gestellten Fragen und auf nur eine dieser mit „Ja, ich will!“ antworten. Damals war es ja auch eine andere Zeit, nuschelte ich etwas lauter als gedacht vor mir her.
Einst gab es ja auch bei weitem nicht jene Möglichkeiten, welche uns in der heutigen Zeit so freiheitlich das Leben verschönern. Schon gar nicht in der DDR. Und wer weiß? Wenn meine Eltern damals die Freiheiten des Verreisens gehabt hätten, ob sie dann ihren gewählten Weg der Vergangenheit gegangen wären? Ich denke eher nicht.
Warum?
Weil meine Mutter und mein Vater im Spätsommer des Jahres 2005 in die wunderbare Toskana nach Florenz zogen, nicht weit entfernt von der berühmten Brücke Ponte Vecchio, etwas auf einem Hügel gelegen und mit sensationellem Blick auf die eindrucksvolle Kathedrale Santa Maria del Fiore, aber immer noch unterhalb des Piazzale Michelangelo, auf welchem stolz der David des Michelangelo auf die großartige Stadt blickt. Darum blickte ich wieder etwas gelassener nach vorne, denn irgendwie stärkten mich diese Gedanken und plötzlich fiel ich mit einem kleinen, schüchternen Lächeln auf meinem bedrückten Gesicht in einen tiefen Schlaf. Und plötzlich war es da — das Jahr 2011. Ich jobbte mal hier und mal da, freundete mich mit dem „Stand Up Paddling“ an und paddelte oft und immer zufrieden durch „Klein Venedig“ unweit des Berliner Olympiastadions. Zweimal besuchte ich in diesem Jahr meine Eltern in der Toskana und bei jedem meiner Aufenthalte merkte ich, wie sehr deren neue Heimat immer mehr zu meiner wurde. Bald wusste ich dann auch endlich eine Antwort auf die Fragen, die ich mir auf der Couch sitzend selbst stellte: Nein, sesshaft will ich noch lange nicht werden! Viel lieber wollte ich weit weg, ans andere Ende der Welt und so entschloss ich mich, die letzte Möglichkeit für ein Ein-Jahres-Visum9 nach Neuseeland wahrzunehmen und beantragte jenen Schriebs.
Es dauerte nicht lange, bis ich das Papier glücklich in meinen Händen halten durfte. Die Vorfreude wuchs, aber ich musste sparen. Freudig stimmte mich die Tatsache, dass ich ab diesem Zeitpunkt wie ein Pfennigfuchser leben musste, natürlich nicht. Denn etwas gönnen konnte ich mir ab diesem Moment nicht mehr und musste oft meinen appetithungrigen Magen mit den wärmenden Gedanken des baldigen Abenteuers fröhlich stimmen.
Das Jahr marschierte inzwischen wieder stramm dem Geknalle an Silvester entgegen und die bisher gesparten Kröten reichten leider nur für das Ticket zum Land der weißen Wolke. Doch immerhin. Ich brauchte jedoch noch ein paar Moneten mehr, um mir nicht gleich am Anfang der Reise einen Job angeln zu müssen. Da ich noch nicht wusste, wie lange ich in Neuseeland bleibe — es könnte ja durchaus sein, dass ich das Ein-Jahres-Visum bis zum letzten Tag ausschöpfen würde — wäre es für diesen ungewissen Zeitraum auch nicht gerade einfach, meine kleine Einraumwohnung unterzuvermieten. Deshalb beschloss ich, meine gemütliche Bleibe aufzugeben, ihren nahezu kompletten Unrat zu verkaufen und den Bonus, also meine Mietkaution, als zusätzliches Reisekapital zu verwenden. Somit war ich für meine Begriffe beinah „reich“, aber besaß nichts mehr. All das erzählte ich mit einem unglaublich befreiten Gefühl der Amsel. Mein Kumpel beendete in diesem Jahr sein Studium und wusste noch nicht so recht, in welche Richtung er nun flattern sollte. Ja, dieser Moment war einfach perfekt für uns beide. Und so entschloss sich die meist unentschlossene Amsel, und das sogar fast spontan, nach Berlin und in mein Nest zu ziehen.
6 veraltet für Thailand
7 Drechsler verarbeiten Werkstoffe wie Steine oder Muscheln
8 traditionelles Segelschiff und Hausboot
9 bis zum 31. Lebensjahr erhielt man einmalig ein solches Visum