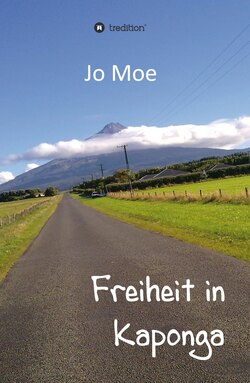Читать книгу Freiheit in Kaponga - Jo Moe - Страница 11
ОглавлениеKapitel 3
Zweite große Reise – Jamaica, Miami, Panama, Peru, Bolivien, Argentinien, Uruguay, Brasilien
Mein Trip begann also erstmal auf einer Insel und sozusagen als Urlaub in einem Hotel. Am 29. Januar 2010 standen mein großer Bruder David, sein hungriger Kumpel Leo und ich vor dem Flughafen in Montego Bay in Jamaica, grinsten über die vielen Ohren hinweg und betonten alle drei zusammen: „Hier sind wir richtig!“
In Deutschland wehte uns noch der kalte winterliche Ostwind unangenehm in unsere Gesichter und deshalb freuten wir uns umso mehr auf die angenehme Wärme. Kaum, dass wir aus dem Gebäude gestolpert waren, stoppten wir unsere Schritte vor einem Van mit dröhnendem Bass und Bob Marley Musik. Die Schiebetüren des Kleinbusses waren weit geöffnet und so hämmerten uns die Töne brachial und lautstark entgegen. Klar, dort stiegen wir ein und ließen uns, es war bereits dunkel, mitten durch lebhafte Straßen, etliche herumturnende Menschen und beinah genauso viele selbst zusammengezimmerte nostalgische Öfen, die qualmend am Straßenrand standen, in die Nähe von Negril ins Hotel chauffieren. Alles wirkte auf den ersten und zweiten Blick sehr chaotisch und es roch nach Gegrilltem. David und Leo hatten sich ein feines, kleines Zimmer in einem Hotel, zum Glück ohne Vollpension, für zwei Wochen gebucht. Ich wurde von den beiden als Untermieter genehmigt, durfte es mir auf dem Fußboden gemütlich machen und bot als Gegenleistung vorm Schlafengehen an, etwas zur Geschichte Jamaicas vorzulesen.
„David, hörst du auch zu? Na gut, dann fang ich mal an. Ruhe jetzt, Jungs!“ Doch schon nach wenigen Sätzen bemerkte ich, dass ihnen die trockene Geschichte wohl zu langweilig wurde, denn sie schlummerten bereits in ihren eigenen Träumen und Erlebnissen. Bald klappte auch ich beide Augen zu, um am kommenden Tag wieder fit für die eigene Geschichte zu sein. Weil wir uns täglich früh morgens nach dem Aufstehen damit abwechselten, einander an die Realität zu erinnern, dass in Deutschland der tiefste Winter herrscht, waren wir einfach daran erfreut, die meiste Zeit über faul im Sand am Strand herumzulungern, oder ließen uns zudem gerne mit einem Taxi durch den Dschungel ins Hinterland hineinchauffieren. Ja, wir hatten viel Spaß und waren eigentlich pausenlos am Grinsen, aber auf der anderen Seite war es unschön, wie wir öfters von den Einheimischen behandelt wurden.
So fühlte ich mich nicht selten völlig verarscht und nicht ernst genommen, was meistens daran lag, dass die Taxifahrer sich an überhaupt keine Abmachung halten wollten. Uns wurde beispielsweise ein gewisser Betrag zu Beginn der Fahrt am Ende meistens für absurd erklärt und beinah jedes Mal wurde uns eine immens höhere Summe als vereinbart in Rechnung gestellt. Wenn wir diese Summe nicht bezahlen wollten, dann wurden die Jungs nicht nur frech, sondern auch böse und wir waren teilweise froh, dass wir es immer schafften, wieder heil aus dem Taxi zu springen.
Weiterhin empfand ich den Umgang der Menschen untereinander nicht gerade als respektvoll und wir bekamen sogar von manch einem Jamaikaner selbst zu hören, dass eine Mutter ihrem eigenen Sohn in Sachen Geldangelegenheiten nicht über einen ehrlichen Weg trauen kann. Folglich war für mich klar, dass ich kein zweites Mal meine Füße auf diese Insel setzen würde, denn schöne Sandstrände gibt es auch anderswo …
David und Leo hatten sich schon in Deutschland dazu entschlossen, mich nach Miami (USA) und bis nach Panama zu begleiten. Die Sicherheitskontrollen am Flughafen in den Staaten mit Fingerabdruck und Co. empfand ich als etwas erdrückend. sie zeigten mir, dass in den USA mit Sicherheit zum Thema Sicherheit ein anderer Wind weht. Nach dem 11. September konnte ich das aber wirklich sehr gut nachvollziehen. Für mich war es das erste Mal, dass ich amerikanischen Boden betreten sollte und irgendwie konnte ich meine Aufregung vor den Jungs nicht versteckt halten. Bei ihnen wuchs ebenso die Vorfreude auf das kurze Vergnügen, denn für uns Bürger aus der damaligen DDR bedeutete die USA eine der liberalsten Nationen dieser Erde schlechthin am anderen Ende des Ozeans, und symbolisierte ein großes Tor in die Freiheit. So empfand ich es als Kind und kaute sehr gerne auf Kaugummis herum …
Dann war es also so weit und wir drei stromerten, jeder mit einem Strohhut — diese Kopfbedeckungen schmückten bereits auf Jamaica unsere Köpfe — auf der Stirn, durch einige der Straßen am Miami Beach entlang. Nachdem wir zwischen all den unechten, affektierten Menschen und Frauen mit überdimensional aufgespritzten Lippen, welche aussahen wie entsprungen aus einem schlecht produziertem 3D-Comicfilm, herumspaziert waren, trafen wir auf mein „Date“. Ich hatte Karina frühzeitig per E-Mail gewarnt, dass ich mit zwei Compagnons unterwegs bin und als sie mich erkannte, begrüßte sie uns zunächst nicht etwa, sondern musste erst einmal einige Lacher los werden: „Wisst ihr, wie ihr ausseht? Kennt ihr noch Sancho und Pancho vom Teich?“ Doch waren wir im Anschluss nicht etwa wegen dieser Bemerkung beleidigt, sondern fühlten uns durch sie nur bestätigt, denn wie wir für die Außenwelt wirkten, das wussten wir natürlich und stimmten in ihr Gelächter mit ein. Nun hatten wir eine weibliche Begleitung, erkundeten gemeinsam die Stadt in einem Bus und darüber hinaus betrachteten wir vom Boot aus spezielle Gegenden, wo die mächtigen Villen von Madonna und anderen Berühmtheiten standen. Sollte das etwa „Magic“ sein?, fragte ich mich, denn Miami wird gern als „Magic City“ betitelt und war ja auch recht ansehnlich, aber in was sich genau der Zauber zeigen sollte, konnte ich auf diesen Wegen noch nicht entdecken. Ich empfand den Moment, da wir mit einem Airboat durch den Everglades National Park rasten und nach schreckhaften Krokodilen in den Mangrovenwäldern spähten um einiges spannender, als mir die Villen von irgendwelchen Berühmtheiten anzusehen. Ja, denn auf solch „Adventures“ hätte ich garantiert verzichtet, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre …
Bereits drei Tage nach der Ankunft in den USA hockten wir schon wieder im Flieger. Panama sollte unser nächstes Ziel sein und ich nutzte die kurze Zeit des Flugs dazu, um etwas zur Geschichte des mittelamerikanischen Landes zu lesen. Wie ich so lesend und eingeengt im Flieger saß, drängte sich plötzlich ein niedlicher Gedanke in mein Köpfchen und stimmte mich sofort fröhlich. Ich dachte an das tolle Kinderbuch „Oh wie schön ist Panama“ und an die niedliche Story, wie der kleine Tiger und der kleine Bär nach Panama reisen. In dem Augenblick musste ich schmunzeln, als ich mich zu David und Leo umdrehte, die zwei Reihen hinter mir saßen, denn einen „Bären“ hatten auch wir dabei. Zunächst kamen wir in der hektischen Megacity namens Panamacity an und nichts war schön. Am zweiten Tag jedoch gerieten wir in einen Karneval und es wurde schon schöner. Wir drei trugen natürlich immer noch, gerade beim Karneval, unsere Strohhüte und fielen zwischen den bunten Menschen nicht mehr ganz so auf.
Am nächsten Tag machten wir uns wieder auf den Weg und wollten dem schweren Treiben am Panamakanal zusehen. Dieser Kanal ist rund 80 Kilometer lang, wurde 1914 von Ingenieuren der US-Army errichtet und verbindet den Atlantik für die Schifffahrt mit dem Pazifik, wobei sich die riesigen Schiffe die Fahrt um das Kap Hoorn an der Südspitze Südamerikas sparen. Dieses Schauspiel, bei welchem die monströsen Containerschiffe millimetergenau durch die Schleuse gelotst werden, war wirklich spannend anzuschauen. Panama hat allerdings durchaus mehr zu bieten als bloß diesen Kanal — ja, diese wirkliche Schönheit des kleinen Landes sollten wir bald leibhaftig erleben.
Dazu folgten wir einem geheimen Tipp, machten es uns auf einem offenen Jeep gemütlich und genossen die Fahrt durch den Dschungel bis zum Ozean. Das Meer aber war noch lange nicht zu sehen, doch plötzlich bremste der kleine Fahrer des Jeeps seinen Wagen abrupt ab, sprang heraus und wir folgen ihm. Nun standen wir umzingelt von echten Indianern und tausenden von lästigen Mücken am Fuße eines kleinen Flusses. Das trübe Gewässer floss träge aus dem Wald und in die andere Richtung führte der Weg des Wassers wieder zurück in die Tiefen des Dschungels. Vom Meer war weit und breit nichts zu sehen und jener Fluss schien vorerst nicht mit dem Ozean verbunden zu sein. In diesem Moment zweifelten wir etwas an dem fantastisch klingenden Tipp, den wir zu Ohren bekamen, denn jene Information, die wir erhielten, meinte wir würden dort auf eine kleine und fast einsame Insel auf dem Ozean stoßen. Die Rede war also nicht von einer Landzunge auf einem Fluss an der Meeresmündung mit eventuellem Meerblick. Einerseits schauten wir danach etwas bedröppelt durch die lästigen Mückenschwärme, aber andererseits war ich richtig happy. Endlich bekam ich echte Indianer zu Gesicht und durfte ihnen dabei zusehen, wie sie sich mit flinken Händen unser Gepäck durch die Mücken zukegelten, bis es sicher am Bug einer kleinen Nussschale landete.
Nach ein paar Minuten sollte es losgehen und so stiegen wir in das mickrig wackelige, ruderbootähnliche Boot. Zuerst folgten wir dem schmalen Fluss am Dschungel entlang, bis nach kurzer Zeit die Größe der Bäume abnahm und wir anschließend dichtes Schilf durchkreuzten. Danach wehte uns zunehmend frischer Wind um die Ohren, bis dann endlich die Sicht auf das erhoffte Meer frei wurde. Juhu, nun schaukelten wir glückselig zwischen größer werdenden Wellen herum, fuhren an winzigen und auf Holzpfählen im Wasser stehenden Indianerdörfern vorbei. Als es wenig später anfing zu regnen, war der sprachlose Mann am Steuer bemüht, alles aus dem Motor herauszuholen und schon ging es in gefühlter Windeseile in der Nussschale und im von allen Seiten spritzendem Wasser Vollgas in die See.
Ab diesem Zeitpunkt war es nicht mehr möglich, sich zu unterhalten und ich erkannte nur noch grimmig grinsende Fratzen hinter dem Regentropfenvorhang. Es wurde deshalb aber so richtig abenteuerlich und dieser Moment sollte in etwa eine gefühlte Stunde so weitergehen. Wir alle hofften trotzdem, dass dieser nasse Spaß bald ein Ende haben würde und hätten nie gedacht, was danach folgen sollte. Denn der Regen nahm nun ab, das Boot schaukelte wieder langsamer durch die Wellen und in weiter Ferne erblickten wir eine kleine Insel. Sollte dieser malerisch schöne Ort, wie einem Bilderbuch entsprungen, etwa wirklich unserer werden?
Etwa zwanzig Meter vor der Insel warf der kleine Steuermann einen großen rostigen Anker ins Wasser und in jenem Augenblick brüllten wir vor Freude. Es war wie in einem Traum. Eine bezaubernde Insel gleich dieser, geformt wie ein winziges eiförmiges Eiland, hatte noch keiner von uns je zuvor zu Gesicht bekommen. Ihre gesamte Fläche konnte man wirklich in drei Minuten zu Fuß umrunden. Bloß ein paar Schilfbuden waren in den Sand gezimmert und wenige Hängematten wogen lässig zwischen Palmen im Wind, sonst nichts weiter.
Tief durchatmen: wer hier nicht entspannen kann, dem kann nun wirklich nicht mehr geholfen werden …
Wir schnorchelten, badeten und schwangen unsere immer leichter werdenden Körper entspannender als entspannt in den Hängetüchern. Zwischen den Erholungsphasen knurrte bloß manchmal der Magen, aber selbst dafür wussten die Indianer liebevoll Sorge zu tragen. Wir brauchten bloß dem hypnotischen Klang zu folgen, welcher von einer großen Muschel erzeugt wurde und schon hockten wir nach einer Minute Fußweg durch den feinen, weißen Sand an einem Holztisch unter einer großen, schattenspendenden Palme. Der frisch gefangene Fisch dampfte bereits essbereit auf dem Teller. Es war einfach wunderschön und wurde sogar romantisch, denn die Abende bei Mondschein, in der Hängematte liegend, in den mit tausenden von Sternen behangenen Himmel zu blicken und dabei dem Meeresrauschen zuzuhören, waren unbezahlbare Glücksmomente. Und es wurde noch romantischer, doch nur für meinen Bruder und Karina, denn an diesem Ort verliebten sie sich.
Nach vier Nächten auf der Trauminsel mussten wir leider wieder zurück in die normale Welt, wo sich auch dann unsere Wege in Panamacity am Fluchthafen trennten. Sancho und Pancho flogen zurück in die kühle Heimat und für Karina und mich ging die Reise erst so richtig los. Wir flogen weiter nach Lima, in die Hauptstadt Perus, die einst als „Stadt der Könige“ bezeichnet wurde, allerdings verpuffte dieser Titel so schnell wie uns schlagartig der Smog dieser Stadt umhüllte.
Nun waren wir zu zweit und irgendwie schlummerte bereits seit dem Zeitpunkt unseres zweiten „Dates“ das Gefühl in mir, dass es zwischen uns vielleicht doch nicht so passen könnte. Es war wahrscheinlich einst beim Wandern über den Weihnachtsmarkt und durch die Mithilfe des Glühweins etwas getrübt worden. Aber wir blieben zusammen, hielten uns zunächst noch zwei Nächte in Lima auf und waren uns dann auch darüber einig, am nächsten Tag in den Bus zu steigen und aus der Stadt rauszufahren. Die rund 1000 Kilometer entfernte Stadt Arequipa, entlang der berühmten Panamericana, sollte unser nächstes Ziel werden. So schön der Name der Route Panamericana wohl klingen mag, der Abschnitt erwies sich in Wirklichkeit als das Gegenteil davon für uns.
Wir fuhren fünfzehn Stunden in einem überfüllten und engen Bus, auf unbefestigten, staubigen Straßen, an wahnsinnig und natürlich nicht gesicherten Schluchten entlang. Mehrere hunderte Meter in die Tiefe würde man stürzen, wenn der Busfahrer auch nur für eine Sekunde einschliefe. Dazu war die Fahrbahn sehr schmal und übersät mit zahlreichen halsbrecherischen Kurven. Aber das war natürlich dem Herrn Buslenker egal, denn er drückte nur so auf sein Gaspedal, bediente bloß kurz vor einer nahenden Kurve nicht etwa seine Bremse, sondern seine Hupe und schoss mit völlig angsterregender Höchstgeschwindigkeit in die Biegung.
Zum Glück passierte uns nichts und es ging weiter und weiter, vorbei an riesigen, wüstenähnlichen Kiesgruben, welche mich eher an Mondlandschaften erinnerten. Und auch die Nazca Wüste, welche die weltberühmten, riesenhaften Tierfiguren, die Nazca Linien, beheimatet, ließen wir in der Dunkelheit der Nacht völlig unbeachtet und in großen Staubwolken an unserer Strecke vorbeiflitzen. Völlig übermüdet und mit noch zu hohem Anteil an Adrenalin im Blut erreichten wir dann endlich „die Stadt, in der man bleiben soll“2. In Arequipa blieben wir zwei Tage und freuten uns, in die Welt der Peruaner eintauchen zu können. Wir fühlten uns dort schon viel besser als noch in Lima und empfanden beide, dass wir eben erst durch diesen Ort in Peru so richtig angekommen waren.
Doch selbst dort wollten uns die manchmal nervigen Taxifahrer ständig irgendwohin chauffieren. Man sollte bei diesem Unterfangen wirklich aufpassen, denn neben den offiziellen Taxis gibt es mehrere inoffizielle und die Fahrer dieser meistens älteren „Mühlen“, so hörten wir, sollen oft kriminell sein. Uns wurde von Fällen berichtet, bei welchen den Touris bis auf die Unterhose alles geklaut worden war. Deshalb sahen wir uns gewarnt und wussten, dass man am besten zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr wachsam sein sollte.
Dennoch wollten wir noch tiefer in die Geschichte der Inkas sowie in die Höhen der Berge vordringen und machten uns auf den Weg in die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches. Cusco ist eine wunderschöne, sehr gut erhaltene, alte Stadt auf einer Höhe von 3400 Metern inmitten der beeindruckenden, größten Gebirgskette der Welt in den Anden. Jene archäologische Stadt wird sehr gerne als Ausgangspunkt für eine Wanderung zur mystischen Ruinenstätte Machu Picchu genommen, weshalb auch wir dorthin wollten. Aber leider gab es vor unserer Ankunft äußerst langanhaltende, heftige Regenfälle, die alle Pfade zu diesem Ort völlig überschwemmten und somit blieb uns die Stadt der Ruinen versperrt.
Darüber waren wir natürlich nicht gerade glücklich, doch für mich sind und waren ja ohnehin berühmte, unbedingt-gesehen-habensollende Sehenswürdigkeiten nicht ganz so wichtig. Außerdem und glücklicherweise bestanden das Reich und der Reichtum der Inkas nicht bloß aus Machu Picchu; das besagte Gebiet hatte einiges mehr zu bieten. Zudem redete ich Karina und mir selbst ein, dass an diesem Ort doch ohnehin viel zu viele Menschen gewesen wären und jene Wesen somit das bestimmt beeindruckende Gefühl inmitten der wunderschönen Landschaft zerstört hätten. „Und die Umgebung ist bestimmt auch toll“, sagte ich und ohne dass wir beide in Unmut verfallen wären, erfreuten wir uns noch am selben Tag daran, einfach dort zu sein und pilgerten durch viele kleine Dörfer in den Bergen. Wir blieben hin und wieder an manch einer Hütte stehen und staunten, denn damit diese eigentlich langweilig aussehenden Bauten aus braunem Lehm nicht völlig in der schönen Natur untergehen, wurden sie öfters mit großen indianischen Figuren liebevoll bemalt. Aber es gab natürlich in dieser Region viele uralte Gebäude aus der Inkazeit, daher lernten wir das sehr reiche archäologische Erbe kennen und schauten stets in einem gesunden Abstand den gelangweilt dreinblickenden Lamas beim Kauen zu.
Diese Tiere gehören in jenen Regionen einfach zu den Menschen dazu und der Zweibeiner wusste schon recht früh, dieses Tier richtig zu schätzen. Dies wird klar, wenn man betrachtet, dass die Ureinwohner bereits 4000 vor Christus mit der Züchtung dieser Vierbeiner begannen. Aber davon wissen diese Getiere natürlich nichts, genauso wenig Ahnung haben sie von der sehr interessanten Geschichte ihres Landes und so setzte ich mich an einem wärmeren Tag ins Gras, in die Nähe einer Lamafamilie und klärte sie auf, indem ich ihnen einiges zur Historie Perus vorlas. „Höret nun gut zu, ihr Viecher“, und ich begann laut vorzulesen. Die Lamas hatten nach den dann doch sehr viel verlorenen Worten von mir die Schnauze voll und gingen von dannen. Auch wir wollten uns wieder auf Achse machen und so begaben wir uns nach herrlichen Tagen im „alten Herzen“ der Inkas auf den Weg nach Puno am Titicacasee.
Bevor wir diese Stadt erreichten, kreuzten wir Julica, den für mich bis dato hässlichsten Ort überhaupt. Er befand sich gänzlich im Rohbau und somit erschien es, als ob sich die Menschen auf einer riesigen Baustelle bequem gemacht hätten. Zwischen den unvollendeten, kleinen und unverputzten grauen Backsteinhäusern ohne Dach standen zudem keinerlei Bäume und auch nach klitzekleinen Grünflächen suchten meine trüben Augen vergebens. Die Unterkünfte hatten meistens bloß eine einzige Etage und eine abschließende Decke, aus welcher meterhoch gen Himmel zahlreiche Metallstangen ragten, welche ein Vorhaben für einen Weiterbau in ferner Zukunft erahnen ließen und mehrere imaginäre Stockwerke versinnbildlichten. Dazu gesellte sich ein kalter Wind, welcher den grauen Staub der Straßen in alle Himmelsrichtungen pustete. Schnell weg hier, dachte ich und so war ich sehr froh, als wir endlich Puno, die Hauptstadt der Folklore, erreichten, welche jedoch ebenso zu einigen Teilen aus den unvollendeten, hässlichen Backsteinhäusern bestand, und das direkt an diesem großen, schönen und heiligen See. Denn die Inkas benannten eben diesen Titicacasee als ihren, der Inkakultur zugehörigen Ursprungsort, und ihn somit zum heiligsten See des Reiches. Außer den traditionellen Schilfrohrbooten fanden wir aber an jenem Platz nichts, was weiter interessant gewesen wäre und einen längeren Aufenthalt gerechtfertigt hätte. Deshalb verabschiedeten wir uns von dort nach nur einem Tag. Stattdessen fuhren wir aus Peru heraus und in Richtung Copacabana. Nein, natürlich noch lange nicht an den Strand von Rio de Janeiro, sondern erst einmal an einen weiteren Platz direkt am Titicacasee, auf bolivianischen Boden gelegen. Vorher jedoch mussten wir uns noch einer langwierigen Grenzkontrolle geschlagen geben. Welch ein perfekter Zeitpunkt, um ein wenig in der Geschichte des kommenden Staats zu lesen.
Chile war schuld. Denn falls die Chilenen während der Zeit des Pazifikkrieges die Küste nicht für sich erobert hätten, so würde Bolivien heutzutage alle geografischen Zonen Südamerikas in einem vereinen können. Unsere erste Station war der beschauliche Ort und von Historikern vermutete Namensgeber für das weitaus bekanntere Copacabana in Brasilien. Aber wir brauchten keinen Beleg dafür und sahen, dass sich im Vergleich zu den kurz zuvor bereisten, noch staubigen Städten auf einmal alles total verändert hatte. Ja, plötzlich war jeglicher Ort sauberer, ordentlicher und auch gemütlicher.
Aus vielen Ecken hauchte uns der lauwarme Wind den Gesang Bob Marleys in die Ohren. Hier war Multikulti angesagt und neben den Indianern schienen sich wohl auch einige Hippies aus den verschiedensten Orten des Planeten in jenes Örtchen verliebt zu haben. Dazu roch es nach einem seltsamen Gemisch aus Marihuana und Popcorn, wovon letzteres zahlreich in übergroßen Säcken auf der Straße angeboten wurde.
Folgte man dann einem gepflasterten Weg bergab und aus der kleinen Innenstadt heraus, so war dort der Strand aus Kies und noch vor der Ankunft an diesem lag als dritter Geruch toter Fisch in der Luft und mischte sich mit den anderen zuvor genannten. Dennoch mochte ich das niedliche und gemütliche Städtchen. Mir gefiel der beschriebene Ort auch deshalb, da ich als Touri dem indianischen Leben der Menschen ganz nah sein konnte und dass trotz der mächtigen Popcornsäcke für die Eindringlinge. Zum Glück wurde aber selbst dadurch der traditionelle Charme (noch) nicht zerstört und das Gute war vielleicht, dass die Ureinwohner kaum Interesse an den Fremden zeigten. Somit konnte ich völlig ungestört dem kunterbunten Leben auf den Straßen zuschauen und fand besonderes Gefallen an den traditionellen, sehr bunten Kleidungen der älteren Damen, die als „Cholita“ bezeichnet werden. Diese bestehen aus einem langen Überrock, mehreren Unterröcken, einem Schultertuch und einem Hut, welcher mich oft an den von Charlie Chaplin erinnerte.
Diese Kluft sah wirklich toll aus und ich beobachtete jedes Mal einen gewissen Stolz in den Gesichtern jener Frauen, wenn sie an mir vorbeiliefen. Die Männer hingegen schienen sich dagegen fast alle an die westliche Welt und dessen langweiligeren Kleidungsstil angepasst zu haben. Zudem legten sie sehr viel Wert auf den Zustand ihrer gebügelten Schuhe, welche sie sich zu allen Uhrzeiten liebend gerne von einem Schuhputzer perfekt stylen ließen. Dabei setzten sie sich gerne auf eine Parkbank, ließen den eifrigen Schuhputzern freies Spiel an der Fußbekleidung und zur gleichen Zeit blätterten sie angestrengt durch die lokale Zeitung.
An den Abenden schlenderten wir meistens an dem kleinen Fischerhafen entlang und ließen uns den frischen Fisch mehr als genüsslich, im roten Plastestuhl sitzend, direkt am See mit Meerblick schmecken. Wir fühlten uns rundum wohl und so sollte ein Weiterreisen erst nach ein paar Tagen möglich werden — jedoch wohin? Das wusste ich noch nicht, aber Karina war sich darüber schon ein paar Stunden sicher, bevor ich es dann überraschend zu Ohren bekam. Wir saßen gemütlich in einem der vielen Fischrestaurants am See und plötzlich verkündete mir meine Reisebegleitung mit einem noch nie an ihr zuvor gesehenen breitem Grinsen, dass uns mein Bruder David besuchen und in ein paar Tagen in La Paz treffen wollte. Die Liebschaft zwischen ihm und Karina war also seit dem Abschied am „Fluchthafen“ in Panama noch nicht für beendet erklärt worden. Sie ging demnach still, leise und über den Ozean hinweg ganz einfach weiter. Natürlich war ich darüber verblüfft, aber freute mich an dieser Stelle, David bald wiederzusehen.
Aus diesem Grund führte uns faktisch der kommende Weg in die Hauptstadt Boliviens. La Paz liegt auf einer Höhe von 3600 Metern und beheimatet den höchstgelegensten Regierungssitz des abwechslungsreichen Planeten. Politiker haben wir nicht gesehen, doch auch ohne sie ging es in dieser großen Stadt wieder so richtig chaotisch zu. Als mein Bruder von uns herzlich in Empfang genommen wurde, hatte er die darauffolgenden Stunden zunächst sehr mit der Höhe von La Paz und der dünneren Luft zu kämpfen. Von daher beschlossen wir, noch zwei weitere Nächte vor Ort zu bleiben. David erzählte uns, dass er uns gerne für die nächsten drei Wochen begleiten wolle und über diese Info grinste ich etwas lauter, denn Karina und ich reisten sowie speisten zwar zusammen, allerdings verstanden wir uns nicht so gut, dass wir vorgehabt hätten, in Zukunft beste Freunde zu werden. Als wir noch zu zweit in Copacabana waren, entluden sich bei mir ein einziges Mal ein paar angesammelte Spannungen, welche ich zwischen Tür und Schwelle eines hellhörigen Hotels einfach aus mir herausbrüllte. Die verblüfften Zuschauer hatten wir in diesem Moment natürlich auf unserer Seite und so raunte ich ihnen leise zu: „Ja, auch Deutsche können Temperament haben“, und knallte die Tür hinter mir zu. Aber schon nach wenigen Stunden empfand ich Karina gegenüber ein schlechtes Gewissen und wir rafften uns wieder zusammen, da keiner von uns beiden das Alleinreisen als Alternative bevorzugte.
In der Höhenlage von La Paz trafen dann drei Meinungen aufeinander, wobei sich natürlich die zwei Liebenden meistens irgendwie uneinig einigten. Überwiegend wurden wir uns aber schon grün und so fassten wir gemeinsam den Entschluss, dass unser nächstes Ziel die 700 Kilometer entfernte Stadt Sucre sein sollte. Nach einer zehnstündigen Busfahrt erreichten wir unseren Bestimmungsort und stellten schnell fest, dass dieser nicht von ungefähr zu einem der schönsten Sehenswürdigkeiten Südamerikas zählt. Das Stadtinnere war bestens erhalten und die Farbe Weiß dominierte den Charakter der Gebäude. Es sah einfach idyllisch aus. Das Flair und die Menschen gaben uns das Gefühl, jeden Schritt, den wir gehen wollten, besser gemächlich voranzuschreiten. Diese Stadt liegt zudem „nur“ noch auf einer Höhe von 2800 Metern, hat deshalb ein angenehmeres Klima und viel bessere Luft als La Paz. Somit erholten wir uns zwei Tage und recht gut von der Großstadt, bis wir uns auf den Weg nach Potosi machten, welche Stadt noch im 17. Jahrhundert wegen des Reichtums an Silber zu einer der mächtigsten der Erde zählte und heute eine alte Siedlung ist, die das Schicksal Lateinamerikas verkörpert. Denn Potosi beweist die traurige Regel, dass jene Städte, welche während der Kolonialzeit zu den reichsten zählten, leider gegenwärtig zu den ärmsten gehören. Doch einst verschaffte das Silbervorkommen diesem Ort einen unheimlichen Reichtum und die Bevölkerung wuchs stetig in die Höhe. Aber durch die Höhenlage von 4000 Meter und durch das karge umgebende Land war an Landwirtschaft überhaupt nicht zu denken. So betrieb man Handel mit anderen Ortschaften, indem man die wertvollen Rohstoffe aus der Mine als Tauschmittel nutzte. Auch heutzutage gibt es noch dieses riesige Bergwerk, wo man einst Silber und Zinn abbaute, allerdings wurde es eher zum Fluch als zum Segen, denn die spanischen Kolonialisten zwangen die Indianer unter menschenverachtenden Umständen zum Abbau der Rohstoffe in den dunklen Höhlen, wodurch dieser Platz zu einem Ort des Todes wurde. Zumindest wussten sich die Indianer zu helfen, indem sie sich die Zeit in diesem beängstigten, eingeengten Ort mit dem Herumkauen auf Cocablättern etwas erträglicher gestalteten, wodurch sie ihr beeinträchtigtes Bewusstsein betäubten und täuschten. Zudem spendeten die Blätter reichlich Energie und die Menschen empfanden kaum Hunger.
Seit etwa 5000 Jahren gehört das Kauen der Pflanzenteile zur indianischen Kultur. Sie werden mit einer Mischung aus Kalk und Pflanzenasche als Katalysator, welches eine kleine weiße Kugel ergibt, zusammen in der Backe aufbewahrt und eigentlich nicht gekaut. Anschließend behält man diese süßliche Masse bis zu zwei Stunden sowie zum Zeitpunkt im Mund, wenn die Wirkung und der Geschmack nachlässt. Auch wir drei würden gewiss mal Lust dazu bekommen, von diesen Wunderblättern zu kosten, aber bevor das passieren würde, sollten noch ein paar Tage vergehen.
Zunächst begaben wir uns auf eine anstrengende, zehnstündige Busfahrt, wobei es wieder einmal durch graue, staubige Mondlandschaften ging, bis wir Tupiza erreichten. Die kleine Stadt erschien uns dabei wie eine Oase inmitten jener kargen Landschaften.
Und trotzdem beabsichtigten wir, nur eine Nacht an diesem Ort zu verweilen, da wir uns spontan dazu entschieden hatten, eine viertägige Jeepfahrt zur „größten Salzpfanne der Welt“ anzutreten. „Jene Salzwüste des Salar de Uyuni ist circa zwölfmal so groß wie Berlin“, wusste David zu klugscheißern.
Am darauffolgenden Morgen versammelten wir uns dann vor einem schmutzigen 4-Wheel-Drive. An dem Fahrzeug lehnte indes ein lustig dreinschauender Bolivianer, der prompt aus seiner lässigen Haltung sprang, als wir auf ihn zusteuerten sowie uns in bester Gentlemen Manier, kurz nachdem er unser Gepäck auf dem Dach des Jeeps verstaut hatte, sogar die Türen öffnete. Anschließend rollten wir vom Acker, vorbei an aktiven Vulkanen, spuckenden Schlammlöchern, leuchtendbunten Lagunen und Landschaften, welche fantastische Kulissen bildeten, indem vereinzelt aufgespickte Felsbrocken im Wüstensand steckten. Ja, jene grandiosen Landschaften waren Inspirationsquelle selbst für die berühmtesten Gemälde von Salvador Dali.
Aus den Lautsprechern des Jeeps knisterte lautstark das Lieblingslied unseres Fahrers. Der aufgeweckte Bolivianer liebte die Skorpions und ganz besonders den Song „Wind of Change“. Meistens versuchte er mitzusingen und nebenbei kaute er ununterbrochen auf seinen ebenfalls geliebten Cocablättern herum. Welch eine Mischung das doch ergab! Für die paar Tage des Ausflugs hatte sich der Skorpionfan einen großen Sack jener Blätter organisiert und freute sich riesig darüber, als David und ich dankend sein Angebot annahmen sowie seine Leidenschaft mit ihm gemeinsam aus dem Sack teilten. Der Geschmack erinnerte mich etwas an grünen Tee, doch er war noch um einiges bitterer und die Wirkung von ihm nicht etwa berauschend, sondern gab mir vielmehr das angenehme Gefühl, welches ich mit „Take it easy“ beschreiben würde. Zudem machte uns die Höhe von um die 5000 Meter wirklich überhaupt nichts aus und irgendwann ließen wir uns auch anstecken und zwitscherten alle zusammen die Songs von den Skorpions.
Wir durchkreuzten die Wüste, erfrischten uns in einer heißen Thermalquelle und übernachteten auf Salzbetten in einem Hotel aus Salz. Auf der Reise bestaunten wir wie angewurzelt und mit müden, leuchtenden Augen einen einzigartigen Sonnenaufgang inmitten von Millionen sechseckiger Salzmuster auf dem ehemaligen Meer. Mit diesen unvergesslichen Bildern machten wir uns zunächst zurück nach Tupiza. Von dort aus ging es einen Tag später und mit großen Erwartungen nach Argentinien. Allerdings waren unsere Erwartungen an dieses Land natürlich überhaupt nicht mit jenen der Eroberer gleichzusetzen, denn die einstigen Invasoren erwarteten damals ein riesiges Vorkommen an Silber. So entstand der Name Argentinien, der aus dem Lateinischen abgeleitet wurde, wobei das Wort „argentum“ Silber bedeutet und jene Annahmen und Wünsche, in diesem Land glitzerndes Silber zu finden, völlig unerfüllt blieben.
Unser erster Stopp nach der Grenze sollte die Stadt Salta werden, aber vorher hatten wir diese freilich noch zu passieren. Der Bus hielt vor der Grenzkontrolle, dann sollten alle Reisenden auch sehr flott den Bus verlassen und den weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. So folgten wir all den anderen Menschen, die scheinbar wussten, wo sie hinzugehen hatten, zu einer entsprechenden Behörde, wo wir uns zunächst in eine lange Schlange einreihen mussten. Danach warteten wir, bis wir endlich an der Reihe waren und freuten uns, als wir schließlich unsere Stempel in die Pässe gedrückt bekamen und somit selbst diese Hürde gemeistert hatten. Alles in allem raubte uns das komplette Prozedere mindestens zwei Stunden unseres Lebens. Anschließend stiegen wir in einen weiteren Bus und waren positiv überrascht von der landschaftlichen Veränderung, die auf uns zurollte.
Ja, wir erfreuten uns daran, endlich aus den hohen Höhen der Berge rauszufahren, denn seit der Ankunft in Arequipa in Peru hatten wir permanent die Luft über einer Höhe von 2000 Metern atmen müssen und seither genügend karge Landschaften betrachten dürfen. Doch irgendwann reichte uns das und so lächelten wir über jede grüne Fläche, die wir hinter den verschmierten Fenstern zu Gesicht bekamen.
Auf einer Höhe von etwas über 1000 Metern in den sogenannten Andenausläufern erreichten wir am Abend und nach mehreren Stunden Fahrt bei strömenden Regen und total zerknittert die Stadt „Salta la Linda“3 Und dieser Name war wirklich Programm, weil nicht nur dieser Ort trotz des miesen Wetters ansehnlich erschien, denn das selbe galt auch für die Damenwelt. Ja, das erkannte ich sofort. Zwischen all den Bussen, den herumrennenden, ankommenden Rucksacktouristen, den hektischen Einheimischen und den riesengroßen, niederprasselnden Regentropfen stand etwas schüchtern am Rande des Bordsteins und vom Regen geschützt unter einem schmalen Dach eine junge, zierliche Frau. Nachdem das Fahrzeug seine Endposition erreicht hatte, sah ich noch, wie sie sich sofort auf unseren Bus stürzte und sich dann die ersten Aussteigenden vorknöpfte. Letztlich verließen wir die letzten Stufen des Fahrzeugs und dann kümmerte sie sich auch um uns. Die breiten Regentropfen klatschten uns ins Gesicht, als wir von ihr angesprochen wurden und sie versuchte, uns ein bestimmtes Backpacker Hostel schmackhaft unter die Nase zu reiben. Und gerade, weil wir von ihr etwas schüchtern und nicht so aufdringlich bedrängt wurden, überzeugte sie uns schnell, wir sprangen mit ihr zusammen in ein Taxi und fuhren in „ihr“ Hostel. Für mich passierte das alles viel zu schnell, denn auf der kurzen Fahrt, auf der wir alle drei Fragen stellen konnten, blieb mir persönlich natürlich überhaupt keine Zeit übrig, die Hübsche in ein tieferes Gespräch zu verwickeln. Ja, tatsächlich war sie das erste weibliche Wesen, das mich bis zu diesem Zeitpunkt der Reise optisch ansprach. Für drei Tage checkten wir in der Herberge ein und in dem Augenblick, als wir an der Rezeption standen und uns ins Gästebuch einzutragen hatten, verabschiedete sich die junge Frau schon wieder und verschwand zurück in den Regen. Irgendwie hoffte ich in diesem Augenblick darauf, dass ich sie wiedersehen würde …
Die nächsten beiden Tage machten David sowie Karina ihr Ding, sie wollten ihre Ruhe haben und sich erholen. Auch ich schlenderte entspannt durch die Stadt, zwischen Orangenbäumen entlang oder nahm mir ein Buch zur Hand. Ich bemerkte dabei auf zahlreichen unterschiedlichen Wegen, dass die Menschen in diesem Ort weitaus freundlicher und zugänglicher als noch in Bolivien waren. Dort gaben sie sich nicht etwa unfreundlich, aber eben doch sehr zurückhaltend und verschlossen. An unserem letzten Abend, bevor wir Salta wieder den Rücken zukehren wollten, veranstaltete das Hostel ein Barbecue mit bestem argentinischem Rindfleisch.
Und während wir am Tisch hockten, lecker speisten und uns mit all den anderen Reisenden unterhielten, spazierte doch plötzlich „La Linda“ zum Grill, nahm sich einen Batzen vom Rost, setzte sich zu uns an den Tisch, warf mir einen flüchtigen Blick zu und unterhielt sich mit Leuten, die sie scheinbar schon kannte. Mit mir kam sie leider nicht ins Gespräch und so quatschte ich mit David über unsere nächsten Reisetage. Wir überlegten, ob wir der Nähe wegen vielleicht einen Abstecher nach Chile machen sollten, jedoch kurz bevor wir in Argentinien ankommen sollten, ereignete sich auf chilenischen Gebiet ein schweres Erdbeben und zwar das sechststärkste bisher weltweit, was seit Beginn der seismischen Aufzeichnung im Jahr 1900 je gemessen wurde.
Das Epizentrum dieses Erdbebens war zwar einige hundert Kilometer weiter südlich gelegen als jene Region, in welcher wir über die Grenze kommen würden; aber es erschien mir nahezu pervers, ein Land zu besuchen, welches gerade wirklich andere Probleme zu bewältigen hat, als den Reisenden ihr eigenes Land fröhlich zu präsentieren … Aus diesem Grund entschieden wir uns dagegen und für Cordoba — jenen Ort, wo einst Fußball-Deutschland bei der WM 1978 die „Schmach von Cordoba“ erlebte.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zum Busterminal von Salta, beobachteten die Menschen und warteten „sehnsüchtigst“ auf unsere zwölfstündige Busfahrt. Das Terminal war kein kleines und so kamen und fuhren ständig Busse in die unterschiedlichsten Richtungen. Überall packten die Leute ihre großen Taschen in die Fahrzeuge und manchmal sah es sogar so aus, als würden sie ihren gesamten Hausrat mitnehmen wollen.
Doch plötzlich erblickte ich etwas viel Aufregenderes: die junge, hübsche Frau war wieder da und flitzte zwischen den Bussen sowie den großen Koffern fröhlich umher. Wenige Minuten später traf dann endlich unser Transportmittel ein, fuhr an seinen vorgesehenen Platz und alle, die mitfahren wollten, strömten ihm hastig entgegen. So auch David und Karina. Nur ich verharrte am gleichen Fleck und überlegte: Sollte ich sie vielleicht wenigstens das eine Mal doch noch ansprechen? Aber was soll das jetzt noch bringen?
Völlig unausgeglichen und von einem Fuß auf den anderen kippend klebte ich dennoch wie angewurzelt in der Ecke und grübelte, bis sie doch tatsächlich auf mich zukam und mir entgegnete: „Na, alles okay? Fährst du nach Buenos Aires oder nach Cordoba?” Und noch bevor ich eine Silbe zustande brachte, bemerkte ich, wie eine eigenartige Aufregung in meinen Körper schoss. Ja, ich freute mich sehr darüber, mich mit ihr zu unterhalten, verriet ihr mit leicht zittriger Stimme meine Destination und sagte danach ohne darüber nachgedacht zu haben: „Hm, ich weiß gar nicht so recht, wie ich das jetzt sagen soll, doch ist schon irgendwie blöd, dass wir jetzt erst miteinander sprechen, jetzt, wo ich weit weg fahre. Es wäre doch viel entspannter gewesen, wenn wir uns beim Barbecue unterhalten hätten, oder?” Während ich all diese Worte über meine Lippen scheuchte, schaute sie mit einem so unbeschreiblich tiefen Blick in mein Gesicht und stimmte mir kopfnickend zu. Aus diesem Grund, weil ich erkannte, dass es ihr ähnlich ging wie mir, traute ich mich zu fragen, ob sie meine E-Mail-Adresse sowie meine argentinische Handynummer haben wolle. Danach nickte sie zwar etwas verlegen, reichte mir aber einen kleinen Zettel plus Stift und ich schrieb ihr schleunigst meine Daten darauf, legte den Zettel schnell zurück in ihre Hände, küsste sie auf eine der beiden weichen Wangen, sagte „Adios“ und rannte zum Bus. Keine zwei Minuten später rollte das öffentliche Verkehrsmittel vom Feld und Vanessa stand winkend auf dem Asphalt.
Nach etwa 1000 Kilometern und 13 Stunden Busfahrt erreichten wir in aller Früh Cordoba. Im Anschluss daran stürzten wir uns in eine etwas nervige Suche nach einer Unterkunft. Dabei rannten wir die halbe Innenstadt ab, stoppten letzten Endes unsere immer träger werdenden Schritte an einem überteuerten Hotel und checkten dennoch für eine Nacht ein. Ja, wir waren uns schnell darüber einig, dass wir in dieser Stadt keine zweite davon verbringen wollten …
Als ich alleine auf meinem Zimmer war, schmiss ich bloß mein Gepäck in die Ecke und haute mich sofort ins Nest. Wie gut das doch tat, einfach mal nur dazuliegen und nichts außer das Spiel der Gedanken zuzulassen. Erst am Abend traf ich die beiden Verliebten wieder und zusammen machten wir uns auf den Weg in ein „Parrilla“4 und aßen „Asado“5. Sowie ich dann endlich mein totes Stück Rind auf dem Teller hatte und darauf herumkaute, klingelte plötzlich mein Handy. Schnell steckte ich die Gabel zurück ins Fleisch, rannte weg vom Tisch, raus aus dem Krach auf die Straße und drückte den entscheidenden Knopf. Am anderen Ende der Leitung piepste mir eine schüchterne Stimme entgegen und wollte wissen, ob ich gut in Cordoba angekommen bin. Es war Vanessa und mit jeder Minute des Gesprächs entwichen noch die letzten kleinen Zweifel aus meiner linken Gehirnhälfte, die ich mir am Tag in den ruhigen Minuten im Hotelzimmerbett zurechtgelegt hatte. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, hüpfte ich zurück zum Rind, das nun kalt auf dem Teller lag und dennoch fühlte ich mich innerlich umso wärmer. Kurz darauf unterbreiteten mir David und Karina ihre Pläne, die sie sich geschmiedet hatten und fragten, ob ich mich ihnen auf den Weg nach Patagonien anschließen wollen würde. Ja, auch ich hatte darüber nachgedacht, weiter in den Süden vorzudringen, da die dortige Natur wirklich wunderschön sein soll.
Deshalb sind wir ja auch hier, oder? Sind das auch unsere Erwartungen an das Land? Aber was ist mit meiner Freiheit? Sie ist mir noch wichtiger! Meine Freiheit ständig vom Weg abzugehen und auch manchmal von meinem eigenen.
Viel länger wollte ich mich jedoch nicht meinen Gedanken hingeben, ließ mich eher von einem Gefühl leiten und wollte schon am kommenden Tag zurück nach Salta fahren. Ich verzichtete damit zugleich auf die fantastische Natur. Ja, der Zeitpunkt war nun endlich da und ich fühlte mich bereit, ganz alleine weiterzureisen. Natürlich kam zudem der Umstand dazu, welchen ich keineswegs bestreiten möchte, dass ich mich als Dritter im Bunde an der Seite von zwei frisch Verliebten, wie das sogenannte fünfte Rad am Wagen fühlte. Genauso empfand ich es und natürlich war das nicht immer angenehm, aber deshalb freute ich mich umso mehr über meine neu gewonnene Freiheit. Als ich schließlich wieder im Bus hockte, erschien mir jenes Mal die dreizehnstündige Busfahrt um einiges länger als zuvor die Hinfahrt. Vielleicht, weil ich den Weg bereits kannte und wahrscheinlich auch deshalb, da ich das Ende schon am Anfang der Fahrt herbeisehnte.
Und dann war es endlich so weit: Vanessa empfing mich am Busterminal und erzählte mir, dass ihre Bemühungen, mich in ein Einzelzimmer ihres Hotels einzuquartieren, erfolgreich gewesen sind. Ich hatte die junge Frau gebeten, mir einen kleinen Wunsch zu erfüllen und ein Einzelzimmer zu organisieren, in dem Moment, als wir telefonierten und ich ihr vorschlug, eventuell zurück nach Salta zu kommen.
Für insgesamt elf Nächte mietete ich mich im Anschluss in eine kleine Kammer mit einem morschen Fußboden ein. Am Tage zeigte mir Vanessa ihre sehr schöne Heimat und hatte großen Spaß daran, sich zwischen ihren Arbeitszeiten mit mir an einen Tisch ins Hostel zu setzen, mir die spanische Sprache näher zu bringen sowie das Mate-Teetrinken schmackhaft zu machen. Und nebenbei bekam ich natürlich auch das echte Leben der Argentinier aus bester, sowie nächster Nähe mit. Ja, all die Zeit mit ihr war wirklich wunderbar. Aber leider verflogen die Stunden in etwa so, wie uns der frische Wind aus den Anden an den Abenden um die Birne wehte und irgendwie entwickelte sich bei mir das Gefühl, und das trotz der umfassenden Zufriedenheit, wieder aufbrechen zu wollen.
Nein, eher war es eine Emotion von ständig kippender Entschlossenheit, weil ich natürlich auf der anderen Seite noch gern ein paar Tage länger bei La Linda geblieben wäre. Es war jedoch klar, dass ich mich ja irgendwann sowieso auf den Weg machen müsste und stellte mir dabei vor, dass der Abschied dann bestimmt noch schwerer als bereits dato werden würde, ja und so siegte zuletzt das Gefühl, mich wieder vom Acker zu bewegen und mich endlich mal ganz alleine ins Abenteuer zu stürzen. Vanessa und ich wollten uns aber, egal wo, auf jeden Fall wiedersehen.
Meine nächste Station hieß jedoch erstmal Buenos Aires. Nach mehreren bereits hinter uns gelassenen Stunden, es machte sich auch schon die angenehme Abendsonne am Horizont bemerkbar, bremste mitten im Nichts plötzlich der Bus ab und dann vergingen einige Minuten, in denen nichts passierte. „Que pasa?“, wusste ich meinen Sitznachbarn noch zu fragen. Allerdings war die Frage völlig sinnlos, denn seine aufgeregte, mit nuscheligem Akzent und hinter seinen schmalen Lippen hervorschmetternde Antwort verstand ich überhaupt nicht. Kurz darauf erhoben sich die vielen Menschen aus ihren Sitzen und verließen alle das Fahrzeug.
Ach klasse, danke für eure hilfsbereite Info …
Dennoch schloss ich mich ihnen an, stieg als Letzter aus der oberen Etage des Busses die engen Treppen hinunter und stand anschließend mitten in der Pampa. All die anderen Mitreisenden hatten sich eng um das Gefährt herum versammelt und beobachteten das Geschehen am Busheck. Dort entdeckte ich eine große Klappe, die weit geöffnet war sowie zwei Beine, die davor standen und die andere Hälfte des Körpers durchsuchte etwas im Inneren des Busses. Ich war neugierig, spazierte näher heran und erkannte den Herrn Busfahrer, der mit feuerrotem Kopf auf den dampfenden Motor trommelte.
Na, Prost Mahlzeit, ob wir hier heute noch weg kommen?
Ich hockte mich besser ins Gras, als den Schaulustigen zu spielen und erfreute mich lieber daran, in nicht allzu weit entfernter Ferne ein paar Gauchos dabei zuzusehen, wie sie wild ein paar Pferde zu zähmen versuchten. Damit verbrachte ich meine Zeit, die so irgendwie verging und die Sonne hatte sich schon längst wieder in den Feierabend verabschiedet, bis plötzlich ein heller Lichtstrahl auf unsern Doppeldecker zusteuerte. Ja, wir hatten Glück, denn nach knapp dreistündiger und ungewisser Pause, es war nicht klar, ob und wie es denn weitergehen würde, wurde uns ein Ersatzbus bereitgestellt und somit konnte die Reise schließlich doch noch fortgesetzt werden. Nach knapp zweistündiger Fahrt drosselte der Buslenker jedoch schon wieder sein rasantes Tempo. Inzwischen war es tiefschwarze Nacht und im Bus-TV lief tatsächlich gerade der Film „2012 – Das Ende der Welt“.
Was ist denn nun schon wieder los?
Schließlich hielt der Bus und dieses Mal auch sehr abrupt an. Danach wurde es laut und jeder kramte in seinen persönlichen Sachen umher. Letztlich erkannte selbst ich den Grund dafür – es robbte sich ein Mann die Treppen empor, schaute mit ernster Miene unter seinem Polizeihut hervor und schnaufte mit scharfem Ton: „Control policial!“. Die Polizeikontrolle dauerte knapp eine Stunde und nach abenteuerlicher dreiundzwanzigstündiger Busfahrt erreichte ich endlich die Hauptstadt Argentiniens sowie anderthalb Stunden später auch mein Hostel.
Während ich noch auf der Suche war und mich mit Bus und zu Fuß nach dem Weg erkundigen musste, bemerkte ich, dass die Menschen in jener Stadt um einiges unfreundlicher waren als in den zuvor bereisten Gebieten des Landes. Eigentlich sind ja die Leute überall auf unserem Planeten in den Hauptstädten sowieso etwas speziell. So werden die Bewohner von Buenos Aires vom Rest des Landes mit „Porteño“ (Hafenmenschen) tituliert und gerne wird, unter anderem aufgrund der multikulturellen Identität des Porteño, behauptet, dass er ein Italiener sei, der spanisch spricht, sich wie ein Engländer benimmt und glaube, Franzose zu sein.
Buenos Aires wird des Weiteren gerne als das „Paris Südamerikas“ bezeichnet, da die Kultur und die zahlreichen Museen sowie Theater das Bild der Stadt sehr europäisch aussehen lassen. Andererseits wird sie gern als „Metropole der Leidenschaft“ bezeichnet und das nicht nur wegen der fanatischen Liebe zum Fußball sowie der Hingabe beim Tangotanzen, sondern auch wegen der fast täglich stattfindenden, politisch sehr engagierten Demonstrationen. Weil mir aber zu dieser Kunst des Bewegens die richtige Tanzkollegin fehlte und zudem keine Demo geplant war, wollte ich wenigstens und unbedingt live bei einem Fußballspiel dabei sein und ich hatte Glück! Einen Abend vor einem Spiel des Vereins „River Plate“ hockte ich entspannt auf einer Parkbank inmitten der Innenstadt und schaute dem Treiben der Leute zu, bis zwei Mädels auf mich zukamen und sich neben mich setzten. Schnell kamen wir ins Gespräch und ich erzählte den beiden Mexikanerinnen davon, dass ich mir für den kommenden Tag vorgenommen hatte, ins Stadion des genannten Fußballclubs zu gehen und da die beiden auch Fußballbegeistert waren, fragten sie mich, ob sie mich begleiten dürften. Gemeinsam machten wir uns also dann auf den Weg zum Spiel und bereits dabei stellte ich fest, dass die Fußballfans an diesem Ort auf jeden Fall noch um einiges fanatischer ihren Fangesängen auf den Straßen nachgingen, als wir das in Deutschland gewohnt sind.
Mit dem Erreichen des Stadions reihten wir uns in eine lange Schlange ein, warteten darauf, bis uns die Polizisten, die vor den Eingängen platziert waren, ebenfalls stoppen würden und hatten schließlich, wie alle anderen bei einer Alkoholkontrolle, in die entsprechende Maschine zu pusten. Eigentlich ist das eine spitzen Idee, denn so vermied man, dass betrunkene Vollidioten im Stadion Stunk machen konnten, während es ja auch dort selbst keinerlei alkoholische Getränke zu kaufen gab. Trotzdem herrschte ein richtiges Fußballfest auf all den Rängen und die Stimmung sowie die durchgängigen Gesänge der Fans waren fast noch spannender als das Spiel selbst.
Die kommenden Tage verbrachte ich hauptsächlich in dem schönen Künstlerviertel von San Telmo, wo mein Hostel war und genoss das spannende Großstadtflair. Am liebsten wäre ich im Anschluss daran auf dem Boden geblieben, jedoch hatte ich im Vorfeld meiner Reise ein paar Flüge festlegen müssen und weil mich der Flug von Buenos Aires nach Montevideo quasi nichts kostete, entschied ich mich für diesen Weg, aber ich ärgerte mich dann ein wenig, als ich im Flieger hockte und wegen der luftigen Höhe nicht viel von der Landschaft unter mir hatte und schnappte mir deshalb die Zeilen zur Geschichte Uruguays, der „Schweiz Südamerikas“. Doch die wenig gelesenen Zeilen stimmten mich nicht recht zufrieden, denn für mich blieben noch zwei Fragen offen: Wer hat die Kolonialherren vertrieben? Und warum spricht man heute Spanisch und nicht Portugiesisch? Da ja die Kolonialherren doch womöglich von den Portugiesen und höchstwahrscheinlich nicht von den waffenlosen Indianern vertrieben worden sind?
Die Geschichtsschreibung erschien mir also recht lückenhaft und machte mich etwas nachdenklich, viel Zeit zum Nachdenken hatte ich indessen in der kurzen Flugzeit von weniger als 45 Minuten nicht. Während ich am Band des Flughafens von Montevideo auf mein Gepäck wartete, dachte ich daran, dass ich genau sieben Tage Zeit haben würde, jene ungeklärten Fragen eventuell bestenfalls von Einheimischen zu erfahren.
Die uruguayische Hauptstadt liegt ganz interessant, da ich, egal in welche Richtung ich pilgerte, immer irgendwie am Ende der Gassen das Meer erreichte. Und so wie ich von einer zur nächsten Ecke durch die Stadt spazierte, bemerkte ich, wie erstaunlich ruhig es an diesem Ort war im Kontrast zu all den anderen südamerikanischen Städten, in denen ich zuvor meine Füße auf den Asphalt gesetzt hatte.
Irgendwie erschien mir die Stadt wie ausgestorben zu sein — auf der anderen Seite waren die Menschen, denen ich dort begegnete, wieder etwas freundlicher als die in Buenos Aires. Das einzig Spannende, was Montevideo wenigstens ein bisschen Charme verlieh, waren die alten Autos, welche nur deshalb noch existierten, da es lange Zeit im Land sehr hohe Einfuhrzölle gab und somit kaum Fahrzeuge aus dem Ausland importiert werden konnten.
Diese Information erhielt ich von einem Einheimischen, mehr leider nicht … Am liebsten hätte ich mir eines dieser alten nostalgischen Autos geschnappt und wäre einfach drauflosgefahren. Jedoch blieb es bei diesem Wunschgedanken und so suchte ich nach einer Alternative und stieg in einen Bus in das rund 50 Kilometer entfernte Badeörtchen Atlantida.
Die Landschaft, die auf der Fahrt am Fenster vorbeikroch, ähnelte sehr der Pampa in Argentinien. Doch überdies umgab mich nach der Ankunft in dem Ort beinah eine merkwürdige Totenstille. Er war zwar ganz gemütlich, allerdings waren die wenigen Zimmer, in denen in jener Nebensaison ein Platz zum Schlafen angeboten wurde, für meine Begriffe viel zu teuer. So entschied ich mich, am Abend wieder zurück in die Hauptstadt zu fahren, checkte anschließend in dasselbe Hotel ein und suchte zum Abendessen mein „Stammlokal“ auf, um mir ein paar angenehme Gedanken über meinen weiteren Weg zu machen.
Und wer hockte dort ganz blass in der Ecke und freute sich, mich zu sehen? Der Kieran aus Australien, der gerne Coca Cola trank. Wir hatten uns in den Anden in Peru kennengelernt und zusammen eine beeindruckende Wanderung unternommen. Nun saß er völlig unverhofft in „meinem“ Lokal und nippte munter an seinem warmen Matetee.
„Was ist los mit dir? Bist du krank?”
„Ehm nö, warum?“, fragte er mich leicht verwirrt und so zeigte ich auf sein Getränk, an dem er nippte und dann lachte auch er. Zunächst unterhielten wir uns über unsere vergangenen Reisewege, bis Kieran meinte, dass er für die kommenden Tage vorhatte, in Montevideo bleiben zu wollen.
„Was, echt? Ist doch wirklich langweilig und irgendwie trostlos hier, oder? Findest’ nicht?”
Irgendwie schaffte es Kieran jedoch, im Laufe des Abends und bei der gemütlichen Stimmung um das Heißgetränk herum, mich umzustimmen und so machten wir uns für die nächsten drei Tage gemeinsam ein lustiges Dasein in der wahrscheinlich langweiligsten Hauptstadt der Welt. Aber was war mit meinen Fragen? Was war mit meinem Wunsch das Land sehen zu wollen?
Ich musste schließlich erkennen, dass all das in nur einer einzigen Woche Aufenthalt einfach nicht umzusetzen sein konnte! Oder wäre es doch irgendwie möglich gewesen, wenn ich Kieran nicht getroffen hätte? Ein wenig dachte ich noch darüber nach, doch wurde gleichzeitig von einem angenehmen Gefühl überrumpelt, dass mir die Erkenntnis brachte, mich niemals hetzen zu lassen, schon gar nicht von mir selbst: Ich muss nicht alles sehen und schon gar nicht dann, wenn ich viel zu wenig Zeit dafür habe. Viel lieber möchte ich mich einfach treiben lassen. Und wenn mich dann jemand in der Heimat fragen sollte, was die Menschen und das Land Uruguay denn eigentlich ausmachen würden? Dann muss ich eben ehrlich zugeben, dass ich mir darüber kein Urteil erlauben darf.
Ich mag es nicht, wenn jemand überschnell urteilt, gerade diejenigen, welche vielleicht nur eine Woche Urlaub in ihrer gebuchten Hotelliege am Strand verbracht haben, sollten sich eine derartige Bewertung verkneifen. Wie kann man unter solchen Umständen schon erzählen, man würde etwas über Land und Leute in Erfahrung gebracht haben?
Der Herbst wehte mit immer größeren Böen durch die Gassen der Stadt und deshalb freute ich mich umso mehr auf die Sonne sowie das Meer in Brasilien, weshalb ich mich frohen Mutes und flotten Schrittes auf direktem Weg zum Flughafen nach Rio machte. Als ich dann im Flugzeug hockte, überkamen mich einige Gedanken sowie ein paar Gefühle und ein Empfinden rückte dabei schnell in den Vordergrund — das Gefühl, in den letzten Tagen etwas vermisst zu haben. Ich sehnte mich, so merkwürdig es vielleicht klingen mag, nach dem Fremdsein. In Buenos Aires und ganz besonders in Montevideo fühlte ich mich Deutschland schon wieder viel zu nah gekommen. Das lag natürlich daran, dass der indigene Anteil der Bevölkerung in Argentinien und besonders in Uruguay der geringste in Südamerika ist, aber in Brasilien sollte sich das wieder ändern. Deshalb beglückte mich der Gedanke, in diesem Land wieder eine völlig andere Kultur anzutreffen und ich machte mich im Anschluss über diese etwas schlau.
Sobald ich mir ein für mich zufriedenstellendes Bild zur Geschichte des Landes gemacht hatte, klappte ich das Buch wieder zu, kippte meinen Sitz verpflichtend in die aufrechte ungemütliche Position, spürte bereits, wie es „bergab“ ging und wartete darauf, dass die Räder sanft auf dem Boden aufsetzen würden. Ja, noch immer flog die Flugangst mit mir mit und besonders bei der Landung überkommt mich jedes Mal ein ungutes Gefühl.
Als ich dann dem Flughafen in Rio den Rücken zugekehrt hatte, wurde mir an der Bushaltestelle in die Stadt gezeigt, dass ich fortan mit meinen spanischen Wortlauten nicht mehr weit kommen würde. Ich wusste zwar um die Ähnlichkeit zwischen Portugiesisch und Spanisch, aber dass die Leute mich überhaupt nicht verstehen würden, ja, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Doch ich wollte es ja schließlich so, heißt, mich wieder völlig fremd fühlen, und so fand ich mich dann mit der kleinen Odyssee aus Busfahrten und ziellosem Herumgerenne auf dem Weg zu meinem Hostel einfach mit einem dauerhaft-über-mich-selbst-Grinsen damit ab.
Schweiß überströmt, aber glücklich stand ich irgendwann vor einem unscheinbaren Häuschen in einer ruhigen Nebenstraße. Zwischen saftig grünen Bananenstauden beobachtete ich ein paar kleine Äffchen, die zwischen den Bäumen hin und her sprangen und mich zu begrüßen schienen. Was war das noch für eine komplett andere Welt wenige Stunden zuvor?
Da die Preise hier im Vergleich zu Uruguay wieder bedeutend höher lagen, war ich gezwungen, mich in einem Sechsmannzimmer einzuquartieren. Die kommende Nacht blieb ich hingegen zum Glück der Einzige im Zimmer und schlief trotz der fehlenden Klimaanlage hervorragend. Am nächsten Tag zog es mich als Erstes an den lebhaften Strand von Copacabana, wo fast jedes einzelne Sandkorn von einem Menschen bedeckt wurde. Dazu fiel mir auf, wie sportbegeistert die meisten der dortigen Besucher waren. Ob auf joggende Weise, mit einem Ball in der Hand oder am Fuße — es schien kaum einen zu geben, der nicht in irgendeiner Form in Bewegung war und auf dem Weg zum Strand bemerkte ich einige Fruit-Imbisse, bei denen man sich mit zahlreichen gesunden Shakes und Müslis der verschiedensten Arten regelrecht zuschütten konnte. Also alles in allem legten die Menschen großen Wert auf Äußerlichkeiten und schienen sich außerdem in der Mehrheit bewusst zu ernähren. Ja, an diesem Ort fühlte ich mich richtig wohl und verbrachte ganz entspannt, öfters mit einem Fruit Shake in der Hand, die nächsten Tage an den beiden lebendigen Stränden von Copacabana sowie Ipanema. In meinem Hostel herrschte ein kunterbuntes, ansteckendes Treiben, so dass es mir sehr einfach gemacht wurde, ein paar nette Jungs kennenzulernen, mit denen ich an so manch einem Abend in kultigen Bars sacken blieb oder wir am Tag viel Zeit zusammen am Strand verbrachten. Aber das Highlight war definitiv der Besuch des Fußballendspiels der „Copa Libertadores de America“. Das ist ein Wettbewerb, der in etwa vergleichbar mit der Champions League in Europa ist.
Bei strömendem, sintflutartigem Regen spielte der Club „Flamengo“ aus Rio gegen die „Corinthians“ aus Sao Paulo. Der Regen war an diesem Tag so heftig gewesen, dass sich innerhalb von kürzester Zeit mehrere kleine Teiche auf dem Rasen gebildet hatten. In Europa hätte man ein Spiel unter solch katastrophalen Bedingungen längst abgepfiffen, denn somit litt die Technik und natürlich das komplette Match enorm. Doch ich hockte ja im alten Maracana-Stadion in Rio de Janeiro und nicht in der Rhein-Neckar-Arena in Hoffenheim.
Die hartnäckigen Regentropfen schafften es nicht, die tobende sensationelle Stimmung im Stadion niederzutrommeln. Ja, die Atmosphäre war trotz alledem sehr beeindruckend. Nicht nur durch den Besuch des Stadions, sondern darüber hinaus im Allgemeinen durch das lebendige Leben in der Stadt sowie in den Straßen wurde meinen neuen Kumpels und natürlich auch mir die Zeit gehörig versüßt. So war es nicht verwunderlich, dass wir gemeinsam insgesamt zehn Tage am Zuckerhut verweilten. Aber dann war die Zeit wieder reif, um aufzubrechen und mich weiter alleine auf den Weg zu machen. Ein Bus brachte mich nach Angra an den Hafen und von dort aus schipperte ich mit einem kleinen, wackeligen Boot zur Insel Ihla Grande. Dort angekommen und in dem Moment, als ich über den klapprigen Steg zum Ufer torkelte, merkte ich sofort, dass dieser Schritt genau der richtige war. Ich war wieder umgeben von fantastischer, grüner Natur und wenigen Menschen; den Wechsel empfand ich zu diesem Zeitpunkt als einfach genial. Anschließend spazierte ich in den kleinen Fischerort, suchte und fand dort ein gemütliches Zimmer mit Kühlschrank sowie TV und das für gerade mal umgerechnet zwanzig Euro.
Am ersten Tag reichte es mir, faul an einem Strand in der Nähe des Hotels im Sand zu liegen, jedoch für den nächsten Tag hatte ich mir vorgenommen, zehn Kilometer quer durch den Dschungel und über die Insel zu einem anderen schöneren Strand zu wandern.
In meiner Unterkunft erhielt ich eine bunte Karte von der Insel und startete ganz gemütlich nach der beißenden Mittagssonne mit Flip-Flops an den Füßen bei aber noch immer sehr hitzigen Temperaturen in den Urwald. Nach circa zweieinhalb Stunden erreichte ich einen wirklich wundervollen sowie dazu noch menschenleeren Strand und ärgerte mich etwas darüber, dass es schon gegen fünf Uhr nachmittags zu dämmern anfangen würde, was bedeutete, dass ich nur etwa eine gute Stunde Zeit für eine ordentliche Abkühlung hatte. Nachdem ich frisch und munter wieder zurück aus dem Wasser war, in alle Richtungen blickte sowie noch immer keine Menschenseele weit und breit zu sehen war, blieben mir ein paar Minuten zur Erholung übrig. Ich schlüpfte aus der nassen Badehose und legte mich auf den Bauch. Viel fehlte nicht und ich wäre bei dieser herrlichen Ruhe beinah eingeschlafen. Doch plötzlich schmetterten mir zwei tiefe und böse klingende Stimmen in meine sensiblen Ohren und rissen mich gehörig aus der Schlummerphase. Erschrocken fuhr ich hoch, zog instinktiv die Badehose über meinen Unterleib und blickte in die Gesichter von zwei Männern in Uniform, die sich breitbeinig, wie zwei Gockel, vor mich aufplusterten und mich anbrüllten.
Was geht mit euch?, dachte ich und dennoch begriff ich recht schnell, was sie von mir wollten. Es war nämlich verboten, nackt im Sand an einem einsamen Strand zu liegen. Kopfschüttelnd kroch ich in meine Klamotten und verschwand verärgert in den Urwald. Der Rückweg wurde dabei zu einem weitaus größeren Abenteuer als der Hinweg, denn ich hatte nichts mehr zu trinken und zudem begann es allmählich dunkel zu werden. Aber irgendwie schaffte ich es und das auch ohne Nachtsichtgerät zu meinem Hotelzimmer zu gelangen.
Die nächsten zwei Tage verbrachte ich mit einem geliehenen Brett auf dem Wasser und bei sehr guten Surfbedingungen. Da ich aber noch mehr von Brasilien sehen wollte, entschied ich mich trotz der Stille und Gelassenheit dazu, die Insel wieder zu verlassen und musste wieder nach Rio, da womöglich alle weiteren Wege über diese Metropole zu gehen schienen.
Als ich dann zunächst zurück auf dem Festland war, wartete ich am Hafen auf einen Bus. Ich schwitzte und sehnte mich schon nach einer kalten Dusche, bis mich plötzlich ein kräftiger Mann aus meinen Gedanken riss. „Wo willste denn hin?“, fragte er mich nicht gerade freundlich, doch in einigermaßen verständlichem Englisch und so erzählte ich ihm von meiner Route nach Rio. „Ok, aber der Bus, auf den du wartest, kommt erst in zwei Stunden. Das ist hier in Brasilien so, dem Zeitplan dort auf dem Schild kannst du nicht glauben.“ Aber dir soll ich glauben oder was?, dachte ich und sagte allerdings eher gelangweilt: „Jaja, ich weiß schon, wie das hier läuft.“ Und was willst du jetzt von mir? Und kaum, dass ich das gedacht hatte, beantwortete er mir meine gedankliche Frage. „Willste mit mir kommen, dort, das ist mein Auto und ich fahre auch nach Rio!“ „Aha, zeig, welches Auto meinste denn?“
Danach folgte ich ihm zu seiner Kutsche und erkannte, dass bereits zwei Männer ungeduldig auf den Startschuss warteten, was mich normalerweise sofort davon abgeschreckt hätte, überhaupt nur daran zu denken, dort zuzusteigen. Andererseits verriet mir mein zweiter Blick, dass die Jungs höchstwahrscheinlich keine Komplizen vom Fahrer sind, sondern eher gewöhnliche Reisende wie ich. Aus diesem Grund und weil ich noch weniger Lust verspürte, auf einen Bus zu warten, der womöglich gar nicht kommt, und obwohl mir der Typ eigentlich überhaupt nicht sympathisch war, verhandelte ich kurz über den Preis und stieg anschließend in die Schweißhütte. Ein wenig mulmig war mir dabei trotzdem, denn falls die drei Typen doch unter einer Decke stecken würden, hätte ich natürlich keinerlei Chance, glimpflich davon zu kommen … Zum Glück lief alles glatt.
Zurück in der Metropole musste ich den Weg zum Busbahnhof finden, um von dort aus in die rund 100 Kilometer entfernte „Landeshauptstadt des Surfens“ zu gelangen. In Saquarema, so wurde mir mehrfach berichtet, würde ich beste Surfbedingungen vorfinden und sollte in den darauffolgenden Tagen das Glück haben, live bei einem internationalen Wettkampf dabei sein zu können. Doch noch war ich nicht dort, musste mich abermals an einer Bushaltestelle gedulden und mich der manchmal quälenden Zeit des Wartens geschlagen geben, bis endlich ein Bus auftauchte, dessen Endhaltestelle sogar Saquarema anzeigte.
Wenig später schaute ich mit etwas müden Augen durch die Scheibe, auf die vorbeiziehende Landschaft und fiel mit jenen beruhigenden Gedanken, dass ich Saquarema ja gar nicht verpassen kann, da dies ja ohnehin die letzte Haltestelle der Busfahrt sei, in einen leichten Schlaf. Nachdem ich jedoch später meine trägen Augen wieder öffnete und kurze Zeit darauf der Bus hielt, war ich nicht in dem angesteuerten Ort gelandet, sondern circa 30 Kilometer weiter weg in Araruama …
Der Busfahrer verstand natürlich nicht, was ich von ihm wollte und machte mir bloß deutlich, dass er Feierabend hätte und ich den Bus verlassen sollte. „So ein dämlicher Mist aber auch“, hörte ich mich sagen, schleppte nach nur wenigen Sekunden des Ärgers meine Rucksäcke durch die Menschen und erkundigte mich, welcher Bus von wo aus zurück nach Saquarema fahren würde. Es sollten einige Minuten vergehen, bis eine nette Dame der englischen Sprache ausreichend mächtig war und mir zu verstehen gab, dass genau das Fahrzeug, mit welchem ich angekommen war, die gleiche Strecke, also über Saquarema, zurückfährt. Allerdings müsste ich dazu noch zwei Stunden warten, woraufhin ich mich etwas ins Abseits hockte, die Menschen beobachtete und mich mal wieder so richtig fremd fühlte. Ja, ich war das einzige Bleichgesicht weit und breit.
Nachdem ich dann wieder in den gleichen Bus gestiegen war, erreichte ich nach knapp fünfundvierzig Minuten Saquarema. Es war bereits dunkel und ich hatte mir im Vorfeld noch keine Unterkunft organisiert, da ich davon ausging, dass ich ganz entspannt bei Tageslicht ankommen würde und somit in Ruhe nach einer vernünftigen Herberge Ausschau halten könnte. Zu meinem Pech stand glücklicherweise ein einziges Taxi an der Bushaltestelle und bei dem Fahrer, der zum Glück etwas Englisch sprach, erkundigte ich mich nach einer Bleibe in der Nähe. Er schien meinen Wunsch verstanden zu haben und brachte mich nach wenigen Minuten Fahrtzeit zu einem Pousada. Diese Unterkunft sollte die einzige sein, in welcher ich so spontan noch ein Zimmer bekommen könnte, betonte er. Dann bedankte ich mich, zahlte den geforderten Preis, stieg aus seinem Wagen und klopfte anschließend an die Haustür. Der ältere Herr, der mir nach mehrmaligem Pochen letztlich öffnete, lugte etwas müde an der halboffenen Pforte vorbei und meinte, dass es lediglich einen Raum gäbe, aber dass der Preis dafür pro Nacht bei rund 60 Real liege. Nein, das war mir entschieden zu teuer und ich marschierte wieder davon.
„Mann Mann Mann, jetzt reichts langsam wirklich!“ Ich rannte etwas ziellos in der Dunkelheit umher, entdeckte jedoch keine einzige Unterkunft. Und weil ich inzwischen die Schnauze gestrichen voll hatte, entschied ich mich dazu, ohne weiter darüber nachzudenken, an der Tür eines bereits verschlossenen Restaurants zu klopfen in der Hoffnung, dass der Besitzer eventuell ein paar Brocken Englisch sprechen würde und mir damit weiterhelfen könnte. Wenige Sekunden vergingen, bis mir ein jüngerer Mann die Tür zur Gaststätte öffnete und mich etwas verdutzt von oben bis unten musterte. „Hello, ich hoffe, du sprichst Englisch und weißt vielleicht auch, wo ich noch eine Unterkunft finden kann?“ Erfreulicherweise schien er zumindest jene Worte verstanden zu haben und sagte daraufhin einfach nur: „Wait!“ Dann versperrte er kurzer Hand den Eingang vor meiner Nase einfach wieder. Völlig gefühllos blieb ich stehen und starrte auf die verschlossene Tür, bis er diese nach nur zwanzig Sekunden erneut öffnete und brüllte: „Come on!“
In diesem Augenblick schaute ich ihm mehr als verdutzt hinterher, aber folgte dennoch gutmütig seinen Schritten zurück auf die Straße und zu seinem Auto. „Kennst du ein Hostel oder ähnliches?“, fragte ich ihn nochmal etwas schüchtern. Daraufhin nickte er stolz und ich stieg wie eine angeschossene Marionette in seine Karre und er zündete den Motor. Nach nur fünf Minuten Fahrt erreichten wir ein Haus mit einem leuchtenden Schild, dem Schriftzug und den für mich äußerst aufbauenden Worten „Hostel“. Der junge Mensch stoppte nun abrupt seinen Wagen, grinste freundlich und ließ mich wissen, dass er auf mich warte, falls mir keiner aufmachen würde. Dann drückte ich ihm ein paar Münzen in die Hand, weshalb er sich glücklich bedankte. Anschließend trabte ich an die Haustür, klopfte vorsichtig und noch bevor ich zum zweiten Mal meine Faust ansetzen wollte, riss blitzartig eine Dame die Tür auf, so als hätte sie förmlich auf mein Erscheinen gewartet und begrüßte mich. „Hätten Sie noch eine Möglichkeit für eine Übernachtung?“ Ja, das hatte sie und ich fühlte mich in dem Moment irgendwie gerettet, drehte mich nochmal zu meinem Fahrer um, streckte ihm meine beiden Daumen nach oben und folgte der Frau in den Hof. An einem kleinen Häuschen zückte sie ihren großen Schlüsselbund und öffnete den Eingang zu einem Zimmer mit fünf Betten ohne Bewohner. Überglücklich ließ ich mich kurze Zeit später in eines der Betten fallen und sackte nach wenigen Sekunden in einen tiefen, friedlichen Schlaf.
Am nächsten Morgen lernte ich Renato aus Südbrasilien kennen, einen der Hauptakteure beim kommenden Surf Event, den ich in den folgenden Tagen vom Strand aus anfeuerte. Für meine „Unterstützung“ bedankte er sich und legte mir ans Herz, nach Buzios weiterzureisen. Er schwärmte geradezu von diesem Fleckchen, denn dort sei, so meinte er, einer der schönsten Strände von Brasilien beheimatet und weil ich noch überhaupt nicht wusste, wo ich mich nach der Reise nach Saquarema hinbewegen wollte, folgte ich seinem Tipp. Einen Tag später machte ich mich auf den ziemlich umständlichen Weg und das mit drei unterschiedlichen Bussen über Capo Frio, unter sehr freundlicher Mithilfe einiger Mitmenschen, bis nach Buzios Renato hatte mir ja ein kleines, gemütliches Fischerörtchen versprochen, doch dabei hatte er vergessen zu erwähnen, dass in diesem Gebiet leider der Tourismus auch schon deutliche Spuren hinterlassen hat. Gemütlich war es irgendwie trotzdem.
„Aber Johannes, wolltest du nicht in das wirkliche Brasilien eintauchen, dich von seiner echten Kultur inspirieren lassen und das echte Fremdsein genießen? Das findest du doch nicht dort!“ Jene „mahnenden“ Worte hörte ich am Telefon in einem Gespräch, das ich mit einem guten Freund führte und antwortete ihm daraufhin: „Natürlich werde ich in Buzios jene Dinge nicht unbedingt finden. Aber ich wollte mich in erster Linie einfach treiben lassen und auf das echte brasilianische Land am liebsten ganz zufällig sowie völlig überraschend stoßen und ohne mir das irgendwie krampfhaft vorzunehmen. Ich liebe es, Tipps und Vorschläge von Einheimischen anzunehmen und dann mal schauen, was passiert und wo ich am Abend landen werde. Das weißt du doch, dass ich so ticke. Ja und deshalb habe ich mich doch von dem Surfer inspirieren lassen. Ich denke, dass einem das Schicksal immer etwas leitet und deshalb bin ich überhaupt nicht sauer darüber, hier zu sein. Mal schauen, was noch so alles passiert. Also dann – ich hab Appetit auf frischen Fisch, hau rein und bis die Tage!“
„Tschüss und pass auf dich auf, du Kojote!“
Während ich die Worte meines Kumpels im Hinterkopf hatte, wurde mir wieder so richtig bewusst, dass mein Rückflug nach Deutschland inzwischen mit immer größer werdenden Schritten auf mich zu rückte und mein kürzlich gedachter Gedanke, vielleicht weiter in den Norden nach Salvador de Bahia zu fahren mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr entspannt umzusetzen sein würde. So soll es diese Reise wahrscheinlich einfach nicht sein. Aber es muss ja auch nicht sein und ebenso nicht, dass ich in Brasilien das letzte Mal gewesen sein soll. Die Idee, vielleicht irgendwann einmal dorthin zurückzukehren und dann ganz andere Orte aufzusuchen, beruhigte mich sehr.
Nach der leckeren Fischspeise spazierte ich wieder zu meinem Hostel, welches etwas versteckt im Abseits des Tourismus, auf einem kleinen Hügel und zwischen großen Palmen sowie Bananenstauden lag und genoss in einer Hängematte liegend die angenehme Ruhe. Vier Tage blieb ich an diesem Fleckchen Erde und teilte mir mit zwei anderen Käuzen ein schmales Fünfbettzimmer.
Ich verharrte auch deshalb dort sowie hüpfte gleichermaßen über jenen selbstgebastelten Schatten, weil ich mir eigentlich nicht mehr mit anderen Menschen ein Zimmer teilen wollte, da ich mich mit den beiden Besitzern der Unterkunft bestens verstand und sie mir viel über ihr spannendes Leben in Brasilien erzählten. Mir gefielen ihre Geschichten über das echte südamerikanische Land. Dabei lag ich öfters schaukelnd in der Hängematte, hörte aufmerksam den Erzählungen zu und bemerkte, wie ich doch auch so und zudem noch ganz entspannt in das wirkliche Brasilien eintauchen konnte, bis ich mich wieder auf den Weg zum Strand von Copacabana bewegte. In Rio zurück checkte ich in einem ziemlich heruntergekommenem Hostel direkt am Strand von Copacabana für zwei Nächte in ein stinkendes, hässliches Einzelzimmer ein. Aber weil ich mal wieder alleine sein und keine schnarchenden Wesen um mich herumhaben wollte, nahm ich eben auch dieses Loch gern in Kauf.
Knapp zehn Tage hatte ich noch Zeit, bevor mein letzter Flug dieser Reise von Sao Paulo nach Deutschland bittere Realität werden sollte. Von daher musste ich mich so langsam auf den Weg in Richtung der Metropole bewegen, obwohl ich überhaupt keine Lust auf solch eine riesige Stadt hatte. Meine eigene Unlust ließ mich natürlich schnell selbst davon überzeugen, dass ich am liebsten meine letzten Tage in einem kleinen gemütlichen Ort zwischen Rio und Sao Paulo verbringen mochte. Zudem wollte ich in der Endzeit meines Trips am liebsten noch einige Stunden im Wasser verweilen und nicht zwischen Großstadtmenschen verbrauchte Luft einatmen.
Mit jenen Wunschgedanken im Kopf erkundigte ich mich an der Rezeption des Hostels und schilderte meine geistigen Ergüsse. „Ubatuba, da musst du hin“, erzählte mir der leicht bekiffte Mitarbeiter in Winterklamotten und fügte noch hinzu: „In längst vergangenen Zeiten soll in jenem Ort einst ein berüchtigter Indianerstamm gelebt haben. Und die Menschen dieses Volkes sollen wohl auch Kannibalen gewesen sein“. Ob diese Geschichte nun stimmte oder nicht war egal. Ja, dort wollte ich als Nächstes hin und machte mich einen Tag später auf den Weg. Nach circa 330 Kilometer langweiliger Busfahrt erreichte ich Ubatuba und fand Unterschlupf in einem familienbetriebenen Hostel in Strandnähe. Dort arbeitete die gesamte Familie im „Hostel Business“ und teilte sich völlig freizügig mit den Gästen des Hauses eine gemeinsame Küche sowie ein geräumiges „Wohnzimmer“.
Als ich am Abend als einzig geglaubter Gast beim Kochen in der Küche stand, gesellte sich irgendwann ein freundlicher Spanier an meine Seite und noch während wir uns die Herdplatten teilten, freundeten wir uns an. Pablo war neben mir der einzige Besucher der Herberge und war bei einer sehr introvertierten, brasilianischen Couchsurfing Freundin eingeladen, bei der er allerdings nicht übernachten konnte. Am nächsten Tag gesellte sie sich mit in die Küche und schlug vor, uns ihre Heimat zu präsentieren und so entführte sie uns an bezaubernde Strände oder zeigte uns einen tollen, abgeflacht winkligen Wasserfall, auf dem wir mehrere Meter und jeder auf seinem Allerwertesten ins Tal rutschten konnten.
Wir liehen uns Fahrräder und radelten an der Küste entlang oder surften relaxed auf einem Longboard in einer ruhigeren Bucht. Weil wir wirklich eine schöne Zeit zusammen hatten, verzichtete ich darauf, auch nur eine Nacht in Sao Paulo zu verbringen. Und so kam es, dass ich mich erst wenige Stunden, bevor der Flieger von Sao Paulo zurück nach Frankfurt fliegen sollte, in einen Bus hockte und auf direktem Weg zum Flughafen rollte, zum Ende meiner Reise …
Kurz nachdem sich der große Vogel schwermütig durch die Wolken bohrte, übermannte mich ein seltsames Gefühl und stimmte mich alles andere als fröhlich. Nein, vielmehr bedrückte es mich, dass die Reise nun wirklich beendet ist. Liebend gerne hätte ich Brasilien weiter erkundet und vermisste schon zu diesem Zeitpunkt das ständige Unterwegssein. Diese Tour durch mehrere Länder erweckte in mir erst so richtig die Leidenschaft der Reiselust und so beschloss ich bereits im Flieger sitzend, dass ich mich schon ganz bald wieder auf den Weg machen wollte.
Nach einer sagenhaften zweiunddreißigstündigen Flug-Zug-Reise erreichte ich gegen 17 Uhr bei Regen und miesem Wetter am 31. Mai die Hauptstadt Deutschlands. Noch immer in vielen Gedanken verdrossen, stand ich etwas später vor meiner kleinen Altbau Einzimmerwohnung in Wilmersdorf. Für die komplette Zeit meiner Reise hatte ich sie untervermietet und freute mich sehr, als ich auf meinem Wohn- und Esszimmertisch eine neue schöne Pflanze plus eine Flasche Sekt entdeckte. Das Grün bekam natürlich sofort einen Ehrenplatz am Fenster, aber der Alkohol musste auch wegen des miesen Wetters und meiner komischen Stimmung sofort daran glauben und wurde kurzum geköpft.
Nach so einer langen Reise war ich natürlich völlig abgebrannt, was die Kohle anbelangte, also brauchte ich nach diesem Abenteuer und den vielen unbezahlbaren Erlebnissen zunächst erstmal einen gut bezahlten Job. In Berlin erweist sich das nicht unbedingt als eine leichte Aufgabe und noch viel weniger angenehm war für mich die lästige Jobsuche überhaupt. Schließlich fand ich auch nicht diesen einen ersehnten Job, bei welchem mir meine gewünschten Moneten noch schneller in meine Reisetaschen hätten fließen können. Doch die erarbeiteten Kröten durch zwei Nebenjobs reichten wenigstens zunächst erstmal zum Überleben aus. Darüber hinaus war es nicht sehr einfach, einen Broterwerb zu finden, bei dem ich meinen Arbeitstag etwas freier gestalten konnte. Aus diesem Grund entschied ich mich letztlich für zwei Kurzzeitjobs, denn bei diesen Beschäftigungen konnte ich etwas unabhängiger meine Arbeitszeit gestalten und musste nicht jeden Tag früh morgens und bis zum späten Nachmittag immer auf dieselbe Leier Tag ein, Tag aus derselben monotonen Tätigkeit nachgehen.
Zum Schluss kam das Glück ganz einfach zu mir geflogen. Mein bester Kumpel, die Amsel — was sein echter Spitzname ist — besuchte mich mal wieder in Berlin und berichtete mir aufgeweckt von seiner Reiselust. Er erzählte, dass er gerne für etwa einen Monat und ohne großen Plan verreisen wollte. Die Amsel wollte aber nicht alleine fliegen und somit fügte er mich in sein gedankliches Spiel einfach hinzu.
„Oh mann, natürlich will ich mit, doch der schnöde Mammon fehlt mir ganz einfach, Amsel.“
„Na, mach dir darüber mal keine Gedanken“, sagte er daraufhin und ergänzte: „Is doch überhaupt kein Problem, dann borge ich dir eben die fehlenden Kröten. Echt, das is überhaupt kein Ding.“ In diesem Moment sparte ich mir jedes weitere Wort und umarmte ihn einfach. Wir einigten uns und ohne lange zu diskutieren auf eine Reise nach Thailand und Vietnam. „Cool“, sagte ich, „endlich brauche ich mal niemanden zum Reisen zu überreden!“ Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika war inzwischen vorüber und der Sommer neigte sich schon wieder dem Ende entgegen. Der perfekte Zeitpunkt, um wieder zu verreisen, war also gekommen.
2 Übersetzung aus der Indianersprache Quechua für die Stadt „ Arequipa“
3 Übersetzung für „Salta“: „die Hübsche“
4 großes, spartanisch eingerichtetes Restaurant mit lauter Musik
5 bedeutet „das Gegrillte“