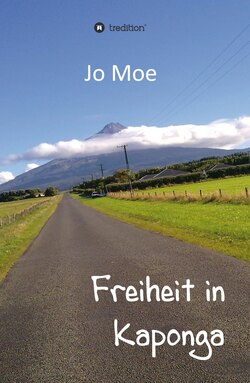Читать книгу Freiheit in Kaponga - Jo Moe - Страница 9
ОглавлениеKapitel 1
Kindertage, die DDR und der Friedhof
Als Kind liebte ich es, die wunderbaren Filme Winnetous zu sehen und natürlich wünschte ich mir, wie dieser Ureinwohner Amerikas zu sein. Ich fand den fremden Indianer einfach toll: er war stark und charakterlich einfach ganz anders als die hinterhältigen weißen Männer. Deshalb wollte ich auch ständig Verfilmungen mit dem Häuptling der Apachen anschauen. Sie kamen, so denke ich, auf ARD oder ZDF. Doch selbst das Einschalten dieser Sender wurde in der ehemaligen DDR wie ein kleines Verbrechen behandelt, aber meine Familie ließ sich davon nicht beeindrucken und sich auch nicht dieses kleine Stückchen Freiheit nehmen. Und so sah ich, wie Winnetou völlig freiheitsliebend durch großartige Landschaften ritt und sehnte mich bereits damals, im Jahr 1985 als kleiner fünfjähriger Knirps, nach diesem Leben.
Meine Eltern bemerkten schon bald die Begeisterung, die ich für das Indianerleben empfand und schenkten mir — es war, so glaube ich, der fünfte Geburtstag — ein rotes, klappriges Indianerzelt. Zusammengehalten wurde es von drei Holzstöcken sowie dünnem roten Stoff und ich hoffte, dass diese Zweige das Wigwam ebenfalls bei einem schwachen Wind noch befestigen würden. Ja, ich nahm mir sogar vor, ganz bald mal darin zu übernachten, aber stellte es zunächst erstmal an die äußerste Gartengrenze zwischen alte Holunderbäume und spielte sowie vergnügte mich tagsüber im Zelt, denn noch war ich äußerst glücklich über meine ersten eigenen drei Wände und über diesen Stellplatz. Allerdings wollte ich irgendwann mehr und über den Gartenrand hinaus. So frohlockte es mich des Öfteren, einfach das Zelt zu schnappen und etwas weiter weg vom Haus sowie Garten, meinen Eltern, Brüdern und unserem aufmerksamen Hund zu sein. Mein heimlicher Wunsch war es, endlich mal aufzubrechen und so packte ich eines Tages etwas Essbares in meinen grauen DDR-Beutel, klemmte das rote Indianerzelt unter den Arm und war frohen Mutes, den rechten Weg zu finden. Allerdings schon nach etwa fünfminütigem Fußmarsch hinaus aus dem Dorf verharrte ich auf einem Feld neben dem dort fließenden Fluss und überlegte, ob ich mich noch weiter weg bewegen sollte. Und weil mir das Geplätscher des Gewässers an dieser Stelle gefiel, beschloss ich, einfach dort zu bleiben, schmiss den Beutel ins Gras, bohrte zaghaft die dünnen Zeltwandstöcke in den Boden und blickte, nachdem ich die wenigen Handgriffe erledigt hatte, unter der flachen Hand — die ich an die Stirn hielt — in die Ferne und erschien mir dabei selbst fast wie ein richtiger Indianer. Bald darauf jedoch begann es, zu dämmern an diesem lauen Sommerabend und so verkroch ich mich lieber ins Zelt. Dazu ließ ich den Eingang geöffnet, starrte in den Himmel und wartete auf die funkelnden Sterne. Doch je dunkler es wurde, umso unbehaglicher fühlte ich mich und war mir auch nicht mehr ganz so sicher, völlig alleine sein zu wollen, bis dieses unwohle Gefühl plötzlich in Angst umschlug, als ich irgendein Tier hörte, was laut an meinem Zelt herumschnüffelte. Während ich dann hektisch darum bemüht war, meinen Eingang zu verschließen, erkannte ich den Unruhestifter. Freude stieg in mir auf, da mir Augenblicke später unser treuer Irish Setter über meine Finger leckte. Levis freute sich natürlich überschwänglich, mich zu sehen und auch ich war erleichtert, weil mich mein Vati und unser Hund wieder mit zurück nach Hause begleiteten.
Nach diesem ersten kleinen Moment der Freiheitssuche sollten jedoch Jahre vergehen, bis ich zum zweiten Mal den Mut fassen sollte und das Alleine Aufbrechen wagte. Bis dato reiste ich zusammen mit meiner Familie und der näheren Verwandtschaft meiner Mutti an die Mecklenburgischen Seenplatten. Als Kind war es dort immer wieder, von Jahr zu Jahr, wunderschön und es wurde auch nie langweilig. Zu diesem Zeitpunkt lebten wir in der tiefsten DDR und hatten, also insbesondere meine Eltern, nicht wirklich die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wohin es über die Grenzen des Gebiets hinweg gehen könnte. Gern möchte ich an dieser Stelle kurz zusammenfassen — ob es mich nun direkt betraf oder nicht — was den Staat meiner Kindheit ausmachte. Ja, ich darf schon mal verraten, dass mich dieses totalitäre System allemal sehr geprägt hat. Die DDR — sie war eine beklemmende, ja ganz und gar einklemmende Diktatur, die sich am Bild des großen Bruders der Sowjetunion orientierte und sich diesen kommunistischen Staat zum gewichtigen Vorbild machte. In jedem Klassenzimmer unserer Schule in Friedrichswerth hing in großen braunen Rahmen eingeschlossen an der Wand das ernste, mahnende Gesicht Ernst Thälmanns, der einst Anhänger der KPD war; die Politik und die Wirtschaft wurden zentral vom Staat geregelt und jeder private Besitz, vor allem Unternehmen und Geschäfte, gingen in staatlichen Besitz über. Es wurden Produkte, speziell die der Lebensmittel, sowie Bekleidungsindustrie, vom Staat subventioniert, weshalb es sogar möglich war, dass ein Brötchen nur fünf Pfennige kostete. Aber sobald die Waren aus dem Westen eingeliefert wurden, schnellten die Preise in die Höhe. So bezahlten wir für eine Ananas gleich mal 18 Mark und selbst die ungenießbaren Dinge kosteten vergleichsweise richtig viel Geld.
„Luxusgüter “ (moderne, „hochwertige“ Dinge) waren somit stark überteuert, so dass wir für unseren Ost-Farbfernseher um die 5000 Mark hinblättern mussten, wofür meine Eltern natürlich eine halbe Ewigkeit sparen mussten. Mein Vater war zum damaligen Zeitpunkt Alleinverdiener und erzielte bei weitem nicht den durchschnittlichen Verdienst eines DDR-Bürgers von etwa 1000 Mark. Auf die sogenannten „Westwaren“, die man in den Intershops erhalten konnte, hatten wir allerdings noch keinen Zugriff. Das waren kleine Läden an wenig auserwählten Orten, in denen die Westprodukte nicht mit der DDR-Mark bezahlt werden konnten, sondern nur mit Fremdwährungen, wie beispielsweise der West-Mark. Diese Währung des deutschen Nachbars durften die Ostbürger jedoch nicht besitzen und somit war es den Menschen in den frühen Achtzigern nicht möglich, in den Genuss der im westlichen Teil Deutschlands existierenden Produkte zu kommen, bis dieses Gesetz schließlich später aufgehoben wurde. Bevor es jedoch dazu kam, konnten zunächst nur die Westbürger oder Menschen aus diversen weiteren Ländern jene Geschäfte als echte, einzige Zielgruppe besuchen. In diesen „Oasen“ erhielten dann später zudem auch endlich die „Ossis“ alle möglichen Genussmittel, die ansonsten in keinem anderen Laden erhältlich waren. Doch zudem waren jene Waren, die von der DDR selbst produziert wurden, wie zum Beispiel der Trabant, nur äußerst begrenzt im Handel erhältlich. Ja und so wurde meistens schon bei der Geburt eines Menschen ein Trabi bestellt, damit man eben mit solch einer kostbaren „Dachpappe“, sobald der 18. Geburtstag erreicht war, pünktlich über den Asphalt schleichen konnte. Selbst unsere Familie war im Besitz eines älteren Trabis und ich kann mich gut erinnern, wie wir bei Fahrten durch den Regen mit Hilfe von Schwämmen die Dachpappe von einsickernden Pfützen befreien mussten. Aber wir jammerten nicht darüber.
Was mir weiterhin sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, dass auch ich mich für Schokolade oder grüne Bananen stundenlang in eine Reihe vor dem Dorfkonsum einreihen musste. Sprich, um überhaupt etwas zu bekommen, sollte ich mich am besten schon vor der Öffnung des Ladens, das heißt früh morgens, in die Schlange stellen, um eine realistische Chance zu haben, überhaupt irgendetwas ergattern zu können.
In der DDR herrschte im Prinzip nur eine einzige Partei, die SED, die aus den Forderungen der Sowjetunion entstand, wobei es zu einer Zwangsvereinigung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) kam. Aus diesem Grund kann niemand behaupten, dass es freie Wahlen gab, was bedeutete, dass das Volk jene furchtbare Politik in keine positive Richtung beeinflussen konnte. Die Menschen wurden stattdessen dazu gezwungen, zu gehorchen. „Wer sich dagegen wehrte, fand sich hinter Gittern wieder und fiel dort auch nicht selten auf menschenverachtendste Art und Weise den verbrecherischen Methoden wie Folter und Vergewaltigung zum Opfer.“ (Zeitzeuge)
Diese Einschränkungen sollten jedoch nicht die einzigen sein, die der DDR-Bürger am besten ohne auffällig mit der Wimper zu zucken, einfach hinnehmen musste, denn die Stasi sah einfach alles! Ja, auch unsere Familie wurde bespitzelt und nicht nur der nette Nachbar von nebenan; ebenso gehörten gute Freunde meiner Eltern zu dieser Kategorie Spitzelmensch. Doch was mir noch mehr an Lebensqualität genommen hätte, wenn ich in der geschilderten Zeit bereits älteren Semesters gewesen wäre, ist der Fakt des begrenzten Reisens. Sicherlich nutzten die meisten DDR-Bürger die Wochen der großen Sommerferien, um ihren Urlaub anzutreten. Wir, meine zwei Brüder und ich, hatten das Glück, dass unsere Eltern niemals den bekloppten Einfall hatten, uns in diesen schulfreien Zeiten in ein Kinderferienlager zu stecken. Neben der „wunderbaren Idee“ dieser Einrichtungen, in denen den armen Kindern nicht nur beim Singen von DDR-Liedern das DDR-System ins Gehirn geblasen bekamen, existierte sogar eine weitere Urlaubsalternative für die gesamte Familie — diese wurden als FDGB-Ferienheime bezeichnet. Von der Mutter meines damaligen besten Freundes erfuhr ich, dass es nicht gerade einfach war, dort einen Platz zu ergattern sowie dass eine Ferienkommission der Betriebe darüber bestimmte, ob man dort im Urlaub unterkam oder nicht. Und ich weiß auch noch wie heute, wie sie öfters darüber schimpfte, dass ja die DDR-treuen Bürger, die der SED oder der Stasi angehörten, weitaus bessere Chancen auf diese begehrten Ferienplätze hatten. Doch trotz ihrer „Linienuntreue“ kamen sie als Familie mal in den Geschmack, dort ihre Urlaubszeit zu verbringen und so wussten sie mir zu erzählen, dass an solchen Orten alles ziemlich straff durchorganisiert war und selbst die Essenszeiten strickt geregelte Termine waren. Und selbst die künstlich geschaffene gute Laune war ein Befehl und wenn man auf diesen Blödsinn keine Lust hatte, wurde den freidenkenden Menschen natürlich das individuelle Reisen in diesem rostenden DDR-Käfig sehr schwer gemacht.
Erst viele Jahre später habe ich erfahren, dass die Menschen, um beispielsweise an eine Ferienwohnung an der Ostsee zu kommen, mit einem Eigentümer dieser Wohnungen verwandt sein mussten und selbst diese alberne Bestimmung hatte das DDR-Grundgesetz geregelt. Außerdem war er so, dass man auch nicht eben mal mit einem eigenen Boot auf diesem Gewässer herumschippern durfte, denn es bestand dabei ja theoretisch die Möglichkeit der Flucht aus dem Land. Gerade in diesem Gebiet an der Ostsee wurde die Freiheit massiv eingeschränkt, indem „wildes Campen“ strengstens untersagte wurde. Damit sich die Menschen der DDR an jene absurden Richtlinien hielten, wurden hunderte Polizisten sowie Sicherheitskräfte, die sich stets und ständig im Einsatz befanden, überall hin platziert. Kaum vorstellbar, aber wirklich wahr ist auch die Tatsache, dass der Strand Punkt 20 Uhr gleich einem „Sockenladen“ einfach dicht gemacht wurde. Ja, all der Käse wurde mir von Leuten berichtet, die solchen Erfahrungen ausgesetzt waren. Weiterhin wurde ich darin unterrichtet, als ich mich auf die wahren Spuren der DDR begab, dass jemand, der zelten wollte, sich mindestens ein halbes Jahr im Voraus einen Platz dafür reservieren musste. Es gab sogar die Möglichkeit, vorausgesetzt man hatte bestimmte Beziehungen, in eines der sozialistischen Nachbarländer zu reisen. Zu ihnen gehörten Ungarn, Polen, die Tschechische Republik, Rumänien, Bulgarien und in Ausnahmefällen Jugoslawien. Am wenigsten kompliziert gestaltete sich hierbei eine Reise nach Ungarn, weshalb sie vielleicht deshalb sehr beliebt war. Wer sich zu den „Auserwählten“ zählen durfte, dem war sogar der Weg über den Atlantischen Ozean nach Kuba geöffnet. Aber welche Gefälligkeiten hatte man dafür dem DDR-Staat wohl als Gegenleistung bieten müssen?
Eine nette Begründung, warum dieser totalitäre Staat das Einreisen in westliche Länder untersagte, war, dass der Schutz des Einzelnen im Westen nicht mehr gewährleistet sei. Wollten somit die Herrschenden etwa ihre Bürger vor den positiven, freiheitlichen Gedanken der westlichen Welt schützen? Das Absurdeste, was ich zu Ohren bekam, war der Punkt, dass, wenn der Drang danach, in ein westliches Land zu reisen, von einem Freiheitsliebenden nicht mehr unterdrückt werden konnte, ihm doch die Möglichkeit unter der Erfüllung bestimmter Bedingungen eingeräumt wurde; in solch einem Fall mussten sie entweder ihr eigenes Kind oder aber deren Ehepartner als „Geisel“ in der DDR zurücklassen. Zum Glück war ich damals noch nicht in diesem reifen Alter und der deshalb gegebenen eventuellen Umsetzung dieser Taten ausgesetzt, denn wer weiß, ob ich vielleicht in Versuchung geraten wäre sowie diesen hirnverbrannten Schritt gewagt hätte. Ich weiß nicht, ob mein Drang nach Freiheit wirklich so groß gewesen wäre und ich mich von meinen engsten Familienangehörigen für immer getrennt hätte, um im Westen zu leben. Vielleicht aber wäre der Wille gewaltig gewesen und ich hätte mich aus den hässlichen Tentakeln der DDR befreit, indem ich eine Möglichkeit zur Flucht ergriffen hätte.
Dem Himmel sei gedankt, dass dann doch plötzlich und völlig unerwartet im Jahr 1989 „Die Wende“ kam. Schlagartig wurden sämtliche Türen geöffnet und es waren zahlreiche Wege hin zu viel mehr Freiheit gegeben. Endlich fanden wir uns befreit vom Krebsgeschwür der DDR sowie von seiner diktatorischen Tyrannei und waren nicht mehr eingesperrt. Nun ergriffen wir die Chance, durch die geöffneten grauen Käfigtüren durchzufahren und erstmals als Familie die erfrischende westliche Luft zu atmen. Zwei Tage nach dem Mauerfall, am 11.09.1989 um fünf Uhr in der Früh, wurden meine Brüder und ich von unserer lieben Mutter aus unseren Kinderträumen gerissen. Aber ein anderer viel schönerer Traum sollte in Erfüllung gehen. Unsere Mutti sagte mit weit aufgerissenen Augen: „Wir fahren in den Westen!“ Und jeglicher Ärger, nicht mehr in der Traumwelt zu schweben, war verschwunden. Nur wenige Minuten später saßen wir zu fünft im weißen Trabi und waren schon bald auf der Autobahn. Ja und dieser Moment bleibt unvergesslich, denn ab diesem Zeitpunkt befanden wir uns in einem Schwall aus Millionen von Lichtern, die wie ein Meer fliehender Glühwürmchen leuchteten. Sogar die komplette Autobahn bestand aus grell leuchtenden Autolampen. Es schien, als würde sich das gesamte Volk der DDR auf der Route in den Westen befinden und so dauerte es etliche Staustunden, bis wir bei klirrender Kälte dann endlich unser Ziel Bamberg erreichten. Das war unser erster Schritt in die westliche Richtung und zu diesem Zeitpunkt wurde uns erstmal bewusst, welche Tore sich für uns mit der Wende geöffnet hatten. Endlich hatten wir die Möglichkeit, andere Länder zu erkunden und daher unternahmen wir in den kommenden Jahren viele Reisen in die westlichen Nachbarländer. Am liebsten fuhren wir jedoch in das wunderschöne toskanische Italien und an die dortigen herrlichen Strände, aber machten uns auch mal auf in den Norden — nach Norwegen zum Angeln.
Während dieser Jahre schlängelte ich mich wie eine stotternde Forelle durch die Schuljahre und war sehr erleichtert, als ich 1999 mein Abitur endlich in den Flossen halten durfte. Nach der Schulpflicht folgte jedoch erstmal die nächste Pflicht — die Wehrpflicht — und noch immer war die Zeit nicht gekommen, meinen eigenen Weg zu gestalten. Trotzdem war ich guter Dinge, da mir wenigstens die Möglichkeit einer Wahl blieb, nicht wie zu DDR-Tagen, als ich nach der Schulzeit gezwungen gewesen wäre, in die Nationale Volksarmee einzutreten. Dieser Spuk war ja Gott sei Dank vorbei. Es bot sich mir die Alternative des Zivildienstes und es war mir völlig klar, dass ich mich für diesen entscheide und somit gegen den Dienst an der Waffe. Die grausige Vorstellung, eingesperrt wie ein Karnickel in einem schäbig sterilen Zimmer mit vielleicht vier bis sechs Schnarchnasen hausen zu müssen, machte mir Angst. Der Gedanke daran, mit großer Wahrscheinlichkeit frühmorgens von jemandem, für den die Rambo Filme sein Heiligtum sind, aus dem sperrigen, ungemütlichen Bett gebrüllt zu werden, erschien mir dermaßen beschränkt, dass ich natürlich liebend gerne den Zettel in die Hand nahm und meine Gründe für die Kriegsdienstverweigerung offenbarte.
Meine Bewerbung für den Zivildienst schickte ich unter anderem zum Gartenamt von Gotha und erhielt schon nach wenigen Tagen die Nachricht, dass die Friedhofsführung es begrüßen würde, mich für die nächsten zehn Monate zu beschäftigen. Aber daran, dass das Gartenamt zuständig für den Hauptfriedhof ist und sich um die parkähnliche Anlage kümmert, hatte ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Der Gedanke, fast ein ganzes Jahr auf dem Friedhof gefangen zu sein, gefiel mir natürlich nicht besonders. Dennoch entschied ich mich dafür, weil ich bei dieser Aufgabe an der frischen Luft und nach getaner Arbeit wie dem Rasenmähen oder Bäumefrisieren, nach nur fünf Minuten Radweg, wieder zu Hause sein konnte.
Außerdem freute ich mich ein wenig darauf, mit einem Multicar umherzufahren, der den Zivis für sämtliche Tätigkeiten auf dem Gelände zur Verfügung stand. Ja, ab und an bekam ich auch mal die Gelegenheit, alleine im grünfarbigen Wagen zu sitzen, den ich dann meistens in die Nähe einiger größerer Büsche und Hecken steuerte, um mich dort für paar Minuten vor den anderen Zivis sowie der Friedhofsführung zu verstecken. Nach einiger Zeit kristallisierte sich bei der Suche nach einem ruhigen, abgeschiedenen Fleck ein besonderes Versteck heraus, was ganz am Rande des Friedhofs lag, direkt an der Grenze zur Straße, welche die Begräbnisstätte von meinem geliebten Fußballstadion trennte. Dieser Ort wurde schnell mein Lieblingsplatz, denn dort fühlte ich mich unter anderem deshalb so wohl, weil eben die Außenwelt nicht mehr so fern war. An diesem Plätzchen nahm ich mir öfters mal die Zeit, den Motor abzuschalten, meine Füße aufs Armaturenbrett zu legen und die eifrigen Eichhörnchen zu beobachten, die dort ihre Heimat gefunden hatten.
Es kam auch mal vor, dass es an manch einem Tag nicht besonders viel zu tun gab. An einem dieser Tage war es den Eichhörnchen gelungen, sich vor mir zu verstecken, so dass ich mir eine andere Beschäftigung suchen musste und dabei auf die Idee kam, den Multicar von innen etwas aufzuräumen. Beim Erfüllen dieser Aufgabe entdeckte ich ein Buch mit dem Titel „Sophies Welt“ und es wurde von diesem Moment an, als ich im abgesessenen alten Sitz des Fahrzeugs hockte, am Platz meiner Lieblingsecke, an der großen Hecke und umgeben war von urigen und uralten Bäumen, mein stiller Begleiter. Doch ob dieses Werk dafür verantwortlich war, dass in mir der Gedanke wuchs, eine Reise in die Ferne zu unternehmen, kann ich nicht mehr sagen. Eines jedoch weiß ich noch genau: dieses Buch löste allerlei Gedankengänge in mir aus. Und so fasste ich eines Tages den Entschluss, meinen dunkelblauen dreier Golf gegen eine Reise nach Australien einzutauschen. Dieser wohltuende Einfall verschönerte mir besonders an den kälter werdenden Tagen den noch zu absolvierenden Aufenthalt zwischen welken Blumen und Gräbern. Das Ende auf dem Friedhof rückte somit immer näher und mir wurde bewusst, dass ich, bevor ich eines Tages an diesem Ort selbst begraben liegen werde, viele viele Plätze dieses bunten Planeten betreten haben möchte. Doch ganz alleine wollte ich nicht unbedingt aufbrechen, allerdings da keiner meiner Freunde Zeit hatte oder sie sich nahm, musste ich mich zunächst damit abfinden, das kommende Abenteuer wohl alleine anzutreten. Je näher es heranrückte, umso unbehaglicher wurde mir schließlich der Gedanke, weshalb ich mich im Internet nach einer Reisebegleitung auf die Suche begab. Kurz vor dem Abflugtag wurde ich glücklicherweise fündig, packte später mit weniger Sorgen meinen Rucksack und entschied mich in letzter Sekunde dafür, ein kleines, leeres Buch in den beinah überfüllten Sack zu stopfen. Ja, dieses wurde dann zu meinem ersten Reisetagebuch und in der folgenden Geschichte beschreibe ich einige Anekdoten, die ich erlebte und zwar aus der Perspektive eines Zwanzigjährigen, der ich ja damals noch war.