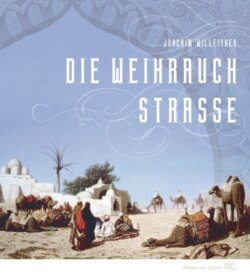Читать книгу Die Weihrauchstraße - Joachim Willeitner - Страница 10
Das Mare Erythraeum und der »Periplus Maris Erythraei«
ОглавлениеDer im Altertum verwendete Begriff »Mare Erythraeum«, der sich ebenfalls mit »Rotes Meer« übersetzen lässt (griech. erythrós = rot), ist nach Ausweis der Quellen nicht nur auf dieses Gewässer im engeren Sinne angewandt worden, sondern umfasste zumindest zeitweilig auch den Golf von Oman jenseits der Straße von Hormuz und weite Teile des Indischen Ozeans. Das eigentliche Rote Meer galt – ebenso wie im Osten der Persisch-Arabische Golf (»Persikòs Kólpos«) – lediglich als Ausbuchtung des »Mare Erythraeum« und wurde entsprechend griechisch als »Kólpos Arabikós« oder »Arábios« (schon bei Herodot II 11, 102, 158; IV 39 & 42f.) und lateinisch als »Sinus Arabicus« bezeichnet. So ist es auch der Fall bei den Beschreibungen des antiken Geografen Eratosthenes, die uns Strabo (XVI, 767) in Auszügen überliefert hat, später in der »Naturgeschichte« des Plinius (nat. VI 107 & 163f.) oder im Kartenwerk des Ptolemaios (V 17). Bei Curtius (VIII 9,6) münden sogar Indos und Ganges in das »Mare Rubrum«. Am deutlichsten zeigt den Sachverhalt der »Periplus Maris Erythraei«, das Seefahrerhandbuch eines unbekannten Navigators aus der Antike, dem wir umfangreiche Angaben zur Topografie Südarabiens verdanken.
Mit dem Begriff »Periplus« bezeichnet man die Umschiffung einer Insel oder eines Meeresbeckens und im erweiterten Sinne die Beschreibung der dabei passierten Küstenregionen vom Wasser aus. Ursprünglich sollten Aufzeichnungen dieser Art in erster Linie den Handelsschiffen zur See die Orientierung und Navigation erleichtern, da solche Notizen nicht nur nüchterne Entfernungsangaben und Informationen über die Wind- und Wasserverhältnisse enthielten, sondern auch die Beschreibungen geeigneter Anker- und Hafenplätze. Vielfach ergänzten Schilderungen der Flora, Fauna und Völkerschaften entlang der Seeroute die Aufzeichnungen, und sofern solche »Periploi« nicht von den Handelsleuten als Berufsgeheimnis unter Verschluss gehalten wurden, fanden diese Berichte zunehmend Verbreitung als Lektüre für solche Leute, die zwar selber nicht dorthin reisen konnten oder wollten, aber dennoch den fremden Ländern und den Abenteuern, die man auf dem Weg dorthin erleben konnte, ihr Interesse entgegenbrachten. Diese Popularisierung hatte allerdings zur Folge, dass die ursprünglich nüchternen, da nur an nautischen Erfordernissen orientierten Seefahrerhandbücher allmählich zu veritablen »Märchenbüchern« mutierten, die von Gerüchten und Legenden nur so wimmelten. Zu dieser Gattung der Reiseliteratur kann man beispielsweise die Schilderung der um 450 v. Chr. erfolgten Fahrt des karthagischen Königs Hanno entlang der afrikanischen Westküste bis ins heutige Sierra Leone zählen, die in ihrer Übersetzung aus dem punischen Original weite Verbreitung erfuhr, außerdem die Abenteuerberichte des Seefahrers und Geografen Pytheas von Massalia, der in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. über den Atlantik bis möglicherweise nach Irland gelangte, oder auch die Beschreibung des Kaspischen Meeres durch den Flottenkommandanten Patrokles, der das Binnengewässer im Auftrag des Dynastiebegründers Seleukos I. Nikator (305–281 v. Chr.) zwischen 286 und 281 v. Chr. erkundet haben dürfte.
Anders nun der »Periplus Maris Erythraei«, dessen Verfasser leider nicht namentlich überliefert ist. Möglicherweise dadurch bedingt, dass diese Aufzeichnungen nur in engen eingeweihten Kreisen zirkulierten und es deswegen zu keiner populären »Überarbeitung« kommen konnte, bietet dieses Werk in insgesamt 66 Abschnitten eine ausgesprochen nüchterne Beschreibung der Seeroute, die (von Kapitel 1 bis 18) im Roten Meer, genauer gesagt an dessen Westküste im Hafen von Myos Hormos, ihren Anfang nimmt. Sie führt dann an der ostafrikanischen Küste entlang – wobei sie auch den axumitischen Hafen von Adulis berührt – bis Opone, das am Osthorn Afrikas in der Bucht von Ras Hafun zu lokalisieren ist, und zur Insel Menuthias, die im Allgemeinen mit Sansibar identifiziert wird. Allerdings lassen die Angaben zur Küste zwischen Opone und Menuthias erkennen, dass der Autor hier auf Fremdaufzeichnungen zurückgegriffen und die Gegend offensichtlich nicht selbst bereist hat. Im zweiten, mit 48 Kapiteln erheblich umfangreicheren Teil des Periplus geht es – wiederum in Myos Hormos beginnend – hinüber nach Leuke Kome und dann weiter über die südarabische Küste und den Golf von Oman bis hin zum indischen Subkontinent. Reiseziel ist die bislang noch nicht eindeutig lokalisierte, wohl an der Malabarküste gelegene Stadt Nelkynda, die möglicherweise mit dem heutigen indischen Kottayam südlich von Cranganore identisch ist. Ungeachtet dieser strittigen Zuweisungen hat sich der Periplus dennoch als ausgesprochen hilfreich bei der Identifikation antiker Ortsnamen mit heutigen Ansiedlungen bewährt.
Der griechisch sprechende Autor des Werkes dürfte aus Ägypten, am wahrscheinlichsten aus Alexandria, stammen, denn er listet ägyptische Waren auf, verwendet die altägyptischen Monatsnamen neben den römischen und zieht auch immer wieder das Nilland zum Vergleich mit den Regionen entlang des Seeweges heran.
Umstritten ist vor allem, wann diese Aufzeichnungen angefertigt worden sind. Hinweise geben Herrschernamen, die in die Beschreibungen eingeflochten sind. So erscheinen nacheinander in Kapitel 19 ein Nabatäerkönig Malichas, in Kapitel 23 der König von Saba und von Himyar namens Charibael – die gräzisierte Namensform für den in Zafar residierenden Karib’il Watar Yuhanaim –, der ausdrücklich als »Freund der römischen Kaiser« charakterisiert wird, und zuletzt ein weiterer Regent, der wahrscheinlich mit dem seinerzeit in Bombay residierenden Nahapana identifiziert werden kann. Dadurch würde sich eine zeitliche Eingrenzung zwischen 38 und 75 n. Chr. ergeben. Allerdings gibt es auch Hinweise auf eine spätere Niederschrift. Auf jeden Fall gewährt die detaillierte Beschreibung der Anlegestellen, der Völkerschaften und der auf dieser Route beförderten Handelsgüter, die der »Periplus« liefert, tiefe Einblicke in die wirtschaftlichen Beziehungen des Römischen Reiches mit dem Orient und dem ostafrikanischen Raum.