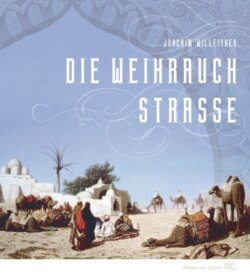Читать книгу Die Weihrauchstraße - Joachim Willeitner - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Königin von Saba bei Salomo
ОглавлениеDas zweite populäre Ereignis, bei welchem Weihrauch aus Südarabien oder dem gegenüberliegenden afrikanischen Kontinent eine wichtige Rolle spielt, ist der Besuch der »Königin von Saba«, einer ansonsten nicht näher namentlich bezeichneten Regentin, bei König Salomo in Jerusalem. Im Alten Testament wird dieses Treffen zweimal, und zwar mit nahezu identischem Wortlaut, geschildert: zum einen im 1. Buch der Könige (1 Kön. X 1–13), zum anderen im 2. Buch der Chronik (2 Chron. IX 12). Doch wirft diese angebliche Begegnung chronologische Probleme auf. Nach heutigem Wissensstand kann sie sich so nicht begeben haben: Denn König Salomo regierte im 10. Jahrhundert v. Chr. (ca. 970–930 v. Chr.), und das Reich von »Saba«, das Herrschaftsgebiet seines weiblichen Gastes – anfänglich möglicherweise erst mit der Hauptstadt Sirwah, die später nach Marib verlegt wurde – bestand erst Jahrhunderte später. Auch der in der Bibel genannte Hauptgrund ihres Besuches, nämlich die Weisheit des israelitischen Königs auf die Probe zu stellen, darf infrage gestellt werden.
Abb. 6 Fundamente der Schleuse eines Vorgängerbauwerks des antiken Staudamms von Marib.
Abb. 7 Unterste Steinlagen eines Turmes der antiken Stadtmauer von Marib; im Hintergrund der modern überbaute Stadthügel.
Man ist jetzt dank aktueller Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts in der Sabäerhauptstadt Marib darüber informiert, dass der dortige legendenumwobene Staudamm, dessen Wasserreservoir erst die Besiedlung der Oasensenke ermöglicht hatte, einen älteren Vorgänger aus vorsabäischer Zeit besaß. Dieser war so hoch von den Sedimenten des sabäerzeitlichen Stausees bedeckt worden, dass er auf jeden Fall bereits im 2. Jahrtausend v. Chr., möglicherweise sogar noch früher, angelegt worden sein muss (Abb. 6). Am Ort der späteren Reichshauptstadt (Abb. 7) lebte also bereits zu jenem frühen Zeitpunkt eine sesshafte und Ackerbau treibende Bevölkerung, die sich entsprechend organisiert hatte, um das ehrgeizige Bau- und Bewässerungsprojekt gemeinsam auszuführen und danach in Betrieb zu halten. Die angeblich von dort stammende »Königin von Saba« hätte demnach im beginnenden 1. Jahrtausend v. Chr. nur über ein bescheidenes, auf die Bewässerungsoase beschränktes »Reich« herrschen können. Man hat auch bislang – entgegen immer wieder aufkeimenden Gerüchten – in den vorsabäischen Schichten von Marib keine Belege für die Existenz der legendären Herrscherin gefunden.
Zudem wäre die »Königin von Saba«, ebenso wie ihre Untertanen, des Lesens und Schreibens unkundig gewesen, da nach heutigem Kenntnisstand die altsüdarabische Schrift erst später entwickelt wurde. Denn die ältesten auf südarabischem Boden aufgefundenen Textdenkmäler werden mit Vorbehalt – und in der Fachwelt nicht unumstritten – in das frühe 7. Jahrhundert v. Chr. datiert. Da diese frühesten Belege bereits ein voll ausgebildetes Schriftsystem erkennen lassen, muss es ältere Vorstufen gegeben haben, die aber bislang nicht zutage getreten sind. Die einzelnen Buchstaben der 29 Konsonanten umfassenden Schrift – denn die Vokale werden in den semitischen Sprachen (so auch im Arabischen, dessen Schriftzeichen sich aus dem Nabatäischen entwickelt haben dürfte) nicht geschrieben – weisen dabei in ihrem Erscheinungsbild eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Äthiopischen auf, bei dem es sich allerdings um eine Silbenschrift handelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben sich die altsüdarabischen Schriftzeichen aus der 22 Konsonanten umfassenden phönizischen Buchstabenschrift entwickelt, die wiederum ihrerseits im 2. Jahrtausend v. Chr. im syrisch-palästinensischen Raum aus dem Keilschrift-Alphabet von Ugarit hervorgegangen ist.
Die ältesten Texte verlaufen »bustrophedon« (»wie der Ochse beim Pflügen wendet«), das heißt, die Buchstaben wurden abwechselnd erst in die eine und in der nachfolgenden Zeile dann in die entgegengesetzte Richtung geschrieben, wobei sie jeweils auch spiegelbildliche Gestalt annahmen. Erst im Lauf der Zeit kam es zur einheitlichen Schreib- und Leserichtung von rechts nach links des gesamten Textes. Zusätzlich weisen in der Anfangsphase die einzelnen Buchstaben noch eine unterschiedliche Höhe zueinander auf. Die jüngeren Texte besitzen dann gleich hohe Buchstaben, die sich genau zwischen zwei parallele, waagrechte Begrenzungslinien einfügen (Abb. 8). Ein drittes relatives Datierungskriterium stellt die Beobachtung dar, dass die Trennung der einzelnen Wörter, die anfänglich ohne Lücke aneinandergereiht wurden, durch senkrechte Striche offensichtlich ebenfalls erst später erfolgt. Da aber unbekannt ist, wann die einzelnen Neuerungen eingeführt wurden, und es sicher nicht schlagartig im gesamten südarabischen Raum zu den jeweiligen Umstellungen gekommen ist, liefern die genannten paläografischen Kriterien nur grobe Anhaltspunkte für das jeweilige Alter der Texte. Es ist sogar so, dass die anhand solcher paläografischen Beobachtungen gewonnenen Datierungen gelegentlich in Widerspruch stehen zu solchen Resultaten, die mit anderen Methoden gewonnen wurden. Unbestritten stammt das bislang späteste datierbare Schriftdokument aus dem Jahr 669 der himyaritischen Zeitrechnung, was dem Zeitraum von 559/60 n. Chr. entspricht.
Eine Schlüsselstellung, was die umstrittenen Anfänge der altsüdarabischen Schrift betrifft, könnte der Fundort Hadschar Bin Humeid am Ostrand des Wadi Beihan gegenüber der Stelle, wo das Wadi Mablaqa abzweigt, einnehmen. Mit seiner strategisch günstigen Lage kontrollierte er den östlichen Aufstieg zum Mablaqapass, einem wichtigen Teilstück der Weihrauchstraße, und stellte dadurch das Gegenstück zur antiken Stadt Haribat, dem heutigen Ruinengelände von Hadschar Henu az-Zureir im Wadi Harib, dar, die das westliche Ende dieser Passage beherrschte. Das etwa 15 km südlich der qatabanischen Hauptstadt Timna gelegene Hadschar Bin Humeid, dessen antiker Name nicht überliefert ist, präsentiert sich heute als etwa 25 m hoher Tell, dessen dem Wadi zugewandte Westseite durch die immer wieder vorbeigeflossenen Wassermassen stark abgeschwemmt ist. Dadurch liegen die einzelnen Siedlungsschichten in ihrer stratigrafischen Abfolge am ausgewaschenen Steilhang frei. Eine an dieser Stelle im Jahr 1951 erfolgte Stufengrabung erbrachte 19 Schichten, die von oben nach unten – bis hinab in den jungfräulichen Schlammboden des Wadigrundes – mit der Buchstabenfolge von A bis S bezeichnet wurden. Erstmals war es dank der sauberen Schichtentrennung dem Ausgräber Gus Van Beek möglich geworden, mit den jeweils darin aufgefundenen Tonscherben eine relative Keramikchronologie für Südarabien zu erstellen, deren prinzipielle Richtigkeit mittlerweile durch Untersuchungen an anderen Orten – wie den französischen Grabungen in Schabwa – bestätigt worden ist. Ein absolutes Datum lieferte ein verkohlter Dachbalken aus der drittältesten Schicht Q, dessen Alter im Jahre 1956 mittels der damals gerade neu entwickelten Radiocarbon-(C 14)-Messung auf 2807 +/– 160 Jahre bestimmt wurde. Dies entspricht einem Mittelwert von 852 v. Chr., der zwischen den Jahren 692 und 1010 v. Chr. pendeln kann. Anderthalb Meter unter dieser somit datierten Schicht wollen die Ausgräber eine Krugscherbe entdeckt haben, die in erhaben herausgearbeiteten Lettern die Buchstabenfolge KHLM aufwies, die sich am ehesten als Personen- bzw. Eigentümername Kahalum deuten lässt. Die kurze Krugaufschrift wäre somit rund 3000 Jahre alt, und die Erfindung der altsüdarabischen Schrift, die einige Zeit vorher stattgefunden haben müsste, könnte dann bereits ins ausgehende 2. Jahrtausend v. Chr. gesetzt werden. Allerdings bestreiten die meisten Philologen die Relevanz dieses Fundes und gehen davon aus, dass die ergrabene Schichtenabfolge durch ihre Nähe zum ausgespülten Hang in diesem Abschnitt gestört war und die Krugaufschrift nicht älter als etwa 700 v. Chr. sein kann.
Die Entzifferung und Datierung der altsüdarabischen Inschriften wird dadurch erschwert, dass die meisten Belege nur sehr kurz gefasst sind. Vielfach handelt es sich lediglich um knappe Äußerungen mit Filiationsangaben nach dem Schema »X, Sohn des Y, Enkel des Z, hat …«. Das Spektrum der Textgattungen reicht dabei von Totenstelen bzw. Grabsteinen über Votiv- und Stiftungsinschriften bis hin zu apotropäischen Formeln sowie einfachen Namens- und Besitzerangaben. Die Anzahl der langen und ergiebigen Texte, wie die im Almaqahtempel von Sirwa aufgestellten ausführlichen Tatenberichte des Yitha’amar Watar und des Karib-il Watar, hält sich hingegen in Grenzen.
Seit rund 30 Jahren kennt man neben der vornehmlich aus geraden Elementen zusammengesetzten und an Rundungen armen Schrift, die vor allem an Steindenkmälern oder Bronzetafeln zu finden ist und demnach vielfach repräsentative Aufgaben erfüllte, auch eine gerundete »kursive« Schreibschrift. Diese offensichtlich für den »Alltagsbedarf« der des Lesens und Schreibens kundigen Südaraber – wobei über die Analphabetenquote der damaligen Bevölkerung nur Mutmaßungen angestellt werden können – konzipierte Schrift, mit der vor allem Verwaltungsdokumente, private Verträge und Ähnliches festgehalten wurden, war natürlich auch nur auf leicht beschaffbaren und gut transportablen Schriftträgern sinnvoll. So wurden die Minuskeln damals offensichtlich nur in Holzstäbchen und die Mittelrispen von Palmwedeln, also in leicht vergängliche organische Materialien, eingeritzt. Diese anfälligen Schriftträger konnten sich nur in Ausnahmefällen – bei extrem trockener und warmer Witterung – erhalten, und es ist entsprechend sicher, dass die meisten dieser Textzeugnisse, von denen man derzeit rund hundert Beispiele kennt, im Lauf der Jahrtausende unwiederbringlich verloren gegangen sind.
Kein alttestamentlicher Exeget glaubt heute ernsthaft daran, dass der Grund für den Besuch der südarabischen Königin bei Salomo tatsächlich nur darin bestanden hat, »ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen«. Vielmehr dürfte ihr Erscheinen – immer eine Historizität des Ereignisses vorausgesetzt – in Zusammenhang mit irgendwie gearteten Handelsbeziehungen zu sehen sein, wie sie Salomo auch zu anderen Herrschern des Vorderen Orients unterhielt. Südarabien konnte Weihrauch im Tausch gegen Kupfer anbieten, über das Salomo mit den Minen im Wadi Araba reichlich verfügte. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die »Königin von Saba« arabische Handelsleute vertrat, die im rasch expandierenden salomonischen Reich eine ernsthafte Konkurrenz und Bedrohung für ihre eigenen Wirtschaftsbeziehungen heranwachsen sahen und sich rechtzeitig um einen friedlichen Interessensausgleich oder zumindest um ein klärendes Gespräch bemühen wollten.
Abb. 8 Heute verschwundene sabäische Inschrift, die im Stadtgebiet von Marib wiederverbaut war.
Als Hauptausfuhrhafen für das begehrte Kupfer Salomos ist Ezion Geber überliefert, das üblicherweise am nördlichen Ende des Roten Meeres bei Eilat bzw. Aqaba oder der diesen beiden Orten vorgelagerten Insel lokalisiert wird. Dieses kleine Eiland wird heute nahezu vollständig von einer – allerdings nicht pharaonischen, sondern erst kreuzfahrerzeitlichen – Festung eingenommen, der sie auch ihren Namen als »Dschesiret al-Pharaun« (Pharaoneninsel) verdankt. Als Schiffsbesatzung fungierten aber keine Untertanen Salomos, da die Hebräer über keinerlei Seefahrerpraxis verfügten, sondern phönizische Matrosen, die König Hiram zur Verfügung gestellt hatte. Von Ezion Geber aus startete man auch in das legendäre Goldland Ophir, das, ebenso wie Punt, noch immer seiner endgültigen Lokalisierung harrt. Das Buch der Könige (1 Kön. IX 26–28) beschreibt dies folgendermaßen: »König Salomo baute auch eine Flotte in Ezion Geber, das bei Eilat an der Küste des Schilfmeeres in Edom liegt. Hiram schickte seine Leute, geübte Seefahrer, mit den Leuten Salomos zu Schiff aus. Sie fuhren nach Ophir, holten von dort 420 Talente Gold und brachten es dem König Salomo.«
Weiteres Gold bezog Salomo aus Arabien: »Das Gewicht des Goldes, das alljährlich bei Salomo einging, betrug 666 Goldtalente. Dabei sind nicht eingerechnet die Abgaben der Kaufleute und die Einnahmen, die von den Händlern, von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern des Landes kamen« (1 Kön. X 14ff.).
Der alttestamentliche Bericht betont hier also den Reichtum König Salomos. Dieser fand seinen Niederschlag bekanntlich auch darin, dass der König in seiner Hauptstadt Jerusalem nicht nur den Neubau des Jahwe-Tempels, sondern auch eines prachtvollen Palastes – beide Bauten ausgeschmückt durch phönizische Kunsthandwerker – initiierte. Allerdings wurde mit diesen prunkvollen Baumaßnahmen auch der Grundstein für das Auseinanderbrechen des Reiches gelegt, denn nach dem Tod Salomos weigerte sich die Mehrheit der zwölf Stämme, die von ihnen durch Abgaben und Frondienste erheblich mitfinanzierte aufwendige Hofhaltung weiter mitzutragen. Das Ergebnis war, dass der Staat, welcher unter Salomo seine unbestrittene Blüte erlebt hatte, in zwei Teile zerfiel: in das Südreich Juda – mit der Hauptstadt Jerusalem und Rehabeam als erstem König – und das Nordreich Israel – mit der ersten Residenz in Sichem und Jerobeam an der Spitze.
Statt der sprichwörtlich gewordenen Klugheit Salomos manifestierte sich hier seine politische Kurzsichtigkeit. Es sind ohnehin viele seiner Äußerungen, die im Alten Testament als seine eigenen Erkenntnisse dargestellt werden, teils sogar wortwörtliche Übernahmen altägyptischer Weisheitslehren, die mehr als ein Jahrtausend zuvor am Nil niedergeschrieben worden waren.
Man muss bei der Frage nach der Historizität des Besuchs der »Königin von Saba« in Jerusalem auch berücksichtigen, dass die Niederschrift der Episoden des »Buchs der Könige« und der »Chronik«, die zuvor nur mündlich tradiert worden waren, wohl erst nach 583 v. Chr. erfolgte – dem Jahr, in welchem das Volk Israel aus der »Babylonischen Gefangenschaft« entlassen wurde und in das »Gelobte Land« zurückkehren durfte. In den Jahrhunderten seit der Herrschaft des Salomo waren die entsprechenden Berichte sicher immer mehr ausgeschmückt und »aktualisiert« worden, wie man dies auch für andere Passagen des Alten Testamentes nachweisen kann.
Wie rasch die Überlieferung um die Königin von Saba auch in außerbiblischen Quellen modifiziert worden ist, zeigt eine verblüffende Textparallele, die der Historiker Flavius Josephus in seinen »Jüdischen Altertümern« (ant. jud. VIII 158f. & 165ff.) erzählt. Denn dort wird als Protagonistin, die nach Jerusalem zu Salomo reist, die »Beherrscherin von Ägypten und Äthiopien« namens Nikaule genannt. Sie ist identisch mit der Pharaonin Nitokris, die unter anderem von Herodot (II 100) erwähnt wird, und für die dort die im »Turiner Königspapyrus« belegte Regentin Net-iqeret (Nt-jqrt), mit der um 2150 v. Chr. das Alte Reich am Nil seinen Abschluss fand, das Vorbild abgab. Obwohl Flavius Josephus selbst dem jüdischen Glauben angehörte und somit auch der Tradition des Alten Testaments verpflichtet war, verliert er bei seiner Schilderung der Regierungszeit Salomos, der bei ihm Solomon genannt wird, kein Wort über Saba und dessen Königin. Ersetzt man in den »Jüdischen Altertümern« die beiden afrikanischen Landesbezeichnungen durch die südarabische, könnte man glauben, den biblischen Bericht vor sich zu haben, wenn es heißt: »Die Beherrscherin von Ägypten und Äthiopien, die nach Weisheit dürstete …, hatte so viel von Solomons Weisheit und Tugenden gehört, dass sie vor Verlangen brannte, ihn persönlich zu sehen. Denn sie wollte aus eigener Erfahrung seine Vorzüge kennenlernen und sich nicht mit dem bloßen Gerücht begnügen … Sie beschloss daher, sich zu Solomon zu begeben, um seine Weisheit auf die Probe zu stellen und ihm schwierige Fragen zur Entscheidung vorzulegen, und kam mit großer Pracht und glänzendem Aufwand nach Jerusalem. In ihrem Gefolge hatte sie Kamele, die mit Gold, verschiedenen Spezereien und kostbaren Edelsteinen reich beladen waren. Der König empfing sie mit besonderer Freundlichkeit und löste die ihm vorgelegten spitzfindigen Fragen infolge seines scharfen Verstandes schneller als man glaubte. Die Königin geriet in Erstaunen, da sie merkte, dass seine Weisheit nicht nur ihre eigene übertraf, sondern auch noch größer war, als das Gerücht sie bezeichnet hatte … ›Alles, oh König‹, sagte sie, ›was das Gerücht zu uns trägt, erregt Zweifel in uns. Von dem aber, was du besitzest, deiner Weisheit und Einsicht und deinen königlichen Schätzen, hat der Ruf nichts Unwahres berichtet, sondern ist vielmehr weit hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben, was mir jetzt klar wird, da ich dein Glück vor Augen habe … Wahrlich, das Volk der Hebräer und deine Diener und Freunde sind glücklich zu preisen, da sie täglich dein Angesicht schauen und deine Weisheit hören. Gott sei gelobt, der dieses Land und Volk so sehr liebt, dass er dich zum König darüber gemacht hat.‹ Darauf dankte sie dem König für die freundliche Aufnahme mit Worten und Geschenken. Sie gab ihm 20 Talente Gold sowie eine ungeheure Menge von Gewürzen und kostbaren Edelsteinen. Auch soll sie ihm die ersten Pflanzen des Opobalsams, der jetzt noch in unserem Lande wächst, geschenkt haben. Solomon machte ihr darauf Gegengeschenke, wie sie ihrem Wunsch entsprachen. Er versagte ihr nichts, sondern bewies sich ihr gegenüber in wahrhaft königlicher Weise hochherzig und freigiebig. Nachdem sie so gegenseitig ihre Geschenke ausgetauscht hatten, begab sich die Königin von Ägypten und Äthiopien auf den Heimweg.«
Den legendären Reichtum Südarabiens spiegelt neben den Legenden um die Königin von Saba auch der Hymnus des alttestamentlichen Propheten Jesaia (Jes. 60,6) auf das gesegnete Jerusalem wider: »Denn der Reichtum des Meeres strömt dir zu, die Schätze der Völker kommen zu dir. Zahllose Kamele bedecken dein Land, Dromedare aus Midian (im heutigen Südjordanien/Nord-Saudi-Arabien) und Epha. Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn.«
Schließlich treten die Sabäer, diesmal als Bösewichte, auch im alttestamentlichen Bericht über das Leben des Hiob (Hiob I 15) in Erscheinung. Den Protagonisten dieser biblischen Episode verfolgten, trotz seines gottgefälligen Lebenswandels, Unglück und Krankheit, nachdem Gott und Satan eine Wette darüber abgeschlossen hatten, ob Hiob auch in Zeiten der Not blind an seinem Glauben festhalten würde. Am Anfang seines Leidensweges ereilte ihn, während er an einem Gastmahl seiner Kinder teilnahm, die erste der sprichwörtlich gewordenen »Hiobsbotschaften«, denn es »kam ein Bote zu Hiob und meldete: ›Die Rinder waren beim Pflügen, und die Esel weideten daneben. Da fielen Sabäer ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten.‹« Als Heimat des Hiob nennt das Alte Testament einleitend das nicht näher lokalisierte »Land Uz«, das – nimmt man den biblischen Bericht wörtlich – in nicht allzu großer Distanz von den Wohnsitzen bzw. Weidegründen der Sabäer entfernt liegen kann. Und tatsächlich existiert in der heutigen südomanischen Provinz Dhofar, unweit der Grenze zum Jemen, die nach Hiob (arab. »Ayoub«) benannte Ansiedlung Nabi Ayoub. In dieser malerisch auf den Hängen des Dschebel Akhdar, des »Grünen Berges«, gelegenen Ortschaft lokalisieren die Moslems das Grab des alttestamentlichen Heiligen, das sich zwischenzeitlich zu einem veritablen Pilgerzentrum entwickelt hat.
Anders als im Alten Testament, wo die »Königin von Saba« anonym bleibt, erhält sie in der christlichen Überlieferung Äthiopiens den Namen Maketa. Zudem gibt es dort die Tradition, wonach sie in Jerusalem von Salomo geschwängert worden sein soll und nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat einen Sohn zur Welt brachte, der Menelek genannt wurde. Er soll das äthiopische Herrschergeschlecht begründet haben, von dem selbst noch der letzte König, der 1974 durch das Militär gestürzte und im Jahr darauf verstorbene Hailie Selassie I., seine Abkunft herleitete. Deswegen zählte auch »Löwe von Juda« zu seiner Herrschertitulatur.
Bei den moslemischen Arabern erscheint die Besucherin bei Salomo als Balqis oder Bilqis. Neben den vielen Legenden, die sich auch dort um sie ranken, tritt sie im Koran in Erscheinung, und zwar in den Versen 21–45 der zu Mekka offenbarten 27. Sure, die den Beinamen »Die Ameise« trägt.