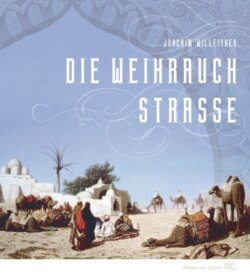Читать книгу Die Weihrauchstraße - Joachim Willeitner - Страница 8
Die geografischen Gegebenheiten der Weihrauchstraße Die Arabische Halbinsel
ОглавлениеDie Weihrauchstraße stellte die Verbindung her zwischen dem Südosten der Arabischen Halbinsel, wo im heutigen jemenitisch-omanischen Grenzgebiet die den Weihrauch liefernden Sträucher wachsen, und dem Norden Arabiens, wo die Distribution des wertvollen Rohstoffs an die diversen Abnehmer vor allem in Richtung Levante erfolgte. Allerdings machten die großen Wüstengebiete im Zentrum der Arabischen Halbinsel deren diagonale Durchquerung, die die direkte und damit kürzeste Wegstrecke gebildet hätte, unmöglich. Stattdessen mussten sich die Handelskarawanen zunächst im Landesinneren Südarabiens in etwa parallel zur Südküste nach Westen begeben, bis sie ihre Reiserichtung fast im rechten Winkel abändern konnten, um ab dann, diesmal im Hinterland parallel zur Küste des Roten Meeres, nach Norden zu ziehen. Das Gebirge, das sie dabei antrafen und dessen Längsverlauf von Süden nach Norden sie dann folgten, hatte sich vor Jahrmillionen durch die Stauchung aufgefaltet, die die eigenständige Arabische Kontinentalplatte, eingequetscht zwischen der Eurasischen, der Indischen und der Afrikanischen Kontinentalplatte, durch deren Verschiebungen, die sogenannte Kontinentaldrift, erfahren hatte.
Durch ihre Lage fungiert die Arabische Halbinsel als Landbrücke zwischen den beiden Kontinenten Afrika und Asien und wird – schon allein weil im Osten die Verbindungslinie zwischen dem Arabischen Golf und dem Mittelmeer länger ist als im Westen zwischen dem Roten und dem Mittelmeer – dem letztgenannten Kontinent zugerechnet, auch wenn es geologisch eher einen Teil Afrikas darstellt. Allerdings wird zur eigentlichen Halbinsel nur das Areal gezählt, das sich südlich einer um den 30. nördlichen Breitengrad nach Norden gekrümmten Linie jeweils zwischen den Nordspitzen des flachen Arabischen Golfs im Osten (etwa beim Schatt al-’Arab, der gemeinsamen Einmündung von Euphrat und Tigris) und des tiefen Roten Meeres im Westen (bei Eilat in Israel bzw. Aqaba in Jordanien) ausdehnt. Wegen dieser nur vagen Begrenzung im Norden, die sich nicht an den heutigen politischen Grenzen orientiert, sondern in der Regel über Saudi-Arabien hinaus auch die südlichen Teile Jordaniens und des Irak mit einschließt, schwanken die Größenangaben für die Arabische Halbinsel zwischen 3 und 3,5 Millionen km2, von denen der größte Staat, das Königreich Saudi-Arabien, rund 2,25 Millionen km2 beansprucht. Neben den beiden genannten Meeren, die die Ost- und die Westgrenze bilden, findet sich am südlichen Ende der fast trapezförmigen Landmasse – sieht man einmal von der breiten Landspitze ab, die im Südosten den Ausgang des Persisch-Arabischen Golfs zur Straße von Hormuz verengt – das Arabische Meer bzw. der Golf von Aden als Randgebiet des Indischen Ozeans.
Vereinfacht ausgedrückt hat die Arabische Halbinsel die Gestalt einer großen gekippten Hochscholle, die in ihrem Mittelteil Höhen um 1000 m ü. d. M. erreicht. Nach Westen hin steigt sie zu einem Bergland an, das parallel zur Küstenlinie des Roten Meeres praktisch die gesamte Halbinsel entlang verläuft. Im Norden wird dieses bis etwa auf Höhe von Dschidda und Mekka als Hedschasgebirge bezeichnet, danach als Asirgebirge und zuletzt im Süden als Bergjemen, der dort mit dem Dschebel Nabi Schuaib, einem ehemaligen Vulkan, bis zu 3620 m ü. d. M. erreicht. In diesem Abschnitt sorgt der zyklisch seine Windrichtung wechselnde Monsun, dessen mitgeführte Wolken sich an den Berghängen abregnen, für ausgiebige Regenfälle im Hochsommer und geringere, aber für einen Terrassenfeldbau in den Gebirgstälern ausreichende Niederschläge im Winter, die gelegentlich mehr als 500 mm im Jahresmittel betragen, allerdings Richtung Osten immer spärlicher werden. Hinzu kommt, dass das Bergland vielfach mit fruchtbaren vulkanischen Böden gesegnet ist. Am Gebirgsfuß ist immerhin noch Bewässerungslandwirtschaft möglich (Abb. 4).
Abb. 4 Terrassenkulturen im nordjemenitischen Bergland.
Die geschilderten klimatischen Verhältnisse begünstigten die Besiedlung Südarabiens bereits seit prähistorischer Zeit, wobei die Ansiedlungen, wann immer möglich, des besseren Schutzes wegen, aber um den Preis eines mühseligen Zugangs auf den Gipfeln und Graten der Höhenzüge angelegt wurden. Und nicht zufällig erfolgten die ersten Staatenbildungen auf der Arabischen Halbinsel – in Gestalt der Reiche von Saba, Qataban, Ma’in, Ausan und Hadramaut – an deren Südrand, im Gebiet der beiden heutigen Staaten Jemen und Oman zwischen den beiden Meerengen des Bab el-Mandeb und der Straße von Hormuz. Denn der aufgebogene Rand der arabischen Tafel ragt gerade noch in das heutige Sultanat Oman hinein, wo sich in dessen äußerstem Süden, in der an den heutigen Jemen angrenzenden Provinz Dhofar, die bis zu 1680 m hohen Karaberge erheben. Vor allem hier sowie in Teilen der vorgelagerten, bis zu 20 km breiten Küstenebene, wo die alljährlichen Monsunregenfälle während der Sommermonate ebenfalls zum Tragen kommen, wächst noch heute der Boswelliastrauch, aus dessen Baumharz Weihrauch gewonnen wird (Abb. 5).
Weiter nach Westen entlang der Südküste des Indischen Ozeans auf dem Gebiet des vormaligen Südjemen ist die dort zwischen 30 und 60 km breite Küstenebene ebenso wie das hinter ihr steil aufsteigende Bergland wiederum überwiegend regenarm und wüstenhaft. Lediglich in wenigen Abschnitten am Gebirgsrand ermöglichen Niederschläge von 100 bis 250 mm pro Jahr dauerhafte Ansiedlungen. Im Hochland passte sich die Bevölkerung den schwierigen klimatischen Gegebenheiten an und nutzte schon seit der Antike entsprechend geeignete Passagen der tief eingeschnittenen Täler als Bewässerungsoasen, indem sie die Wadis mit ausgeklügelten Dammbauten abriegelte. Dadurch wurden die spärlichen, in den Bergen niedergehenden Regenfälle am weiteren Abfließen gehindert und gespeichert, um sie anschließend auf die Felder leiten zu können.
Wiederum anders zeigen sich die Verhältnisse in der schmalen Küstenebene, die sich zwischen dem Steilabfall des Bergjemen und dem Roten Meer erstreckt und die als Tihama bezeichnet wird. Hier bewirkt die Nähe des Meeres zwar ebenfalls ein überwiegend schwülheißes Klima, bei dem sich die Temperaturwerte im Laufe des Jahres kaum verändern, doch ist diese Küstenregion – sicher auch dank der Nähe zum fruchtbaren Bergjemen – erheblich dichter besiedelt.
Übrigens verdankt der Jemen der Lage am südlichen Ende der Arabischen Halbinsel auch seinen Namen, denn dieser leitet sich vom arabischen Wort für »rechts«, »jemin«, ab. Denn wenn man eine Landkarte im ursprünglichen Sinn des Wortes richtig »orientiert«, also mit dem Osten nach oben ausrichtet, liegt dieses Land am rechten Rand der Landmasse. Als in der islamischen Periode die Orte Mekka und Medina zu den religiösen Zentren der Moslems aufstiegen, setzte sich allmählich die Interpretation durch, wonach der Jemen entsprechend das Land »rechterhand« dieser heiligen Stätten sei.
In Richtung zum Persisch-Arabischen Golf senkt sich die arabische Hochscholle in mehreren aus abgelagerten Sedimenten bestehenden Schichtstufen, deren einzelne lang gestreckte und gestaffelte Schichtstufenränder die Halbinsel in einem weiten Bogen von Norden nach Süden durchziehen, allmählich ab. Am markantesten ist hier der über 1000 km lange Dschebel Tuwayq, der sich zwischen 300 und 500 m aus der Umgebung erhebt. Das Landesinnere entspricht dann dem Bild, das man üblicherweise mit Arabien verbindet: Es wird von großflächigen Wüstenarealen eingenommen, über die ganzjährig eine trockene Hitze brütet, hervorgerufen durch die Lage dieses Landstrichs innerhalb der Passatzone. Zu diesen großen sandgefüllten Senken gehören vor allem die Rub al-Chali, das »leere Viertel«, im Südosten, das mit rund 0,7 Millionen km2 Fläche das größte Sandmeer der Welt darstellt, und die Nefud im Nordwesten. Hier ist ein Überleben nur in Oasen möglich, wo artesische Quellen an die Oberfläche treten oder sich Wasservorräte in Karsthöhlen angesammelt haben. Vielfach stellen dort Dattelpalmen die einzig nutzbare Vegetation dar.
Der Übergang vom regenreichen Bergland zu den unfruchtbaren Wüstengebieten erfolgt allerdings nicht schlagartig. Vielmehr dehnt sich dazwischen eine weitläufige Trockensteppe mit unregelmäßigen Niederschlägen von rund 100 mm im Jahresmittel aus, die von Nomaden als Weidegebiet für die Ziegen-, Schaf- und Dromedarherden genutzt wird. Diese Vegetationszone und nicht, wie man meinen könnte, die Wüste nimmt den größten Teil der Arabischen Halbinsel ein.
Neben den bereits genannten Höhenzügen des Bergjemen im Südwesten erhebt sich auch im äußersten Osten – begrenzt vom Golf von Oman östlich der Straße von Hormuz – eine über 600 km lange Hochgebirgskette (»Omangebirge«), die in Gestalt des Dschebel Achdar bis zu einer Höhe von 3352 m ü. d. M. aufsteigt. Nach Westen flacht sie sich zu den Wüstengebieten im Inneren des Landes, die Ausläufer der Rub al-Chali darstellen, ab. Das Gebirge beherrscht die Halbinsel von Mussandam, deren äußerste, in die nur 60 km breite Straße von Hormuz vorspringende Spitze, der Ru’us al Dschebel, heute als Exklave – da er durch einen rund 70 km breiten Streifen der Vereinigten Arabischen Emirate vom übrigen Staatsgebiet getrennt ist – zum Oman gehört. Dem Omangebirge ist ebenfalls eine schmale Küstenebene, die Batina, vorgelagert, in der sich auch die heutige Landeshauptstadt Maskat befindet. Sie bildet das wirtschaftliche Kerngebiet des Landes, das durch zahlreiche Grundwasserbrunnen und vor allem dank der Bewässerung mittels unterirdisch angelegter und so die Wasserverdunstung reduzierender Kanäle – im Oman Faladsch und in den anderen arabischen Ländern Qanat genannt – erschlossen worden ist.
Dem arabischen Festland sind mehrere Inseln vorgelagert. Aufgrund ihrer Nähe zur Straße von Hormuz bilden die fünf Kuria-Muria-Inseln – 1854 vom Sultan von Oman an die britische Kolonie Aden abgetreten und 1967 zurückerhalten – seit Jahren einen Zankapfel zwischen dem Oman und Iran.
Von den küstennahen Inseln des Roten Meeres stellt Kamaran mit 57 km2 die Größte dar. Dennoch spielt das gerade einmal 13 km2 große Eiland von Perim eine strategisch wichtigere Rolle, denn es beherrscht die Passage durch das Bab el-Mandeb. Geologisch handelt es sich um einen halbkreisförmigen, an seiner höchsten Stelle 65 m aus dem Meer aufragenden Kraterrand eines erloschenen Vulkans, der im »Periplus Maris Erythraei« (Peripl. XXV), einem antiken Seefahrerhandbuch, als »Diodoros-Insel« erwähnt wird. Der Insel gegenüber befand sich auf dem arabischen Festland die unter anderem bei Ptolemaios (VI 7,7), Plinius (nat. VI 104) und Strabo (XVI 4,5) erwähnte antike Stadt Okelis, das heutige Schech Said. Im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. gehörte sie zum Reich von Qataban, dann dürfte sie in himyaritischen Besitz übergegangen sein.
Ähnlich strategisch bedeutend war die im Indischen Ozean gelegene, 3626 km2 große und bis zu 1503 m aus dem Meer ragende Insel Sokotra, das antike Dioskorides, mit ihren drei kleineren südwestlich vorgelagerten Eilanden. Denn sie befindet sich vor dem östlichen Horn von Afrika nahe dem Kap Guardafui, dem »Gewürzkap« (»Aromaton Emporion«) des antiken Geografen Ptolemaios. Die Insel soll laut Überlieferung 52 n. Chr. durch den heiligen Thomas auf seinem Weg nach Indien zum Christentum bekehrt worden sein. Nach Auskunft des zeitgenössischen arabischen Historikers Abu Said Hassan gehörte die Bevölkerung diesem Glauben noch bis mindestens ins 10. Jahrhundert an. Der nachantike Name »Sokotra« stammt aus dem Sanskrit, wo »dvipa suchadhara« »Insel der Wonne« bedeutet. Als günstiger Ankerplatz auf dem Weg nach Indien wechselte sie mehrfach den Besitzer: Portugal okkupierte sie 1505 und verlor sie 1835 an die Britische Ostindien-Kompanie. Fortan wurde sie durch Großbritannien kontrolliert, zuletzt als Teil des Protektorats Aden bzw. Südjemen, bis dieses 1967 in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Bald danach wurde die Inselhauptstadt Tamrida in die arabische Ortsbezeichnung al-Hadibu umbenannt.
Abb. 5 Boswellia-Strauch im Wadi Daucha im Süden des Oman.
Während die Meere um die Arabische Halbinsel und deren unmittelbare Küstenregionen durch die antiken Seefahrer bald relativ gut bekannt waren, stellte das Landesinnere weitgehend eine Terra incognita dar. Entsprechend grob war die Einteilung Arabiens durch die griechisch-römischen Geografen und Historiker in nur zwei Teile: der Norden – von Südsyrien bis etwa zum nördlichen Hedschas – wurde als »Arabia deserta« (»wüstenhaftes Arabien«) und der anschließende Süden im Kontrast dazu als lateinisch »Arabia felix« bzw. griechisch »Arabia eudaimon« (»glückliches Arabien«) bezeichnet. Im 6. Buch seiner »Geographia« schlug dann der antike Astronom und Kartograf Klaudios Ptolemaios, der in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. vornehmlich in Alexandria wirkte, eine Dreiteilung der Arabischen Halbinsel vor, indem er im Norden – benannt nach der Nabatäerhauptstadt Petra – »Arabia petraea«, das sich annähernd mit der späteren römischen »Provincia Arabia« deckte, hinzufügte, doch scheint sich diese Untergliederung Arabiens nicht durchgesetzt zu haben.
In diesem Zusammenhang hat kürzlich eine genaue Untersuchung der antiken Quellen durch Jan Retsö ergeben, dass der Begriff »Arabia eudaimon« der griechischen Autoren ursprünglich die gesamte Arabische Halbinsel bezeichnete und seinen Ursprung möglicherweise nicht in den vermeintlichen Reichtümern der südarabischen Weihrauch-Königreiche hat, sondern sich von den mutmaßlich im Persischen Golf beheimateten »Glücklichen Inseln« herleitet. Die Bezeichnung »Arabia felix« soll sogar erst im 4. Jahrhundert von christlichen Bibelkommentatoren als Bezeichnung des Landes der biblischen Königin von Saba eingeführt worden sein.
Mittelalterliche arabische Geografen nahmen in der Regel eine an den topografischen und klimatischen Gegebenheiten orientierte Unterteilung in fünf Großregionen vor, nämlich Nadschd, Hedschas, Tihama, Jemen und Arud.
Nadschd war das Plateau, das sich von der Nafudwüste im Nordwesten bis zur Rub al-Chali im Südosten erstreckt.
Der Hedschas zerfällt seinerseits in zwei Teile, nämlich im Norden das Hochland, das nach Westen zum Roten Meer und nach Osten in das Plateau des Landesinneren abfällt, sowie im Süden die Gebirgsketten des Asir, auch Sarat (»Hochland«) genannt.
Tihama ist die nach Osten hin ansteigende Küstenebene entlang der Küste des Roten Meeres. Im Gebiet des heutigen Saudi-Arabien wird ihre nördliche Hälfte Tihamat al-Hedschas und das südlich anschließende Areal Tihamat Asir genannt. Der Begriff Tihama als Bezeichnung für das Flachland vor den Bergen taucht offensichtlich schon in sabäischen Inschriften auf.
Im Gegensatz zur heutigen politischen Landkarte beschränkte sich der Begriff Jemen damals auf die Südwestecke der Arabischen Halbinsel, deckte sich also weitgehend mit dem Gebiet des vormaligen Nordjemen und schloss nur den Westteil des ehemaligen Südjemen ein.
Mit Arud schließlich wurde die gesamte östliche Landeshälfte vom Irak im Norden bis zum Arabischen Meer im Süden bezeichnet.