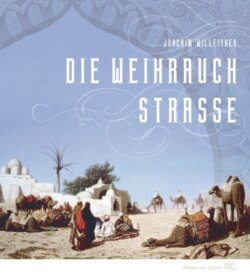Читать книгу Die Weihrauchstraße - Joachim Willeitner - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеDer Boswelliastrauch (Bowellia carteri) ist ein eher unscheinbares Gewächs: kleine gekräuselte Blätter bedecken die dunklen Äste, und mit auffälligen Blüten kann die Pflanze aus der Gattung der Balsambaumgewächse nicht aufwarten (Abb. 1). Dennoch lieferte sie im Altertum einen der kostbarsten Rohstoffe: Weihrauch. Das an Duftstoffen reiche getrocknete Harz dieses Bäumchens – bei Normaltemperaturen fast geruchlos, doch beim Erhitzen sein Aroma verströmend – erzielte seinerzeit Höchstpreise. Als Luxusgut brachte man es über Tausende von Kilometern auf dem Rücken von Kamelen, die dafür in langen Karawanen monatelang unterwegs waren, vom südlichen Ende der Arabischen Halbinsel aus dem Gebiet der heutigen Staaten Jemen und Oman, bis die teure Fracht schließlich ihre Abnehmer am Mittelmeer erreichte (Abb. 2). Als nördlicher Endpunkt des mehrere Tausend Kilometer langen Handelsweges, der »Weihrauchstraße«, galt die Hafenstadt Gaza. Dort musste um Christi Geburt – noch ohne Berücksichtigung der hohen römischen Einfuhrzölle – für ein Pfund Weihrauch der höchsten Qualitätsstufe bereits ein Betrag von sechs Denaren entrichtet werden, was dem Gehalt eines Arbeiters von zwei Wochen entsprach. Überliefert ist die Einschätzung von Plinius dem Älteren in seiner »Naturgeschichte« (nat. XII 84), wonach seine Landsleute jährlich geschätzt mehr als 100 Millionen Sesterzen für Luxusgüter aus aller Welt ausgeben würden, wobei der Weihrauch sowie die ebenfalls aus Südarabien kommende und angeblich doppelt so teure Myrrhe entscheidende Faktoren dieser Bilanz waren. Die Rolle des Duftharzes als Statussymbol wird am deutlichsten in der Tatsache, dass der römische Kaiser Nero anlässlich der Totenfeiern für seine Gemahlin Poppaea Sabina – so berichtet es wiederum Plinius (nat. XII 83) – die gesamte Jahresernte an Weihrauch, geschätzt zwischen 2500 und 3000 t, aufgekauft und verbrannt haben soll. Die Luft der Reichshauptstadt soll noch Wochen nach Abschluss der Bestattungszeremonien vom schweren Duft des Baumharzes geschwängert gewesen sein.
Möglich war der Transport von Weihrauch und den anderen Aromata über die immensen Entfernungen von den Ursprungsgebieten bis zu den mediterranen Endabnehmern erst durch die Domestikation des Dromedars geworden, die im Verlauf des 2. Jahrtausends v. Chr. auf der Arabischen Halbinsel erfolgt war. Die den dortigen Klima- und Landschaftsverhältnissen optimal angepassten Tiere konnten – anders als die Esel, mit denen zuvor die Karawanen ausgestattet waren – mit schwereren Lasten beladen werden und dabei nicht nur größere Tagesetappen, sondern auch überhaupt weitere Distanzen zurücklegen, da sie gegebenenfalls mehrere Tage lang ohne Nahrung und Wasser auskommen. An der Monopolstellung des Dromedars, das somit den ältesten Welthandelsweg der Menschheitsgeschichte bediente, änderte sich wenig, bis sich etwa um die Zeitenwende – aufgrund wachsender Kenntnisse über die Strömungs- und vor allem Windverhältnisse in den Gewässern um die Arabische Halbinsel – das Frachtschiff allmählich als preisgünstigere und schnellere Alternative zum »Wüstenschiff«, dem einhöckrigen Kamel, anbot.
Bis dahin verlief für die Handelskarawanen der Landweg über die Arabische Halbinsel auf einer Route, die in einigem Abstand parallel zu deren Westküste nach Norden führte. Dabei handelte es sich aber nie um einen »angelegten« Weg im Stil der späteren Straßen im Römischen Reich, sondern um einen variablen, der Konstitution der Karawanen angepassten Streckenverlauf. Laut Plinius sollen auf der Wegstrecke, für die zwischen 70 und 90 Tage benötigt wurde, durchschnittlich 65 Rastplätze aufgesucht worden sein. Die Zahlendifferenz erklärt sich aus der Tatsache, dass die Karawanen in den großen Oasen, die unterwegs passiert wurden, mehrere Tage blieben, um Kräfte zu sammeln und neuen Proviant zu beschaffen. Bei den übrigen Gelegenheiten für ein Nachtlager handelte es sich vielfach nur um unbefestigte Plätze in freier Natur, die, wann immer möglich, so gewählt waren, dass Felsen einen gewissen Schutz vor dem oftmals heftigen Wind und räuberischen Überfällen boten.
Abb. 2 Detail eines Kirchenmosaiks mit Darstellung einer Kamelkarawane: ht. Theater von Bosra/Syrien.
Die eigentliche Weihrauchstraße begann nach übereinstimmenden Angaben antiker Autoren in Sabota, dem heutigen Schabwa, das seinerzeit die Hauptstadt des Königreichs Hadramaut gewesen ist. Dorthin gelangte das wertvolle Handelsgut aus dem legendären Weihrauchland Sa’akalan, dem Dhofargebirge im heutigen Südoman, über mehrere lokale Zubringerwege entlang der jemenitischen Südküste und quer über Land, sodass die Harzklumpen unter Umständen bereits einen Monat unterwegs waren, bis sie nach Schabwa gelangten. Bevor die Karawanen jedoch von dort aufbrechen konnten, mussten die ersten »Prozente« an die örtlichen Priester entrichtet werden. Zunächst ging es, immer entlang des Randes der großen innerarabischen Sandwüsten, nach Nordwesten: über die Sabäerhauptstadt Marib bis ins 3000 m hohe Dschaufgebirge und weiter über das Becken von Sa’ada an der heutigen jemenitischsaudischen Grenze in die Großoase Nadschran, die heute den Kern der südlichsten Provinz Saudi-Arabiens bildet. Dabei wurden mehrere lokale Königreiche passiert, die ebenfalls Wegezölle erhoben. Die Handelsroute verlief in der Folge durch die Täler des an Wasserquellen reichen Asirgebirges, das sich parallel zur Küste des Roten Meeres von Süden nach Norden erstreckt und bei dem es sich um das alttestamentliche Goldland Ophir handeln könnte. Auf diesem Abschnitt lagen die Großoasen Makoraba, das heutige Mekka, und Yathrib, das heutige Medina, sowie Dedan, das heutige al-’Ula. Mit dem Erreichen dieser Station verließen die Karawanen den Einflussbereich der altsüdarabischen Königreiche und gelangten in das Gebiet nordarabischer Stämme wie der Lihyanier und der Thamudier. Diese Landschaft wird als Midian bezeichnet, so auch im Alten Testament, als sie noch zum Siedlungsgebiet der Edomiter gehörte. Ab hier begann in den letzten Jahrhunderten vor der Zeitenwende und dem Jahrhundert danach – bis zur Eroberung durch die Römer 106 n. Chr. – das Reich der Nabatäer, das von der rund 500 km entfernten Hauptstadt Petra aus verwaltet wurde. Offensichtlich lag Petra selbst aber nicht am Hauptstrang der Weihrauchstraße, sondern an einem Abzweig davon. Südlichster Außenposten der Nabatäer war das nur rund 20 km nördlich von Dedan gelegene Hegra, das heutige Meda’in Saleh, das mit ähnlich imposanten Grabfassaden aufwarten kann wie die damalige Residenzstadt selbst. Sowohl al-’Ula wie auch Meda’in Saleh gehören heute zur nordsaudischen Provinz Hedschas. Die Nabatäer sorgten dann – natürlich gegen entsprechende Zahlungen – dafür, dass die Karawanen sicher die Hafenstadt Gaza am Mittelmeer, den nördlichen Endpunkt der »Weihrauchstraße«, erreichten.
Abb. 3 Trasse der Hedschas-Bahn; die Gleise und Schwellen sind mittlerweile vollständig demontiert.
Selbstverständlich zogen die Karawanen nicht unbeladen zurück. Für einen Teil ihres Ertrages kauften die Händler Güter, die in ihrer Heimat als exotisch galten, vor allem Textilien und Kunsthandwerk, die sie nach ihrer Rückkehr gewinnbringend an den Mann brachten.
Mit der Expansion des Islam ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. fanden die Handelsbeziehungen mit dem Römischen Reich ein rasches Ende. Zuvor waren innerarabische Streitigkeiten zwischen Befürwortern und Widersachern Mohammeds vor allem in den wichtigen Oasen Makoraba und Yathrib, den späteren Orten Mekka und Medina, blutig ausgetragen worden und hatten den Karawanenverkehr empfindlich gestört. Mit dem Sieg des Islam erhielt die vormalige Handelsstraße jedoch eine neue Aufgabe als Pilgerroute zum zentralen Heiligtum der neuen Religion, der Ka’aba von Mekka. Selbst als Warenweg erlebte sie nochmals eine letzte Blüte: Die Früchte des im späten 15. Jahrhundert n. Chr. aus Äthiopien in den Jemen exportierten Kaffeestrauches traten auch im Europa des Barock ihren Siegeszug als exotisches Genussmittel an. Die Bohnen wurden vor allem in der jemenitischen Hafenstadt Moccha am Roten Meer verschifft, welche dem aufputschenden Getränk – das die Araber »kahweh«, »das Aufweckende« nannten – zunächst den Namen Mokka gab.
Die Expansion der Osmanen auf der Arabischen Halbinsel unterband zwar schließlich den lukrativen Kaffee-Export, doch sorgten die Herrscher am Bosporus für eine allerletzte, wenn auch nur kurz aufflackernde Renaissance der Route; zumindest auf deren nördlichem Abschnitt, als sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf der Trasse des traditionellen Pilgerweges zwischen Damaskus und Mekka unter internationaler Beteiligung den Bau der Hedschas-Bahn initiierten. Immerhin konnte 1906 die Strecke von Damaskus nach Medina in Betrieb genommen werden. Doch schon wenig später, 1917, mussten der weitere Ausbau nach Süden und der Verkehr auf der bereits existierenden Strecke eingestellt werden, da die Gleise immer wieder Sprengstoffanschlägen der um Unabhängigkeit kämpfenden arabischen Stämmen zum Opfer gefallen waren (Abb. 3). Angeleitet wurden sie dabei durch den englischen Oberst Thomas Edward Lawrence (1888–1935), besser bekannt als »Lawrence von Arabien«. So hat ironischerweise der Mann, der selbst aktiv an Ausgrabungen mitgewirkt und stets Interesse an der Vergangenheit bekundet hat, unfreiwillig dazu beigetragen, dass der Hedschas seither brach liegt und auch die Weihrauchstraße in diesem Abschnitt noch ihrer gründlichen Erforschung harrt. Und während in Jordanien, Jemen und Oman – den übrigen Anrainern der »Weihrauchstraße« – schon seit geraumer Zeit archäologische Missionen aus aller Welt Dokumentationen des umfangreichen epigrafischen Materials und Ausgrabungen durchführen können, gewährt Saudi-Arabien erst seit relativ kurzer Zeit Altertumsforschern den offiziellen Zugang zu den historischen Stätten des Landes. Denn deren Wissensdurst steht eine Koransure entgegen, wonach die Zeit vor dem Propheten Mohammed eine dunkle Epoche der Unwissenheit gewesen ist und bei der Beschäftigung mit ihr die Gefahr besteht, vom wahren Glauben abgebracht zu werden. Umso höher ist es dem strenggläubige wahhabitische Herrscherhaus der Ibn Sauds, die sich als Hüter der heiligen Stätten und des wahren Glaubens verstehen, anzurechnen, dass sich ihr Land auch diesbezüglich langsam öffnet.