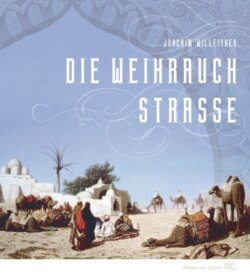Читать книгу Die Weihrauchstraße - Joachim Willeitner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Seeweg im Roten Meer
ОглавлениеIm Hellenismus, vor allem ab dem 2. Jahrhundert v. Chr., gewinnt das Rote Meer für den Transport südarabischer und indischer Luxusgüter ans Mittelmeer, insbesondere nach Alexandria, gegenüber der Landverbindung auf der Arabischen Halbinsel immer mehr an Bedeutung. Dieses annähernd in Nord-Süd-Richtung lang gestreckte Gewässer bedeckt mit einer Länge von 2240 km und einer Breite zwischen 150 und 325 km eine Gesamtfläche von rund 460 km2. Seine größte Tiefe erreicht das im Schnitt 490 m herabreichende Meer mit 2604 m am Südostende bei Dschibuti/Somalia, am Bab el-Mandeb, dem »Tor der Tränen«, wo es über den Golf von Aden mit dem Indischen Ozean in Verbindung steht. Bis zum Bau des Suezkanals, durch den 1869 eine Passage zum Mittelmeer entstand, endete es im Nordwesten blind und wurde dort durch die Sinai-Halbinsel in zwei Golfarme gespalten, den von Aqaba/Eilat im Osten und den von Suez im Westen. Mit maximalen Oberflächentemperaturen von 35° C, wobei in tieferen Schichten bis 60° C erreicht werden, gilt es als wärmstes aller Meere.
Vor allem im Hochsommer übersteigen die Lufttemperaturen rasch die 40° C-Marke, und die daraus resultierende starke Wasserverdunstung bewirkt nicht nur eine hohe relative Luftfeuchtigkeit, sondern hat auch dazu geführt, dass der Salzgehalt des Wassers mit 3,6 bis 4,2 Prozent deutlich höher liegt als in den übrigen Weltmeeren. Denn das Meerwasser wird praktisch durch keinen Süßwasserzufluss »aufgedünnt« und auch die Durchmischung mit dem Indischen Ozean hält sich offensichtlich in Grenzen. Durch die geringe Ausdehnung des Gewässers in ost-westliche Richtung sind die Gezeitenschwankungen mit lediglich rund einem Meter nur schwach ausgeprägt.
Bislang ungeklärt ist, wie es zur Benennung als »Rotes« Meer gekommen ist, die erstmals in der spätrömischen Bezeichnung »Mare rubrum« auftritt und sich auch im heutigen arabischen Namen Bahr al-Ahmar (ahmar = rot) findet. Denn eigentlich zeichnet sich das Gewässer durch eine tiefblaue Färbung aus, die nur in fachen Uferabschnitten ins Grünblaue umschlägt. Diskutiert wird ein Zusammenhang mit der abschnittsweise rötlichen Färbung des Gesteins der Uferfelsen, mit der Einfärbung des Wassers durch die Algenart Trichodesmium erythraeum oder mit der antiken Benennung Nordostafrikas als »Land der Roten«. Letzteres hat sich noch heute im Namen des seit 1993 unabhängigen Staates Eritrea, der bis dahin die Küstenprovinz Äthiopiens dargestellt hatte, erhalten, denn er leitet sich ab vom antiken Erythraea, dem »Roten Land«.
Die Wassermassen des Roten Meeres füllen den Hauptarm des insgesamt 6000 km langen Ostafrikanischen Grabenbruchsystems (»Great Rift Valley«) auf, der hier die Grenze zwischen Asien und Afrika bildet. Dieser reicht nach Süden bis in den afrikanischen Njassagraben und setzt sich nach Norden über den Golf von Eilat/Aqaba, das Wadi Araba, das Tote Meer, das Jordantal und den See Genezareth fort. Durch diese tektonische Situation bedingt wird das Rote Meer weitgehend von steil abfallenden, bis zu 2000 m hohen Gebirgskämmen gesäumt, die kaum einmal zurückweichen und damit die Anlage eines Hafens ermöglichen würden. Die meisten der wenigen Küstenorte entstanden an solchen Plätzen, in denen Wadis aus den flankierenden Bergen austreten, da das nach Regenfällen ausgeschwemmte Geröll dort die Bildung von Korallenriffen verhindert; denn diese sind an den übrigen Stellen dem Meeresufer nahezu durchgehend vorgelagert und erschweren seit jeher die Schifffahrt.
Zur Zeit der altägyptischen Pharaonen spielte die Schifffahrt auf dem Roten Meer nur eine untergeordnete Rolle, denn man konzentrierte sich bei den Handelskontakten seit der Zeit des Alten Reiches fast ausschließlich auf das Mittelmeer, in das der Nil in damals sieben Armen einmündete und auf dem man durch Fahrt entlang der Küste vor allem die Zedern des heutigen Libanon erreichen konnte, deren gerade wachsende und lange Stämme im an Bauholz armen Niltal dringend benötigt wurden. Lediglich zwei Ziele waren über das Rote Meer zu erreichen, nämlich im Norden der Sinai mit seinen Türkis- und Kupfervorkommen – doch auch dieser wurde anfänglich bevorzugt auf dem Landweg über das Wadi Tumilat, das von der Deltaspitze nach Osten in Richtung der heutigen Stadt Ismailiya am Suezkanal verläuft, aufgesucht – und im Süden das immer noch nicht eindeutig lokalisierte legendäre Gold- und Weihrauchland Punt. Entsprechend gering ist die Zahl der – bislang entdeckten – pharaonenzeitlichen Häfen am Roten Meer. Bis vor Kurzem kannte man nur zwei, nämlich Duau (Dw3w), heute Qusseir al-Qadim, und 60 km weiter im Norden Sawu (Z3ww), heute Marsa Gawasis. Der Erstgenannte befindet sich am östlichen Ende des Wadi Hammamat – der Verbindung zwischen Quft im Niltal und Qosseir an der Küste – und dürfte den korrespondierenden Hafen zum Anlegeplatz beim heutigen al-Marcha, 8 km südlich von Abu Zenima, an der Westküste des Sinai dargestellt haben. Der zweite Hafenplatz, von dem aus die Punt-Expeditionen gestartet wurden, belegte weiter im Norden den Ausgang des Wadi Gawasis, rund 20 km südlich des heutigen touristischen Badeortes Safaga.
In den letzten Jahren sind noch zwei weitere ältere pharaonenzeitliche Hafenplätze entdeckt worden, die wesentlich weiter im Norden liegen und nach bisheriger Quellenlage ausschließlich der Einfuhr von Kupfer und Türkis aus dem gegenüberliegenden Sinai dienten, nämlich bei Ain Suchna und weiter im Süden am Ausgang des Wadi al-Dscharf. Am erstgenannten Ort rund 55 km südlich von Suez, der seinen Namen »heiße Quelle« einem küstennahen Warmwasservorkommen am Fuß des Dschebel al-Galaya al-Bahariya verdankt, gräbt seit 2001 ein französisches Team unter Leitung von Georges Castel. Eine unmittelbar an der heutigen Küstenstraße am südlichen Ende des expandierenden Badeortes Ain Suchna aufragender glatter Felsen, der mit Expeditionsinschriften überwiegend aus dem Mittleren Reich, beginnend mit einem Expeditionsbericht Mentuhoteps IV. aus der 11. Dynastie, übersät ist, hatte erstmals den ägyptischen Archäologen Mahmud Abd er-Raziq 1999 auf den Ort aufmerksam gemacht. Der dort mittlerweile lokalisierte Hafen war nach Ausweis der Grabungsfunde über ein Jahrtausend, vom Alten bis ins Neue Reich, in Betrieb. Mittlerweise gibt es in den zehn freigelegten, von den pharaonenzeitlichen Hafenarbeitern und Expeditionsteilnehmern bereits in der 5. Dynastie sorgfältig zu Galerien ausgeweiteten Höhlen des hier ansteigenden Küstengebirges zahlreiche Funde, am spektakulärsten die eingelagerten Planken und Taue von zwei in ihre Einzelteile zerlegten Schiffen des Mittleren Reiches von einst jeweils zwischen 14 und 15 m Länge. Es existierte zudem in der vorgelagerten schmalen Ebene eine Werft, in welcher die Zedernholzschiffe zwischen den Expeditionen überholt wurden. Besonders aufschlussreich ist, dass vor Ort auch Kupferverhüttungsanlagen existierten. Das bedeutet, dass man aus dem Sinai Malachit und Kupfererz bezogen hat, das erst an der gegenüberliegenden afrikanischen Küste des Roten Meeres ausgeschmolzen wurde. Bislang war man davon ausgegangen, dass die Erzverhüttung bereits bei den Minen im Südsinai, vornehmlich dem Wadi Maghagha, stattgefunden hatte.
Auf etwa gleicher geografischer Höhe wie die Kupfervorkommen des Sinai und damit weit südlicher als Ain Suchna, nämlich in 180 km Entfernung von Suez, liegt der Zweite der neu entdeckten Hafenplätze, der zudem die älteren Funde erbracht hat. Die Stätte, deren antiker Name ebenfalls noch nicht ermittelt werden konnte, liegt am Ausgang des Wadi al-Dscharf, das 24 km südlich des heutigen Badeortes Zafarana den Dschebel Galala passiert. Südlich benachbart verläuft das Wadi Deir, das zum berühmten Pauluskloster führt. Nach ersten Untersuchungen in den 1950er-Jahren, die politisch bedingt rasch abgebrochen werden mussten, finden dort seit Juni 2011 Ausgrabungen unter Leitung von Pierre Tallet statt. Auch hier wurde ein Hafenbecken mit einer heute weitgehend überfluteten Mole lokalisiert und dokumentiert. Auf dem Meeresgrund liegen noch einige der alten Steinanker in situ; und wie in den anderen Hafenanlagen des Roten Meeres sind auch hier in die Felsen des ansteigenden Küstengebirges zahlreiche teils große Felsgalerien aus dem Sandstein herausgemeißelt worden, deren Eingänge mit großen Steinplatten verschlossen werden konnten. Da das Fundmaterial die Nutzung bereits während der frühen 4. Dynastie (um 2600 v. Chr.) im Alten Reich belegt, kann der Hafen am Wadi al-Dscharf für sich in Anspruch nehmen, weltweit der älteste seiner Art zu sein. Seit 2013 ist der Ort um einen weiteren Rekord reicher. Es traten hier auch die bislang ältesten je auf ägyptischem Boden gefundenen Papyri zutage: insgesamt 40 Schriftstücke mit Expeditionsberichten und Verwaltungsakten aus dem 27. Regierungsjahr von Pharao Cheops, dem Erbauer der größten Pyramide in Giza. Wahrscheinlich wurden die aus dem Sinai bezogenen Güter anschließend durch das nördlich des Wadi al-Dscharf verlaufende breite Wadi Araba, das bis zum Niltal führt, dorthin transportiert. Noch unklar ist, warum die Stätte bereit nach Cheops während des Alten Reiches offensichtlich vom weiter nördlich gelegenen Ain Suchna als Hafenplatz abgelöst wurde, obwohl von dort der Seeweg zu dem Kupfervorkommen des Südsinai weiter war, denn das Wadi al-Dscharf liegt genau gegenüber von al-Marcha auf dem Sinai, wo am Tell Ras Budran eine korrespondierende Schiffsanlegestelle, ebenfalls aus dem Alten Reich, ermittelt werden konnte. Da sich der Hafen am Wadi al-Dscharf als deutlich größer als diejenigen von Ain Suchna und Wadi Gawasis herausgestellt hat, vermuten die Ausgräber, dass hier auch die Punt-Expeditionen des Alten Reiches, die spätestens ab Pharao Sahure in der 5. Dynastie durchgeführt worden sind, ihren Ausgang genommen haben, auch wenn ein Beweis dafür noch fehlt.
Erst im Verlauf der ägyptischen Spätzeit, im fortgeschrittenen 1. Jahrtausend v. Chr., entwickelte sich das Rote Meer zu einem mehr und mehr befahrenen Gewässer. Die intensive Nutzung dieses Seeweges setzte ohnehin eine Verbesserung der Segeltechnik für dieses anspruchsvolle Gewässer mit seinen zahlreichen Korallenriffen und unberechenbaren Strömungen voraus. Zudem musste dort auch die Gefahr der Piraterie gebannt werden.
Den »Startschuss« für die regelmäßige Schifffahrt auf dem Roten Meer gab der Perserkönig Dareios I. (521–486 v. Chr.) mit der Fertigstellung eines Kanals, der über das Wadi Tumilat unweit der Deltaspitze des Nils, den Timsahsee und die beiden Bitterseen eine Verbindung zwischen dem Niltal und dem Roten Meer herstellte. Auf diesem Wasserweg war – nach der Umrundung der Arabischen Halbinsel – vor allem eine Anbindung an das iranische Heimatland der Achämenidendynastie gegeben, die damals zwischen 525 und 404 v. Chr. als 27. Dynastie über das Niltal herrschte. Der zwischenzeitlich offensichtlich wieder verfallene Kanal wurde später von Ptolemaios II. Philadelphos repariert und 280/79 v. Chr. wiedereröffnet.
Dies alles erklärt, warum die meisten der wenigen Häfen an den Gestaden beidseitig des Roten Meeres erst in ptolemäischer oder römischer Zeit eingerichtet worden sind. Dabei ist immer zu beachten, dass alle diese Küstenstädte nicht ohne enge Anbindung an Ortschaften im Niltal überlebensfähig waren, von wo sie ihre Nahrungsmittel bezogen. Denn abgesehen vom Fischfang gab es keine Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, da keine Landwirtschaft möglich war und nicht einmal ein nennenswerter Baumbestand existierte. Das Wasser musste in der Regel aus mehreren Kilometern Entfernung von Brunnen, die sich im Landesinneren in den zuführenden Wadis befanden, auf Packtieren herbeigebracht werden.
Trotz der geringen Zahl der Anlegeplätze am Roten Meer ist teilweise die Gleichsetzung der antik überlieferten Namen mit heutigen Orten noch strittig. Auf der arabischen Seite spielte das immer noch nicht eindeutig lokalisierte Leuke Kome an der Grenze des Nabatäerreiches die wichtigste Rolle als Warenumschlagplatz, an der ägyptischen Ostküste kennt man von Norden nach Süden bislang die Hafenplätze Clysma (heute Suez), Myos Hormos (zumeist mit Abu Scha’ar nördlich von Hurghada gleichgesetzt), Philoteras (heute Marsa Gawasis am Ende des Wadi Gawasis), Leukos Limen (zumeist mit Qusseir al-Qadim am Ausgang des Wadi Hammamat gleichgesetzt), Nechesia (heute Umm Rus/Marsa Mubarak) und ganz im Süden Berenike. Es wurde jedoch auch aus den Funden von Ostraka geschlossen, dass Myos Hormos beim heutigen Qusseir zu lokalisieren ist und die Bezeichnung des Hafens als Leukos Limen, die lediglich bei Ptolemaios (IV 5,8) belegt ist, auf einer Verwechslung mit Leuke Kome am gegenüberliegenden arabischen Ufer beruhen könnte.
Myos Hormos war jedenfalls eine Gründung Ptolemaios’ II. und fungierte als Umschlaghafen für die aus Indien über die Südküste Arabiens kommenden Schiffe. Für die Zeit des Augustus gibt Strabo (II 5,12) ihre Anzahl mit jährlich 120 an. Er (XVII 1,45) und Plinius (nat. VI 102f.) berichten übereinstimmend, dass die Waren dann auf dem Rücken von Kamelen weiter nach Koptos (heute Quft) am Nil und von dort aus wieder auf dem Wasser in die Hauptstadt Alexandria transportiert wurden.
Während der römischen Kaiserzeit büßte Myos Hormos offensichtlich zugunsten des weiter im Süden auf der Breite von Assuan gelegenen Berenike an Bedeutung ein. Letztgenannte Hafenstadt an der Foul-Bay, im Norden durch die Halbinsel von Ras Banas geschützt, war ebenfalls eine Gründung Ptolemaios’ II., die um 275 v. Chr. erfolgt sein dürfte. Der König benannte die neue Stadt nach seiner Mutter. Hier nahm eine andere Route nach Koptos ihren Anfang, wobei auf der etwa 385 km langen Strecke zwischen diesen beiden Städten eine Karawane – nach dem übereinstimmenden Zeugnis von Strabo (XVII 1,45) und Plinius (nat. VI 102f.) – zwölf Tage durch die ägyptische Ostwüste unterwegs war. Diese Route war mit Hydreumata, ummauerten Schutzbauten, in denen man rasten und sich mit Wasser versorgen konnte, gesichert. Von Berenike führten aber auch andere Wüstenwege an den Nil, so nach Apollinopolis Magna, dem heutigen Edfu. Berenike war so weit im Süden angelegt worden, dass die Schiffe das Segeln gegen die Winde im nördlichen Abschnitt des Roten Meeres, die etwa ab dem 19. Grad bevorzugt aus dem Norden kommen, vermeiden konnten. Hingegen herrscht in der südlichen Hälfte des Gewässers vorwiegend ein Wind aus dem Süden vor. Dieser erleichterte den antiken Handelsschiffen zwar die Einfahrt durch das Bab el-Mandeb, wirkte sich aber beim Verlassen des Roten Meeres als Hemmnis aus. Unter Ausnutzung des Monsunwindes, der von April bis November aus Südwesten bläst, dürften die Schiffe im Altertum Berenike zur Sommermitte verlassen haben. Nach etwa einem Monat erreichten sie Aden im südlichen Jemen, nach weiteren anderthalb Monaten ihr Endziel in Indien. Im Dezember oder Anfang Januar erfolgte die Rückreise, unterstützt im Indischen Ozean vom Wintermonsun, der von November bis März aus Nordosten bläst, und dann im Roten Meer durch den ganzjährigen Wind aus Süden oder Südwesten. Ausgrabungen ergaben, dass Berenike im Anschluss an die Ptolemäerzeit eine weitere Blüte unter den Römern in den beiden Jahrhunderten um die Zeitenwende erlebte; nach einem zeitweiligen Niedergang erfolgte eine Wiederbelebung im 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. Auch hier lag der Hafen am Ausgang eines aus den flankierenden Bergen kommenden Wadis. Dieses schwemmte Sedimente in den Hafen, was zum Untergang der Stadt geführt haben dürfte. Dass sich auch altsüdarabische Händler dort aufgehalten haben, zeigten vor wenigen Jahren im Hinterland von Berenike aufgefundene entsprechende Felsgraffiti, darunter das einem Baum ähnelnde Symbol der himyaritischen Dynastie, der Name »hfn« (Huffan) und eine schwer zu deutende zweizeilige Inschrift aus sieben Zeichen.
Schon seit Längerem hingegen kennt man altsüdarabische und nabatäische Inschriften an markanten Felsformationen auf der etwa 175 km langen Strecke zwischen Quft (dem antiken Koptos) und Qusseir (dem antiken Leukos Limen), die in griechisch-römischer Zeit, als man Dromedare als Lasttiere hatte, in fünf Tagen zurückgelegt werden konnte. Dabei steigt der Weg, der durch das Wadi Hammamat führt, über die Wasserscheide der ägyptischen Ostwüste bis über 800 m ü. d. M. an. Entlang der Route befanden sich mindestens acht Hydreumata und 65 Wachtürme in Sichtweite zueinander, über die rasch Signale weitergeleitet werden konnten.
Der wahrscheinlich am Ort des pharaonenzeitlichen Sawu und heutigen Marsa Gawasis nördlich von Qusseir zu lokalisierende ptolemäisch-römische Hafen von Philotheras wurde übrigens nach Philotera, einer Tochter Ptolemaios’ I. und seiner Gemahlin Berenike I., benannt. Die Prinzessin, die nach ihrem Tod nach 276 v. Chr. – ebenso wie ihre populärere Schwester Arsinoe II. – vergöttlicht und in einer speziellen Kultstätte, dem »Arsinoeion«, verehrt worden ist, stand zudem Pate für gleichnamige Städte am See Genezareth im heutigen Israel und in Lykien.
Eine Sonderrolle unter den Häfen am Roten Meer nahm das 80 km südlich von Qusseir und 65 km nördlich von Marsa Alam – wo das von Edfu kommende Wadi Miah das Rote Meer erreicht – gelegene römische Nechesia ein, denn es fungierte weniger als Umschlagplatz für den Fernhandel, sondern verdankte seine Existenz den nahe gelegenen Goldvorkommen von Umm Rus. Am Ausgang des Wadi Mubarak erinnern nach 7 km zahlreiche Arbeiterhütten an die hier einst erfolgte Gewinnung des Edelmetalls.