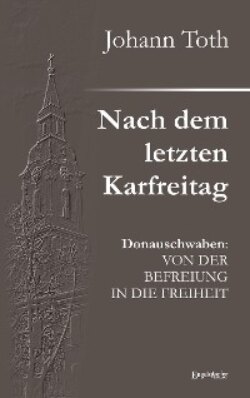Читать книгу Nach dem letzten Karfreitag - Johann Toth - Страница 10
ОглавлениеKapitel 5
KINDHEIT, JUGEND UND ERSTER UMSTURZ
Ich kam am 28. Februar 1929 in Kernei als Zweitgeborener des Michael Toth und der Magdalena Toth, geborene Gärtner, auf die Welt. Damals bestand eine hohe Säuglingssterblichkeit; Säuglinge, die bei der Geburt oder danach verstarben, wurden in einer Nottaufe – die Buben auf Adam und die Mädchen auf Eva – getauft. Mein älterer Bruder – der Erstgeborene – hieß deshalb Adam; er verstarb im Säuglingsalter.
Noch bevor ich 5 Jahre alt wurde, verstarb meine Mutter am 21. Februar 1934 an Blinddarmdurchbruch. Eine Todesursache, die heute undenkbar wäre; sie zeigt die schlechte medizinische Versorgung der damaligen Zeit auf. Mein Vater stand damals mit 3 Kindern – mit meinen beiden jüngeren Schwestern Regina und Magdalena und mir – ohne Mutter da; er heiratete abermals. Seine 2. Frau ist 1936 im Kindbett gestorben. Daraufhin heiratete er eine Witwe mit 2 Kindern, mit der er in der Folge noch zwei gemeinsame Kinder hatte. So lebte ich mit dem Vater, der Stiefmutter, meinen Schwestern Regina und Magdalena, meiner Halbschwester Theresia, den Halbbrüdern Josef und Martin (letzterer war später im Lager verhungert) und den Stiefbrüdern Sebastian und Anton. Wir wohnten als Großfamilie; auch die Großeltern und die Urgroßmutter lebten im Haus.
Wir wohnten in der „Zwercharoih“ (Zwischenreihe) 44. Offiziell hieß diese Straße im Königreich Jugoslawien „General Petra Zivkoviza Ulica“; nach dem ersten Umsturz im Frühjahr 1941 sollte die Straße bis zur Vertreibung „Hermann Göring Gasse“ heißen.
Trotz der vielen Todesfälle hatte ich eine schöne und – vielleicht aus heutiger Sicht etwas verklärt – idyllische Kindheit. Wenn es schön war, spielten wir draußen. Die Spielzeuge hatten wir alle selbst gebastelt. So spielten wir „Pilickas“: Wir hatten ca. 20 cm lange Holzstücke, die links und rechts zugespitzt wurden, angefertigt. Jeder Spieler versuchte, diese mit einem Stock in der Luft weiterzubringen; pro Treffer (Berührung) gab es 5 Punkte.
Dann spielten wir „Verstecklas“, also – auf Hochdeutsch – „Verstecken spielen“; dieses Kinderspiel ist wohl seit Jahrhunderten unverändert.
Zum Zeitvertreib spielten wir auch „Klick‘rers“: Runde Kugeln mussten dabei in ein Erdloch gerollt werden. Auch dieses Kinderspiel gibt es wohl überall auf der Welt.
In Erinnerung geblieben sind mir zwei Auszählreime aus der Kindheit:
„Oons, zwa, drei,
hicka, hacka, hei,
hicka, hacka, Pfefferkern
Peter hot sein Weib verloren,
da Seppi hat’s g’funna
die Mäus traga Trummla,
uff‘ dem Dach sitzt a Spatz,
der sich bald zu bucklig lacht.“
„A, B, C, D, E,
die Katz‘ läuft im Schnee,
der Hund hinna nach,
die Katz‘ lasst a Fartz,
der Hund springt fart.“
Bei Schlechtwetter und im Winter spielten wir Karten – vom Kleinkind bis zur Uroma.
Gefahren kannten wir in dieser durch die Großfamilie behüteten durchaus idyllischen Kindheit nicht; dies sollte sich durch die Kriegswirren noch radikal ändern.
Mit 5 Jahren besuchte ich die „Ovoda“ (den Kindergarten). Er war deutschsprachig; wir hatten aber Pflichtstunden in Serbo-Kroatisch.
Ich war besonders stolz, ein „Messdiener“ (Ministrant) zu sein – und ich war ein eifriger Messdiener: Beim Glockenläuten, das wir noch händisch mit Stricken und Seilen durchführen mussten, bei Begräbnissen, Hochzeiten und bei allen Messen im Jahreskreis. Gerne erinnere ich mich, dass ich als Ministrant auf einer Primiz des Peter Halter war; dieser ist nach der Vertreibung in Kanada (Windsor) verstorben, wo ich ihn noch vor einigen Jahren besuchen konnte.
Die Volksschule („Narodna Scola“) war damals 6jährig; die beste Note war eine Fünf, die schlechteste eine Eins. Wir hatten gemischte Klassen („Buwe und Madle“); in einer Klasse waren zwischen 60 und 65 Schüler und Schülerinnen. Der Unterricht erfolgte in unserer Muttersprache Deutsch; pro Woche hatten wir 2 x 2 Stunden Unterricht in Serbo-Kroatisch.
In der ersten Klasse hatte ich Amalia Lovrec (eine Serbin) als Lehrerin; wir nannten sie „Malschi“. Ihre Unterrichtsmethode war hart aber effektiv; diese wäre nach heutigen pädagogischen Grundsätzen nicht mehr erlaubt. So konnte ich zunächst nur die Buchstaben aneinanderreihen, nicht aber die Buchstaben zu Worte verbinden und fließend lesen. „Malschi“ stellte sich neben mich: Ich „las“: „SSS …ooo … nnn … eee“ oder „KKK … eee … iii … rrr … nnn … eee … iii“. „Malschi“ gab mir eine „Watsch“ (Ohrfeige). Darauf stotterte ich und wiederholte – wenn auch schon etwas flüssiger –, worauf ich wiederum eine „Watsch“ bekam. Nach einigen Tagen, als ich wieder vorlesen musste, stand die Lehrerin „Malschi“ wieder bedrohlich neben mir: Als ich zu „lesen“ beginnen versuchte, erhob „Malschi“ ihre Hand zur Züchtigung. Plötzlich konnte ich die Buchstaben zu Wörtern zusammensetzen und fließend „Sonne“ oder „Kernei“ lesen. So hatte ich lesen gelernt. Diese harte Erziehungsmethode hat mich noch lange geprägt. Auch wenn wir Gott sei Dank heute alle – auch bezüglich der Erziehungsmethoden – gescheiter geworden sind, muss ich ehrlich sagen, dass mir – so glaube ich – die Lehrerin „Malschi“ nicht geschadet hat.
In der 2. und 4. Klasse hieß der Lehrer meiner Erinnerung nach „Faimer“. Zumindest in den ersten Klassen hatte ich nur Fünfer und Vierer; ein Fünfer war die beste Note und ein Vierer die zweitbeste.
In der 3. Klasse hatten wir einen Vetter (Cousin) meiner Mutter, nämlich Gabriel Gärtner, als Klassenlehrer; ihn mochte ich nicht besonders.
In der Volksschule wurden wir in unserer Muttersprache Deutsch unterrichtet; wir hatten aber 2 x 2 Stunden pro Woche, in der wir Serbo-Kroatisch gelernt haben. Auch mussten wir die Schriftarten Korinth, Latein und Zyrillisch lernen.
Ab 1941 habe ich eine ungarische Schule besucht: Ich war der einzige „Schwob“. Zu Schulbeginn konnte ich kein Wort Ungarisch; nach einem halben Jahr war ich nahezu perfekt in der ungarischen Sprache – in Wort und Schrift.
Die Entscheidung meiner Eltern, mich in die ungarische Schule zu schicken, hängt wohl auch mit dem ersten Umsturz zusammen, der in der Karwoche 1941 begann:
Am Palmsonntag 1941 sahen wir ganze Geschwader von Flugzeugen, wie ich sie bis zu diesem Tag noch nicht gesehen hatte. Die deutsche Wehrmacht bombardierte hauptsächlich die Großstädte und vor allem das weiter südlich gelegene Belgrad. Die Bombenangriffe dauerten die ganze Karwoche.
Gott sei Dank hatten wir einen großen Keller im Haus, in den wir bei den Bombenangriffen flüchten konnten. Zu diesem Zeitpunkt war unsere Walter-Urgroßmutter schon jahrelang bettlägerig: Sie hatte ein Bein verloren und wartete auf das Sterben. Gut in Erinnerung hatte ich noch ihr Jammern, dass sie nicht und nicht sterben konnte. Als sie von meinem Vater bei den Bombenangriffen in den Keller getragen wurde, meinte sie zunächst: „…, dass ich das noch verleben muss!“ und obwohl sie sich all die Jahre – nach ihren eigenen Worten – nichts seliger wünschte, als dass sie endlich sterben konnte, fragte sie meinen Vater: „Monscht, is‘ schon so weit?“
Abgesehen davon, dass in der Karwoche die Geschwader von Flugzeugen Richtung Belgrad flogen, war es sonst im Dorf gespenstisch ruhig; alles war wie gelähmt.
Zu Karfreitag waren neben dem Pfarrer zwei Messdiener in der Kirche: Der spätere Pater Schröder (Stift Göttweig in Österreich) und ich; nur fünf alte Frauen saßen in der ansonsten zu Ostern übervollen Kirche. Auch am Karsamstag waren neben dem Pfarrer die beiden gleichen Ministranten in der Kirche; mit Ausnahme einer alten Frau war aber die Kirche leer. Es war still in der Kirche; wir konnten aber die Geschwader der Bomber hören.
Als ich am Vormittag des Karsamstag 1941 von der Kirche nach Hause ging, sah ich Kolonen von Soldaten, die offenbar im Rückzug (vor den nahenden ungarischen und deutschen Einheiten) waren. Schröder und ich gingen unbekümmert nach Hause. In der Kirchengasse beim Haus meines „Franke-Großvaters“ (so wurde unser Gärtner-Großvater genannt) sah ich, dass das Tor einen Spalt geöffnet war und der Großvater uns zurief: „Buwe, geht’s hom, weil die verschieße euch!“ Wir gingen nach Hause; passiert ist uns nichts.
Um 13 : 00 Uhr am Karsamstag 1941 marschierten die Besatzer ein: Nach den Mitteilungen meines Vaters wurden deutsche Soldaten erwartet; gekommen ist das ungarische Militär. Um 17 : 00 Uhr vor dem Gemeindeamt war die „Siegesfeier“ anberaumt. Eine Musikkapelle spielte eine Hymne (oder mehrere Hymnen). Ich kann mich nicht erinnern, ob auch die deutsche Hymne („Deutschland, Deutschland über alles … “) gespielt und gesungen wurde; erinnern kann ich mich aber an die ungarische Hymne: „Isten alld meg a magyart“; dies heißt so viel wie: „Gott segne den Ungarn mit frohem Mut und Überfluss“. Ganz bestimmt weiß ich, dass nicht „Heil“ gerufen wurde, sondern „Eljen“, was auf Ungarisch wohl ähnliches bedeutet. Nach der Hymne (oder den Hymnen) war der ganze Spuk vorbei und ich ging nach Hause.
Nunmehr besuchte ich – als einer der wenigen Schwob’n – die ungarische Schule. Das war ein hartes Schuljahr, da ich zu Beginn kaum ungarisch konnte. Das Schuljahr schaffte ich mit Auszeichnung; ich war am Ende in der ungarischen Sprache in Wort und Schrift nahezu perfekt. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass die Mehrsprachigkeit – und die Perfektion in der ungarischen Sprache – ein großer Vorteil sein würde.
Nach diesem politischen Umsturz ging das Leben in der Gemeinde zunächst im gleichen Trott weiter; nur die Parolen waren andere. Unsere Orientierung war weiterhin die Kirche. Mich störte aber, dass nunmehr in jeder Messe die ungarische Nationalhymne gespielt wurde.
Mein Vater wurde auch zur ungarischen Armee eingezogen, desertierte später und kam wieder nach Hause bis er dann ins Arbeitslager nach Russland deportiert wurde.