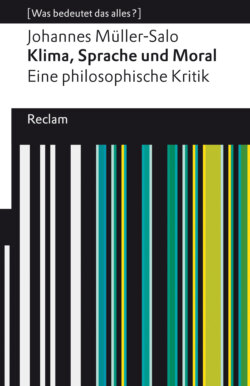Читать книгу Klima, Sprache und Moral. Eine philosophische Kritik - Johannes Müller-Salo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Begriffliche Vielfalt: Papst Franziskus und Greta Thunberg
ОглавлениеWie unterschiedlich die Begriffe und ihre normativen wie evaluativen Grundlagen sind, in welche die mit dem Klimawandel einhergehenden moralischen Herausforderungen gefasst werden können, kann ein erster Vergleich aufzeigen. Wenige Texte haben die öffentlichen und politischen Klimadebatten in den letzten Jahren so stark beeinflusst wie die von Papst Franziskus (* 1936) im Mai 2015 gegebene Umweltenzyklika Laudato si’ und die Reden der schwedischen Schülerin und Initiatorin der Fridays-for-Future-Proteste, Greta Thunberg (* 2003), aus den Jahren 2018 und 2019.
Der normative Leitbegriff in Thunbergs Reden ist der Begriff der Zukunft. Durch ihr rücksichtsloses Verhalten stehlen die Bewohner der reichen Länder zukünftigen Generationen natürliche Ressourcen.2 Ihr Appell an die Gegenwart: »Die Zukunft aller Generationen ruht auf euren Schultern. […] Also bitte behandelt die Klimakrise als die akute Krise, die sie ist, und gebt uns eine Zukunft. Unser Leben liegt in euren Händen.«3 Thunberg adressiert Fragen internationaler Gerechtigkeit, insofern sie auf die Verantwortung der reichen Nationen verweist, ihren Anteil an CO2-Emissionen zu senken, um den Entwicklungsländern eine Chance zu geben, »ihren Lebensstandard zu erhöhen, indem sie einen Teil der Infrastruktur aufbauen, die wir schon haben«4.
Papst Franziskus stellt seine Überlegungen unter den Leitbegriff der »Sorge für das gemeinsame Haus«, wie es bereits im Untertitel der Enzyklika heißt. Damit ist das zentrale Thema von Laudato si’ bereits benannt: Aus der Sicht von Franziskus stellt der Klimawandel einen zentralen, jedoch nur einen weiteren Aspekt globaler Ungerechtigkeit und der Missachtung von Menschen durch Menschen dar. Die Mahnung, globale Umwelt- und globale Armutsprobleme zusammenzudenken, sie als zwei Seiten derselben Herausforderung zu betrachten, durchzieht die Enzyklika: Der Planet Erde befinde sich »unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen«, das »Stöhnen der Schwester Erde« müsse gehört werden, »die sich dem Stöhnen der Verlassenen der Welt anschließt«.5 Die Menschen müssten sich bewusst werden, dass »eine einzige Menschheitsfamilie« existiere und sich daher jede »Globalisierung der Gleichgültigkeit« verbiete.6
Natürlich erkennt auch der Papst an, dass der Klimawandel zukünftige Generationen massiv zu schädigen droht:
Wir könnten den nächsten Generationen zu viel Schutt, Wüsten und Schmutz hinterlassen. Der Rhythmus des Konsums, der Verschwendung und der Veränderung der Umwelt hat die Kapazität des Planeten derart überschritten, dass der gegenwärtige Lebensstil, da er unhaltbar ist, nur in Katastrophen enden kann.7
Dennoch lässt er keine Zweifel am Recht ärmerer Staaten, die Bekämpfung gegenwärtiger Armut vorzuziehen: »Die armen Länder müssen notwendig der Ausrottung des Elends und der sozialen Entwicklung ihrer Bewohner den Vorrang einräumen.«8 Wer sich der schwierigen Frage stellt, welchen Beitrag Entwicklungs- und Schwellenländer zur globalen Reduktion der Emission von Treibhausgasen leisten müssen, wird ausgehend von Thunberg sicher zu anderen Ergebnissen kommen als im Anschluss an die päpstliche Position.
Auch sonst sind die Unterschiede unübersehbar. So ist Thunbergs Blick durchweg in die Zukunft gerichtet – auch mit Blick auf den globalen Konflikt zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden: Die Staaten des Nordens müssten ehrgeizige Klimaschutzziele erreichen, um den Staaten des Südens die für zukünftige wirtschaftliche und soziale Entwicklung benötigten Spielräume zu ermöglichen.9 Papst Franziskus hingegen blickt nicht nur nach vorn, sondern auch zurück, wenn er an vergangene Ungerechtigkeiten, an die »ökologische Schuld« des Nordens gegenüber dem Süden erinnert10 und davor warnt, dass die »Internationalisierung der Umweltkosten« mit der Gefahr verbunden sei,
dass den Ländern, die über weniger Mittel verfügen, schwerwiegende Verpflichtungen zur Reduzierung der Emissionen aufgebürdet werden, die denen der am stärksten industrialisierten Länder vergleichbar sind. […] Auf diese Weise kommt im Gewand des Umweltschutzes eine neue Ungerechtigkeit hinzu. Wie immer trifft es die Schwächsten.11
Ebenso lohnt ein kurzer Blick auf das Problem der Motivation. Thunberg stellt die Gefahr der zukünftigen Klimakatastrophe in den Mittelpunkt. Sie spricht vom bevorstehenden »albtraumhafte[n] Szenario«, das ihren »Hilferuf« begründet – und verlangt: »Ich will, dass ihr in Panik geratet«.12 Es ist also vor allem die Einsicht in das drohende Unheil und das Wissen um ein immer enger werdendes Zeitfenster, in dem erfolgreiches Gegensteuern noch möglich ist, welches Menschen zum Handeln veranlassen soll.
In Laudato si’ hingegen erinnert der Papst an das facettenreiche Reservoir an Handlungsmotivationen, die in einer hochentwickelten amtskirchlichen Theologie und globalen religiösen Praxis zur Verfügung stehen – von schöpfungstheologischen Überlegungen über christliche Pflichten der Sorge um die Armen und die Welt bis hin zu mystischen Ideen der Präsenz Gottes in jedem Stück Natur.13 Während Thunberg den untätig bleibenden Eliten der Welt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos entgegenhält: »Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid«14, verlangt der Papst betont optimistisch, Freude und Hoffnung angesichts »unserer Kämpfe und unserer Sorgen um diesen Planeten« nicht zu verlieren: »Gehen wir singend voran!«15
Es geht nun sicher nicht darum, der einen oder der anderen Seite recht zu geben – und noch weniger darum, die Reden einer Schülerin mit demselben Maßstab zu messen wie ein komplexes, unter Mitwirkung zahlreicher Gremien und Amtsträger entstandenes kirchliches Lehrschreiben. Thunbergs Reden und Franziskus’ Enzyklika illustrieren vielmehr eindrücklich, wie offen derselbe klimawissenschaftliche Befund – der nicht nur von Thunberg, sondern auch im päpstlichen Text unmissverständlich akzeptiert wird – für verschiedene normative Deutungen ist. Eben aus diesem Grund müssen wir uns fragen, wie, unter Bezugnahme auf welche Normen und Wertungen, unter Verwendung welcher Begriffe und unter Rückgriff auf welche Motivationsressourcen, sich eine Gesellschaft die Erkenntnisse der Wissenschaft im klimapolitischen Diskurs aneignet.