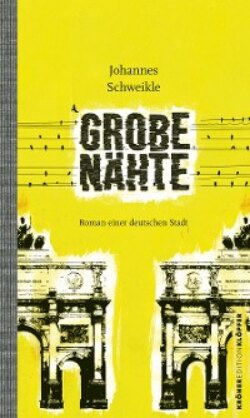Читать книгу Grobe Nähte - Johannes Schweikle - Страница 18
ОглавлениеAUSNAHMSWEISE NAHM EVA DIE SCHLIMME STRASSE. Die hieß nicht nur so, wenn die Mosers mit ihren Kindern redeten. Sie war wirklich schlimm. Eine Häuserschlucht mit Fassaden, an denen sich schon der Stadtstaub angelagert hatte, als dies noch ein Armeleuteviertel gewesen war. Einfach verglaste Fenster in ausgelaugten Holzrahmen. Die Kneipe am Eck hatte gelbe Butzenscheiben, der Eingang war zugenagelt. Eine bleiche Stelle im Putz, da hatte mal das Wirtshausschild gehangen. Von hier torkelte niemand mehr nach Hause, diese Schneise diente nur noch dem Verkehr: schmaler Gehweg, keine Bäume, zwei Spuren stadtauswärts. Diese Einbahnstraße markierte die Grenze des Viertels, keiner überquerte sie zu Fuß oder gar mit dem Rad. Auf der anderen Seite gab es eine Turnhalle, in der Boxer trainierten. Keine schillernden Thai- oder Kickboxer, sondern die letzten Vertreter des Arbeitersports. Blasse Männer mit starkem Nacken, Bantam- und Weltergewicht. Schräg gegenüber hatte ein Möbelgeschäft eröffnet. Schau da mal rein, hatte ihre Freundin Barbara empfohlen, die Adresse geht gar nicht, aber die wollen die Wahnsinns-Mieten in den Fünf Höfen nicht bezahlen, was ja echt sympathisch ist.
Die Verkäuferin sprach mit holländischem Akzent, ironisch hob sie den Vorteil der schlechten Lage hervor: Hier fährt halb München raus nach Grünwald. Im Feierabendstau hat man Zeit, unser Schaufenster zu betrachten.
Wie es sich für eine Boutique gehört, gab es nur wenige, ausgewählte Stücke. Eine Parodie auf das Hirschgeweih des bayrischen Jägers, geformt aus Draht und Moos. Der absolute Hingucker war jedoch ein Sessel aus Indonesien. Reduzierte Formen, die ins Exotische spielten. Rattanstäbe waren zu einer Sitzfläche gebogen, in der hohen Lehne liefen sie weit über Kopfhöhe einzeln aus, jeder hatte seine eigene Länge. Sie federten elastisch, Eva saß bequem, mitten in der Stadt hatte sie üppig wucherndes Schilf im Rücken. Sie fühlte sich wie am Ufer eines Sees, geborgen in der Natur, und feierte einen kleinen Triumph über ihre Mutter. Mit ihrem spießigen Ordnungssinn würde sie nie verstehen, wie man ein Möbelstück gut finden konnte, das der Schreiner nicht exakt in Form gebracht hatte. Die Holländerin erzählte von einer kleinen Manufaktur auf Sumatra, und Eva fand den Preis von 990 Euro in Ordnung. In Gedanken ersetzte sie bereits den braunen Schaukelstuhl im Wohnzimmer, in dem Korbinian gerne saß und las, seit er ihn als Student bekommen hatte, als Prämie für ein Zeit-Abonnement.
Um drei war sie mit Barbara verabredet. Zum Schokotraum waren es fünf Minuten zu Fuß. Früher war das eine Filiale der Stadtsparkasse, entsprechend schlicht wirkten die Räume. Die Pächterin hatte nicht genug Geld, um die abgehängte Funktionsdecke herauszureißen und durch etwas Schöneres zu ersetzen. Sie war mit fünf Kameras bestückt. Schwarze, fiese Pickel, die unangenehm an Überwachung erinnerten. Die Pächterin war eine Französin, wohl mit afrikanischen Wurzeln, mit marokkanischen Accessoires hatte sie die Strenge des Ladenlokals gemildert. Sie sagte, sie sei froh über die Kameras, weil Kriminelle schon dreimal versucht hätten, nachts durch die großen Scheiben einzubrechen. Auch der Schokotraum lag an der Grenze des Viertels.
Im hinteren Teil des Cafés konnte man den Konditoren bei der Arbeit zusehen. Eva bestellte nie aus der Karte. Sie ging jedes Mal an die Theke und verwandelte sich in ein Kind, das sich nicht entscheiden kann, weil ihm die Augen übergehen. Links war die Truhe mit zehn Sorten hausgemachtem Eis, rechts die Vitrine mit Torten für Hochzeit und Kindergeburtstag. Aber das Beste war der lange Tresen in der Mitte: hinter Glas Petits Fours und Törtchen – rund und eckig, Nougat und Baiser, von Cassis bis Pistazie. An der Wand hing ein Schild: Ich mache erst Diät, wenn mir der Schal nicht mehr passt. Beim ersten Mal hatte Eva herzlich über diesen Spruch gelacht, und jedes Mal, wenn sie ihn las, freute sie sich wieder. Auch ohne viel Sport hatte sie nach zwei Schwangerschaften ihre Konfektionsgröße gehalten. In Jeans sah ihr Po noch immer begehrenswert aus, und sie hatte keine Winkearme, das war ihr wichtig. Gut, über den Hüften hatte sie ein wenig zugelegt, aber Korbinian machte keine Bemerkungen, nicht mal mit den Augen. Wegen ihr hatte er seine Ex und die beiden Mädchen verlassen. Am Anfang hatten sie gemeinsam Dessous ausgesucht, damals war er scharf auf Spitze. Irgendwann stand sie wieder allein in der Umkleidekabine. Sie wusste, dass in seinem Waschbeutel neben Aspirin und Pflaster immer ein Kondom steckte. Wenn er von den kurzen Reisen nach Berlin oder Brüssel zurückkam, kontrollierte sie. Es hatte erst einmal gefehlt.
Eva entschied sich für eine Pfirsich-Maracuja-Schnitte, Barbara nahm nur einen Latte Macchiato. Auf der Fensterbank lagen Zeitungen. Barbara zeigte auf das zwei Wochen alte Magazin, in dem Evas Bildreportage über die Ankunft der Flüchtlinge in München erschienen war, und sagte mit unvergifteter Anerkennung: Echt eine tolle Arbeit! Eva musste das Magazin nicht aufschlagen, sie wusste auswendig, dass ihre Bildstrecke von Seite 12 bis 22 ging. Am Schluss hatte die Redaktion richtig Mut bewiesen, das letzte Foto verstand der Betrachter nicht auf Anhieb. Es zeigte zwei junge Männer, die in einem Zelt knieten und ein Gerät verkabelten – Helfer der Münchner Freifunker versorgten eine Notunterkunft mit WLAN. Eva seufzte und sagte: Ach, weißt du, ich würd’ so gern mehr arbeiten. Aber ich bin ja praktisch alleinerziehend.
Barbara nickte mitfühlend – es gehörte zur Grundausstattung der Frauensolidarität, sich in diesem Punkt gegenseitig zu bestärken. Eva ließ Vanillecreme auf der Zunge zergehen, dachte wehmütig an den Tag, an dem sie mit ihrer Kamera diese intensiven Momente festgehalten hatte, und klagte weiter: Gerade ist es ganz schlimm. Korbinian reist von einer Talkshow zum nächsten Vortrag. Und wenn er mal hier ist, schreibt er an seinem neuen Buch.
Barbaras Antwort gefiel ihr nicht. Sie sagte: Sei froh, dass er der Politik ins Gewissen redet. Und Deutschland an seine Verantwortung erinnert. Europa darf keine Festung werden!
Vor drei Tagen, bei einer Lesung im Kulturzentrum, hatte der Moderator ihren Mann mit den gleichen Worten gefeiert, und Eva war stolz auf ihn. Aber von einer Freundin erwartete sie keine politisch korrekte Analyse, sondern Zuspruch. Und jetzt fing Barbara auch noch von einem anderen Thema an. Es war Herbst, und sie müssten endlich die große Frage klären: welches Gymnasium? Barbaras Tochter Philine ging mit Lennart in die vierte Klasse, die Freundschaft zwischen den Kindern war noch inniger als die zwischen den Müttern. Barbara hatte schon das Max-Joseph-Gymnasium besichtigt, obwohl der Tag der offenen Tür noch lange nicht anstand. Ihr Urteil: schöne Anlage, auch die Klos sind sauber, moderner Computerraum, fahren regelmäßig Preise ein bei Jugend forscht, aber halt die alten Sprachen. Ich weiß nicht recht – Latein schon ab der fünften Klasse?
Für Eva Moser war klar, dass Lennart aufs Gymnasium gehen würde, dazu brauchte sie nicht auf die Empfehlung seiner Lehrerin aus der Grundschule zu warten. Sie spürte, wie wichtig die Weiche war, die sie jetzt stellen musste für die Zukunft ihres Kindes. Und sie hatte das Gefühl, mit dieser Entscheidung allein zu sein. Von Lennarts Vater hatte sie sich ein Jahr nach der Geburt getrennt, und eigentlich war sie froh, dass er sich nicht groß für seinen Sohn interessierte. Einmal hatte er ein Wochenende mit ihm zelten wollen, aber das hatte sie abgelehnt. Korbinian mischte sich sporadisch und halbherzig in die Erziehung ein. Er wusste nicht, welche Rolle er übernehmen sollte, schwankte zwischen einem Kumpel und dem Hauslehrer des jungen Wilhelm von Humboldt. Das mit den alten Sprachen fände er garantiert gut, aber Lennart war nicht sein Kind. Korbinian konnte Vorschläge machen, mehr nicht. Einerseits war Eva stolz auf ihre Autonomie. Andererseits drückte diese Entscheidung sie schwerer, als sie sich oder gar Barbara eingestehen wollte. Es war ja nicht so wie in der Kleinstadt, in der sie aufgewachsen war. Dort hieß die Alternative Gymnasium oder Realschule, damit hatte es sich. In München gab es so viele Möglichkeiten. Jede Schule pflegte ihr eigenes Profil. Das Gymnasium im Stadtteil war vielleicht nicht das richtige. Gut möglich, dass ihr Sohn auf einer anderen Schule, die mit Bus und U-Bahn zu erreichen war, besser gefördert wurde. Sie sah auf die Uhr und war froh, dass sie seufzen konnte: Ich muss los, mein Herz, freitags macht die Kita blöderweise schon um vier zu.
Der Weg zu den Isarzwergen führte durch das Innere des Viertels. Vorbei am Architekturbüro, vor dem eine rote Vespa auf dem Gehweg abgestellt war. Ein ehemaliger Milchladen, hinter der Schaufensterscheibe stand Manfreds Schreibtisch mit dem großen Apple, sie winkten sich zu. Korbinian hatte ja schon als Student hier gewohnt. Die Wohngemeinschaft, ein Achtundsechziger-Auslaufmodell, bröckelte in den Achtzigerjahren, und als die Wohnung im vierten Stock wegen eines Streits der Erbengemeinschaft billig zum Verkauf stand, wurde Korbinian auf Drängen und mit finanzieller Unterstützung seines Vaters zum Immobilienbesitzer. Den rumpeligen Dachboden gab’s fast geschenkt dazu, und als Eva einzog, fand sie in Manfred einen genialen Verbündeten, der dieses stickige Gebälk in eine Galerie verwandelte. Im Hof ständerte er Balkone an, aber die kamen erst später, diese Baustelle fiel in ihre Stillzeit mit Maja und war nervenaufreibend. Leider gab es damals noch nicht die Hebamme im Viertel, an deren Schild sie jetzt vorbeiging. Um die Ecke war im Frühjahr der Verein für kulturelle Vielfalt der Mädchen eingezogen. Ein interessantes Angebot, sie würde es studieren, wenn Maja größer war, bestimmt konnte sie davon profitieren.
Die Erzieherin der Isarzwerge war schon weg, die anderen Kinder alle abgeholt, die Praktikantin wartete genervt auf Eva. Es war zehn nach vier, sie wollte ins Wochenende, hatte Maja schon den Helm aufgesetzt und ihr Laufrad aus dem Unterstand neben dem Trampolin im Hof der Kita geholt. Aber das Kind wusste, dass es erst am Montag wiederkommen würde, deshalb musste es noch zum Hochbeet, wo es winkte und sich fröhlich verabschiedete: Tschüss, Radieschen, wachst schön weiter!
Vergnügt rollte Maja neben ihrer Mutter her. Ihre Füße trippelten, voller Bewegungsdrang brachten sie das Laufrad in Schwung. Sie steckten in weißen Sneakers, die es auch in Kindergrößen gab. Den Umgang mit der Handbremse beherrschte sie noch nicht. Vor dem Gemüsestand, wo der Bürgersteig schmal wurde, schliffen die Schuhe energisch mit den Kappen über den Asphalt. Begeistert erzählte Maja von dem Koala, der heute die Isarzwerge besucht hatte.
Der ist so weich und kuschelig. Dieser Bär kommt von gaaanz weit her und versteht nur Englisch. Wir haben seine Sprache gelernt.
Das Mädchen fuhr schlingernd und wiederholte wie aufgezogen: My name is Maja, my name is Maja, my name is Maja.
So rollte sie zum Multikulti-Brunnen. Er hieß anders, aber von den Bewohnern des Viertels wurde er nur noch so genannt, und es klang ambivalent. Einerseits war man stolz auf die bunte Mischung der Restaurants rund um den gepflasterten Platz mit dem Brunnen in der Mitte: ein Inder, ein Thailänder, ein Portugiese, alles fußläufig und ohne Parkplatzsorgen zu erreichen. An den Fassaden hatte man nach dem Krieg nicht den Putz abgeschlagen, im Glasscherbenviertel schien dieser Aufwand an Vergangenheitsbewältigung zu groß. Jetzt freuten sich alle über diese frühere Vernachlässigung. Der Türke zeigte, dass die Küche seines Landes weit mehr zu bieten hatte als Döner. Bei Tatami musste man unbedingt reservieren. Und Zeit mitbringen, der japanische Koch rollte jedes Sushi vor den Augen seiner Gäste, neben der Vitrine mit dem rohen, allerdings nicht politisch korrekten Thunfisch.
Andererseits war nicht nur Eva genervt, dass dieser bunte Platz so viele Touristen anlockte. Schwaben, Preußen, neuerdings Chinesen – für alle erfüllte sich hier das Versprechen von der Vielfalt einer weltoffenen Großstadt. Friedliches Nebeneinander, appetitlich duftend, zu erschwinglichen Preisen. Auch das Gschwerl aus Dachau und Neuperlach hatte den Platz am Brunnen schon auf dem Zettel. Zwischen den Restaurants gab es verschiedene Schwulenläden, mitten in Bayern, diese Minderheit steigerte noch das exotische Flair.
Eva und Korbinian, Barbara und alle Eltern der Isarzwerge teilten eine Überzeugung: Gentrifizierung ist böse. Ein Krebsgeschwür des Kapitalismus, das Gewachsenes zerstört. Die Gier der Spekulanten lässt die Mieten explodieren. Klar, dass der alte Schuhmacher sich nicht halten konnte, dort war jetzt eine Vinothek. Deshalb hatte die Metzgerei Kultstatus. Karl Wamsler führte den Familienbetrieb in dritter Generation. Bei ihm gab es Bries und Milzwurst, selbstverständlich auch Lüngerl und Kutteln. Weil er sein Handwerk verstand, hütete er freilich nicht die Asche der Vergangenheit, sondern war offen für Neues. Er liebte die Koteletts vom Mangalitza- Wollschwein und war den dickköpfigen Bauern dankbar, die diese fast ausgestorbene Nutztierrasse wieder züchteten. Sie ließen ihren Schweinen Zeit, sich mit artgerechtem Futter groß und dick zu fressen. Wenn sie geschlachtet wurden, schmeckte man den Unterschied.
Seine Frau führte resolut den Laden. Keiner aus Evas Generation kannte ihren Vornamen, sie wurde von allen respektvoll Frau Wamsler genannt. Jeden Werktag stand sie in einer sauberen Kittelschürze vor den weißblauen Kacheln und begrüßte die Kunden auf ihre eigene Art. Sie hatte schon in der Lehre verstanden, dass man freundlich sein muss, wenn man etwas verkaufen will. Sie merkte sich auch die Namen. Aber wenn sie sagte: Grüß Gott, Frau Moser, klang das nicht geschleimt. Weil sie stolz genug war auf das, was die Metzgerei Wamsler zu bieten hatte, machte sie sich keinen Zentimeter kleiner, als sie war. Sie träumte auch nicht von einem Feinkost- oder Delikatessenladen. Wer Tofu will, soll bittschön woanders hin. Beim Friseur – ein junger Mann mit Allüren hatte den alten Salon drei Häuser weiter übernommen – hatte sie neulich einen Spruch gelesen:
Was Friseure können, können nur Friseure
So ein saudummes Schild würde Helga Wamsler nie an ihre Kacheln hängen. Aber wenn sie es sich genau überlegte, war der Satz in der Sache richtig.
Am späten Freitagnachmittag war der Laden voll. Das Wetter sollte am Wochenende schön werden, Eva wollte mit der Familie noch einmal grillen, vielleicht das letzte Mal in diesem Herbst, wer weiß. Weil der bayrische Metzger Wamsler nichts gegen die Küche Nordafrikas und auch keine Vorurteile gegen Lammfleisch hatte, galten seine Merguez im ganzen Viertel als Geheimtipp. Lennart mochte die Cevapcici, Maja nagte jedes Mal mit Begeisterung an ihrem Schaschlik-Spieß, und der war nicht mit Billigfleisch bestückt. Dazu kamen noch zwei Steaks, Pute und Rind, falls Korbinian doch da wäre. Ach ja, und dann noch Aufschnitt bitte.
Das Warten und die Bestellung dauerten Maja zu lang. Sie saß auch in dem engen Laden auf ihrem Laufrad. Eva hatte ihrer Tochter die Tür aufgehalten, und sie war wie eine Prinzessin hineingerollt. Helga Wamsler hatte kritisch eine Augenbraue hochgezogen, aber nichts gesagt. Jetzt rollerte Maja vor und zurück, so weit es eben ging. Eine ältere Kundin brachte ihre Tasche in Sicherheit, auch das sah Frau Wamsler. Maja summte vor sich hin, ihre Mutter lächelte auch dann noch, als sie einem Mann von hinten gegen die Wade fuhr. Nicht schlimm, sie hatte ja nicht viel Schwung. Aber für die Frau hinter der Theke war eine Grenze des zivilisierten Umgangs überschritten, den man auch Kindern zumuten konnte. Streng sagte sie: Schluss jetzt, Maja – du fährst ja den Leuten in die Haxen!
Das ging gar nicht. Eva Moser stand zwischen den Fronten. Sie brachte ihre Tochter in die Montessori-Kita, damit sie zu einem selbstbestimmten Menschen heranwachse. Die Stadt war sowieso viel zu eng für den natürlichen Bewegungsdrang eines Kindes. Und jetzt musste sie sich von der Wamslerin wegen einer Kleinigkeit schurigeln lassen. Aber sie spürte, dass sie hier im Laden keine Diskussion anfangen konnte wie beim Elternabend. Dort hatte sie dem Satz zugestimmt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Aber doch nicht die Metzgersfrau.
Stumm biss sie die Zähne zusammen und zahlte. Maja hatte nach dem Anpfiff sofort alle Fahrbewegungen eingestellt. Aber das Kind wirkte in keiner Weise verstört, es saß still auf seinem Laufrad und wartete auf den rituellen Abschluss des Einkaufs. Helga Wamsler holte mit der Gabel eine Scheibe von der aufgeschnitten Lyoner und reichte sie über die Theke. Maja streckte ihr wonnig die Hand entgegen. Aber ihre Mutter sagte gepresst: Nein danke!