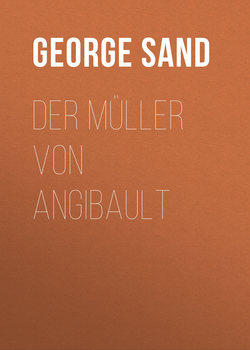Читать книгу Der Müller von Angibault - Жорж Санд - Страница 8
Erster Tag
5. Kapitel.
Die Mühle
ОглавлениеIndem Marcelle durch das weit hingedehnte Gehölz wandelte, glaubte sie in einen noch jungfräulichen Wald einzutreten. Der Boden, vielfach durch die Gewässer unterhöhlt und zerrissen, war mit einer üppigen Vegetation bedeckt. Man sah, dass der kleine Fluss in den Regenmonaten große Verheerungen anzurichten imstande sei. Prächtige Weiden, Buchen und Zitterespen, deren ungeheure Wurzeln unbedeckt über den feuchten Sand hinkrochen, ineinander verschlungenen Schlangen ähnelnd, neigten sich gegeneinander in einer majestätischen Unordnung. Das in mehrere Arme geteilte Flüsschen schnitt launenhaft eine Menge Grasplätze voneinander ab, auf welchen über dem Rasen wilde Rosen blühten, üppige Brombeerranken sich durcheinanderkreuzten und hundert Arten von wilden Kräutern in buschhohem Wuchse und der unvergleichlichen Anmut ihres freien Daseins prangten. Niemals hätte ein englischer Garten diesen Überschwang der Natur, diese so glücklich gruppierten Massen, diese zahllosen Bassins, in welche sich der Bach unter Blumen einmündet und aus welchen er wieder nach allen Seiten hin entfließt, diese Laubengänge, welche über dem Wasser sich zusammenranken, diese reizenden Zufälligkeiten des Bodens, diese durchbrochenen Dämme, diese zerstreuten Pfähle, welche das Moos überwuchert und welche hergesetzt worden zu sein schienen, um die Schönheit des Ganzen zu vervollständigen, nachahmen können.
Marcelle verharrte lange in einer Art von Entzückung und würde noch länger sich selbst vergessen haben, ohne die Anwesenheit des kleinen Eduards, der wie ein mutwilliges Hirschkalb umherlief, begierig, die Spuren seiner Füßchen dem frischen Ufersand einzudrücken. Die Besorgnis, er möchte ins Wasser fallen, erweckte sie aus ihrem Selbstvergessen.
Sich an seine Schritte heftend, lief sie neben ihm her, und sich mehr und mehr in die reizende Einsamkeit vertiefend, meinte sie von einem jener Träume befangen zu sein, in welchen uns die Natur in ihrer ganzen Herrlichkeit erscheint, so dass man sagen könnte, man hätte eine Vision vom irdischen Paradies gehabt. Endlich zeigte sich der Müller und seine Mutter auf dem gegenüberliegenden Ufer, er, sein Netz nach Forellen auswerfend, sie, ihre Kuh melkend.
»Ah ha, meine kleine Dame! Sind Sie schon aufgestanden?« rief der Mehlhändler aus. »Sie sehen, wir beschäftigen uns mit Ihnen. Da ist meine alte Mutter, welche sich quält, dass sie Ihnen nicht mit etwas Gutem aufwarten könne, ich aber, ich sage, dass Sie mit unserem guten Willen vorlieb nehmen werden. Wir sind freilich weder Garköche noch Wirte, aber ein guter Appetit auf der einen Seite und ein guter Wille auf der andern…«
»Sie behandeln mich viel zu gut, liebe Leute«, versetzte Marcelle, indem sie, mit Eduard auf den Armen, eine Bohle, welche als Brücke diente, überschritt, um sich mit ihren Wirten zu vereinigen. »Niemals habe ich so gut geschlafen, niemals einen so schönen Morgen gesehen wie bei Ihnen. Was Sie für schöne Forellen fangen, Herr Müller, und wie weiß und rahmig Ihre Milch ist, Mutter! Sie verziehen mich und ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
»Wir sind schon bedankt, wenn Sie zufrieden sind«, versetzte die Alte lächelnd. »Wir haben noch niemals so vornehme Leute gesehen, wie Sie sind, und verstehen keine Komplimente zu machen. Aber wir sehen wohl, dass Sie brav und ohne Umstände sind. Kommen Sie, wir wollen ins Haus gehen; der Eierkuchen wird bald gebacken sein und der Kleine mag gewiss die Erdbeeren. Wir haben deren ein ganzes Beet voll im Garten und es macht ihm vielleicht Spaß, sie selber zu pflücken.«
»Sie sind so gut und Ihr Land ist so schön, dass ich mein Leben hier zubringen will«, sagte Marcelle herzlich.
»Ist’s wahr?« entgegnete der Müller mit wohl wollendem Lächeln; »gut, wenn es Ihnen Ihr Herz sagt. … Ihr seht jetzt, Mutter, dass unser Land nicht so übel ist, wie Ihr meint, da ja eine so reiche Dame sich hier wohlbefinden kann.«
»Ja, unter der Bedingung, dass sie sich ein Schloss baut, und doch wäre dieses Schloss nicht am besten Platze angebracht.«
»Ist’s möglich, dass es Ihnen hier nicht gefällt?« fragte Marcelle erstaunt.
»O, mir gefällt es schon«, entgegnete die Alte, »Ich habe hier mein Leben verbracht und werde, so es Gott gefällt, hier sterben. Ich habe in den fünfundsechzig Jahren, seit ich hier hause, wohl Zeit gehabt, mich anzugewöhnen, und dann ist man ohnehin genötigt, mit dem Land, das man hat, zufrieden zu sein. Aber Sie, gnädige Frau, wenn Sie gezwungen wären, hier den Winter zuzubringen, so würden Sie nicht mehr sagen, das Land sei schön. Wenn die großen Gewässer alle unsere Felder überschwemmen und man nicht einmal mehr auf den Hof hinausgehen kann, nein, nein, dann ist’s eben nicht sehr hübsch.«
»Bah, bah, die Weiber fürchten sich immer«, sagte der große Louis. »Ihr wisst recht wohl, dass die Gewässer dem Hause nichts anhaben können und dass die Mühle sicher liegt. Und dann, wann die schlimme Jahreszeit kommt, nun so muss man sie eben hinnehmen, wie sie ist. Den ganzen Winter über sehnt Ihr Euch nach dem Sommer, Mutter, und während des Sommers beunruhigt Ihr Euch fortwährend über den kommenden Winter. Ich meinesteils sage, dass man hier glücklich und sorgenlos leben kann.«
»So, und warum tust du denn nicht, was du sagst?« erwiderte die Mutter. »Bist du sorglos, du? Fühlst du dich als Müller glücklich und als Bewohner eines so oft rings im Wasser stehenden Hauses? Ei, gib Acht, wenn ich alles wiederholen wollte, was du so oft über das Missgeschick, nicht besser zu wohnen und kein Glück machen zu können, gesagt!…«
»Es ist sehr überflüssig, alle die Dummheiten zu wiederholen, welche ich schon gesprochen, Mutter, und Ihr könnt Euch diese Mühe wohl ersparen.«
Indem er diese Worte in vorwurfsvollem Tone sprach, blickte der Müller seine Mutter sanft und fast flehend an. Ihre Unterhaltung schien der Frau von Blanchemont keineswegs so banal, wie sie bisher dem Leser vorgekommen sein mag. Ihrer Stimmung zufolge wünschte sie zu erfahren, in welcher Weise das bäurische Leben, für die Armen das noch am wenigsten harte, von denen, die es zu führen genötigt waren, aufgefasst und hingenommen werde. Sie brachte zu dieser Erforschung keine allzu romanhafte Vorstellungen mit, denn Heinrich, welcher an dem Vermögen seiner Geliebten, in ein solches Leben sich zu finden, zweifelte, hatte ihr die Entbehrungen und Mühen desselben nicht verborgen. Allein sie glaubte, diese Mühen würden ihre Kräfte nicht übersteigen, und was ihr an ihren Wirten besonders auffiel, war der Grad von Philosophie oder Unempfänglichkeit derselben für die Natur, verglichen mit den Eindrücken, welche diese auf ihr eigenes Gemüt hervorbrachte. Als daher der große Louis weggegangen, um, wie er sagte, seine Forellen in die Bratpfanne zu liefern, ließ sie ihrer Neugierde ein wenig den Lauf, indem sie zu der alten Müllerin sagte:
»Sie fühlen sich also nicht glücklich und auch Ihr Sohn ist, obgleich er so frohmütig aussieht, zuweilen bekümmert?«
»O, gnädige Frau, was mich betrifft, so bin ich reich und zufrieden, wenn ich meinen Sohn glücklich sehe. Mein verstorbener Mann war in guten Umständen, sein Handel ging gut, allein leider ist er gestorben, bevor er seine Kinder erziehen konnte, und so musste ich es zu machen suchen, so gut es ging, und alle meine Kinder nach Kräften aussteuern. Da hat denn freilich keines gar viel bekommen. Die Mühle blieb meinem Louis, welchen man den großen Louis nennt, wie man seinen Vater den großen Jean nannte und wie man mich die große Marie nennt; denn, Gott sei Dank, man gedeiht recht wacker in unserer Familie und meine Kinder sind alle wohlgewachsen. Das ist aber auch das vorzüglichste unserer Besitztümer; die andern sind so unbedeutend, dass man sich keine falschen Hoffnungen machen kann.«
»Aber warum wollen Sie denn reicher sein? Haben Sie von Ihrer Armut irgendwie zu leiden? Es scheint mir, dass Sie gut wohnen, dass Ihr Brot weiß, Ihre Gesundheit vortrefflich ist.«
»Ja, ja, Dank sei dem guten Gott, wir haben das Nötige, und es gibt vielleicht vermöglichere Leute, als wir sind, die nicht alles haben, was sie brauchen. Aber sehen Sie, gnädige Frau, man ist glücklich oder unglücklich, je nachdem man sich’s einbildet.«
»Sie kommen auf den rechten Punkt;« sagte Marcelle, welche in den Zügen und in der Sprache der Müllerin eine naive Klugheit und einen gerechten Sinn wahrnahm. »Da Sie sich aber sehr gut in die Dinge zu schicken wissen, wie kommt es, dass Sie sich beklagen?«
»Nicht ich beklage mich, sondern mein großer Louis, oder, um deutlicher zu sprechen, ich bin es, die sich beklagt, weil ich ihn unzufrieden sehe, und er ist es, der sich nicht beklagt, weil er mutig ist und mich zu betrüben fürchtet. Aber zuweilen entfährt ihm bei alledem doch ein Wort, ein Wort, das mir das Herz zerschneidet. Er sagt dann: ›Niemals, niemals, Mutter!‹ und will damit sagen, dass er nichts mehr hoffe. Aber da er, wie sein armer Vater selig, von Natur zur Heiterkeit aufgelegt ist, so gibt er sich zuweilen das Ansehen, als hätte er sich gefasst, und macht mir allerlei Schwänke vor, sei es, dass er mich trösten will, sei es, dass er sich einbildet, das, was er sich in den Kopf gesetzt, werde noch eintreffen.«
»Aber was hat er sich denn in den Kopf gesetzt? Ist es Ehrgeiz?«
»Ach freilich, ’s ist ein außerordentlicher Ehrgeiz, eine wahre Narrheit, und doch ist’s nicht die Liebe zum Geld, denn er ist nicht geizig, durchaus nicht. Bei der Teilung der Erbschaft hat er seinen Brüdern und Schwestern alles abgetreten, was sie wollten, und wenn er irgendeinen Gewinnst macht, so ist er bereit, mit jedem Bedürftigen zu teilen. Auch Eitelkeit ist es nicht, denn er geht immer in seiner Bauerntracht, obgleich er gut erzogen wurde und wohl die Mittel besäße, sich zu kleiden wie ein Städter. Endlich ist’s auch nicht Hang zur Verschwendung, zum lustigen Leben, denn er enthält sich von allem und geht nur hin, wohin seine Geschäfte ihn rufen.«
»Nun denn, was ist es doch?« fragte Marcelle, deren sanfte Züge und herzlicher Ton das Vertrauen der alten Frau unmerklich gewonnen.
»Ei, was meinen Sie, dass es anders sein könne, wenn nicht die Liebe?« versetzte die Müllerin mit jenem geheimnisvollen Lächeln und jenem unbeschreiblichen Augenblinzeln, welches zwischen allen Frauen, seien sie sich im Alter oder Rang noch so ungleich, betreffs des Kapitels der Liebe Verständnis und Teilnahme vermittelt.
»Sie haben Recht«, sagte Marcelle, der großen Marie nähertretend, »es ist die Liebe, diese große Frieden- und Freudenstörerin der Jugend! Und ist die Frau, welche er liebt, denn so gar reicher als er?«
»O, ’s ist keine Frau! Mein armer Louis hat zu viel Ehre im Leib, um an eine Frau zu denken! ’s ist, ein Mädchen, ein junges Mädchen, ein hübsches Mädchen und, meiner Treu, ein braves Mädchen, das muss man sagen. Aber sie ist reich, sehr reich und nie werden ihre Eltern sie einem Müller geben wollen.«
Marcelle, welche von der Ähnlichkeit zwischen dem Roman des Müllers und dem ihres eigenen Lebens betroffen wurde, verriet eine mit Rührung vermischte Neugierde.
»Aber wenn dieses hübsche und brave Mädchen Ihren Sohn liebt«, sagte sie, »so wird sie ihn zuletzt doch heiraten.«
»Das hab’ ich mir auch schon gesagt, gnädige Frau, denn sie hat ihn gern, dessen bin ich gewiss, obgleich mein großer Louis es nicht weiß. ’s ist ein kluges Mädchen und wird zu keinem Mann sagen, sie wolle ihn heiraten ihren Eltern zum Trotz. Und dann ist sie ein wenig schelmisch, ein wenig kokett, wie man das in ihrem Alter so ist, denn sie ist erst achtzehn. Ihr neckisches Gesicht bringt meinen Sohn zur Verzweiflung, so dass ich, wenn ich sehe, dass er nicht isst und seinen Verdruss an Sophie, unserer Stute, mit Respekt zu sagen, auslässt, mich nicht enthalten kann, ihm zu sagen, was ich denke. Er glaubt mir ein wenig, denn er sieht wohl, dass ich die Weiberherzen länger und besser kenne als er. Ich, ich sehe es gar wohl, dass die Schöne errötet, wenn sie mit ihm zusammentrifft, und dass sie ihn mit den Augen sucht, wenn sie herkommt; aber ich tue Unrecht, den Knaben in seiner Narrheit zu bestärken, und würde besser tun, wenn ich ihm sagte, er solle sie sich aus dem Sinne schlagen.«
»Warum denn?« fragte Marcelle. »Die Liebe macht alles möglich. Seien Sie versichert, gute Mutter, ein liebendes Weib ist stärker, als alle Hindernisse.«
»Ja, so dachte ich auch, als ich jung war. Ich sagte mir, die Liebe eines Weibes sei wie ein Waldstrom, der alles, was sich seinem Lauf entgegenstellt, durchbricht und der Schleusen und Dämmen spottet. Ich war reicher, als mein armer großer Jean, ich, und doch hab’ ich ihn geheiratet. Aber es war doch kein solcher Unterschied, wie zwischen uns und der Jungfer…«
Hier unterbrach der kleine Eduard die Müllerin, indem er seiner Mutter zurief:
»Schau’ einmal, Heinrich ist hier!«