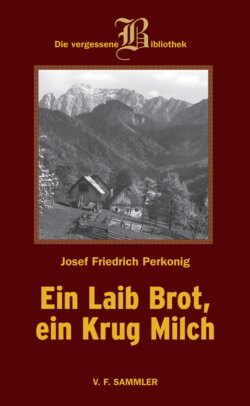Читать книгу Ein Laib Brot, ein Krug Milch - Josef F Perkonig - Страница 11
Ein Laib Brot, ein Krug Milch
ОглавлениеAm zwölften März um die Mittagszeit springt die Sonne aus dem Berg, gerade nur für ein paar Augenblicke, daß man sie wieder sehen kann; ausgelöscht ist sie also in vier Monaten hinter dem Gebirge nicht, sie macht ein paar winzige Schritte in den freien Himmel hinein, daß man sie leuchten und glänzen sieht und daß die steinalte Sonnenuhr auf der Hauswand in der Rauth schnell die Mittagstunde schlagen kann, dann ist sie auch schon wieder dahin, in den anderen grauen Kalkberg hinein. Der Stundenschlag der Sonnenuhr geht über steiniges Feld und dürre Wiese hin, bis hinauf in den steilen Wald des Ainetter, aber auch nicht ein Haar über seine Marchen hinaus, und genau so weit hören sie auch, wie das goldene Sonnenlicht rauscht, da es zwischen zwei Felszinken für ein paar Augenblicke seine Macht wieder errungen hat.
An den ersten Sonnensprung am zwölften März denken die Ainetterischen seit anno Schnee einen Winter lang immer wieder; wird die Sonne ein roter Kürbis sein und ein gutes Jahr verheißen, oder ein blasser Eidotter und einen dürftigen Sommer anzeigen, oder wird sie sich gar hinter Gewölk verstecken und die Leute in der Rauth um ihre Feier bringen?
In der Rauchküche. Vater, Tochter und zwei Söhne saßen auf dem Herd, von der Flamme angeglüht, und die Bäurin kochte das Abendmahl. Die fünf müden Menschen schwiegen, aber es redete für sie alle der Herd; er war so alt wie das lärchene Haus, und um sein Feuer waren alle Geschlechter gesessen, die darin wohnten, und jedes hatte denselben ehrwürdigen Namen; der währte an diesem Herde nun schon beinahe vierhundert Jahre lang.
(Mein Herz ist im Hochland)
Alle Jahre am zwölften März geschieht das nämliche: die Ainetterleute stehen, angetan wie am Sonntag, um den Tisch herum und warten andächtig, bis die Sonne aus dem Berge kommt, dann wird sie dort durch das kleine tiefe Fenster scheinen, der Glanz wird sich auf die wurmstichige Tischplatte legen, gerade nur auf sie und sonst nirgendshin in der Stube, es ist ein dickes Sonnenlicht, so dick, daß es das Fenster genau ausfüllt. Es stürzt sich herrisch auf den Tisch, die Sonne ist hinter den Bergen hungrig geworden, kein Wunder, wenn sie beinahe vier Monate lang hat fasten müssen, aber der Tisch ist gedeckt, wie zu Zeiten des ersten Ainetter, der schon die Sonne gefüttert hat.
Ein Laib Brot, ein Krug Milch, es ist immer dieselbe Zehrung, die man ihr hinstellt auf den Tisch, davon sie essen und trinken wird bei ihrer kurzen Einkehr; es ist noch immer der grünliche, bauchige Tonkrug des ersten Ainetter, der die Sonnenuhr an die Hauswand sinniert hat, nicht einmal der Henkel ist abgebrochen.
Der jetzige Ainetter ist erst zu Lichtmeß aus dem Kriege heimgekehrt und hat ein hölzernes Bein und ein steinernes Herz mitgebracht.
„Wir haben in dem Jahr zu wenig Brot“, sagte er in den ersten Märztagen, „und es sind nicht die Zeiten für verschimmelte Bräuche.“
Die Ainetterin blickt ihn mit großen Augen stumm an, als so die kranke Welt aus ihm redet.
Es ist wahr, die letzte Gerste wird bald vermahlen sein, und sie essen wochenweise Erdäpfel statt Brot; die Sonne im vorigen Jahr war nicht umsonst wie eine weiße Topfenkugel. Am zwölften März aber bringt die Bäuerin den Brotlaib, sie drückt ihn an den Bauch und wischt mit der Blaudruckschürze die graue, schwarz durchsprengelte Asche von ihm ab; dann legt sie ihn auf den Tisch.
„Es ist an dem Brot genug“, meint der Ainetter finster, denn die eine Kuh ist im Herbst am Milchfieber eingegangen, er hat sie nicht mehr angetroffen; die andere hat sich an der früh aperen Wiese eine Kolik an den Leib gefressen, und er mußte sie selber schlagen; und die dritte hat noch das Kalb. Es ist also keine Milch beim Haus, und hie und da muß man sie vom Bödner in der Äußeren Rauth ausleihen. Wenn der Krug nur nicht so groß wäre!
Die Ainetterin geht aus der Stube und kommt mit dem vollen Krug, sie wischt mit der Schürze den Rand ab, daß jemand rein zu trinken hat, und stellt ihn neben den Brotlaib hin. Und jetzt kann die Sonne kommen, sie findet Speise und Trank vor.
Die Ainetterin schaut hinauf zu dem Berg, schon hat er auf der einen Seite, wo die Sonne aus ihm springen wird, einen silbernen Rand, sie weiß es von anderen Jahren her, daß es nun nicht mehr lange währen wird; gleich darauf ist der Rand dunkler und wird bald wie Kupfer sein.
Jetzt ist es nahe an dem heiligen Augenblick, und man darf die Sonne nicht versäumen, es wäre ein nie begangener Frevel, auf den göttlichen Gast nicht zu achten, der sich schon angekündigt hat und gleich durch das Fenster eintreten wird.
Und nun gilt es, die ganze Familie beisammen zu haben, sonntäglich gewandet sind die drei Knaben schon seit dem frühen Vormittag, aber noch schwärmen sie draußen herum. Der Großvater, ja, der ist in der Stube, er sitzt steif und still auf der Ofenbank seit dem Morgengrauen, es leidet ihn die halben Nächte nicht im Bett, und er zieht mühsam die Luft ein, gegen Mittag nimmt das Asthma zu, wie alles mit dem Tage aufsteigt, das Wasser im Leib, der Brand in der Wunde; er ist blau im Gesicht und netzt die Lippen mit der Zunge. Die Ainetterin weiß, er möchte einen Schluck Milch.
Zwei Buben hat sie schnell herinnen. Stephan, der Älteste, tritt hin zum Tisch und verlangt von dem seltenen Brot, gerade die vergangene Woche haben sie es alle wieder nicht gehabt. Da besinnt er sich, für wen der Brotlaib gerichtet ist, erschrickt ein wenig und berührt ihn nur mit dem Zeigefinger behutsam; den Finger aber leckt er ab.
„Die verdammte Sonne“, neidet er; für einen vierzehnjährigen Knaben ist es schon ein furchtbarer Fluch.
Der Ainetterin stockt der zornige Verweis im Munde, denn der Mann ist eingetreten, und sie möchte ihn nicht zum Helfer für Stephan machen. Er hat kein Sonntagsgewand an, das Holzbein ist hoch hinauf schmutzig vom Stallmist, als hätte er mit ihm absichtlich darin herumgerührt, aber er ist noch zur rechten Zeit gekommen. Wohl tut er, als suche er etwas in der Stube, aber sie weiß, daß er nichts finden will.
Gleich hinter ihm schreitet Franz, der Mittlere, durch den Hausflur herein. Was für eine Trompete so eine fünfjährige Stimme schon sein kann! Er stößt die Tür mit dem Fuß auf und reckt eine blutige Hand vor sich her. Rührt das von einem Messer, einer Glasscherbe, einem Draht, die Mutter kann es jetzt nicht erfragen, sie kann auch nicht die Leinwand aus der Truhe droben holen und einen Fleck davon abschneiden, die Hand soll bluten, die Hand muß bluten, jetzt, da die Sonne in jedem Augenblick aus dem Berge springen kann.
Florian, der Jüngste, mag schon mit drei Jahren kein Blut sehen; es würgt ihn zuerst ein paarmal, dann tritt er von einem Fuß auf den anderen und fängt an zu weinen. Die Ainetterin weiß, was es zu bedeuten hat, aber sie kann den zappelnden Florian jetzt nicht zum hohen Schierling hinausführen, wo er eigensinnig immer zu hocken wünscht, und sie läßt das kleine große Unglück geschehen.
Haben sich vier Mannsleute, zwei laute und zwei stille, gegen sie verschworen, die von dem Hausgeist in ihrer Treue bestärkt worden ist, warum sollte es nicht auch das fünfte Mannsbild tun? Sie wirft einen Blick auf den Großvater, er ist violett im Gesicht, zwischen den Lippen stehen ein paar kleine Blasen, er reckt den Kopf hoch aus dem Hals; und wenn er jetzt in den letzten Zügen läge, sie könnte nichts anderes tun, als ihm zu heißen, mit dem Sterben zu warten.
Zuerst muß die Sonne zu Besuch gewesen sein … jetzt … jetzt blitzt ein Strahl über den Tisch … und noch einer … noch einer … wie drei lange, leuchtende Messerklingen, sie schneiden den Brotlaib an, sie tauchen in die Milch. Und dann fällt die ganze Sonne über die Gaben her; oh, hat die hungrige Sonne eine Gier, sie hat nur ein paar Augenblicke Zeit, sich zu sättigen, es ist ein wildes Gerausch von dem Licht in der Stube, sie hören es alle, bis zu dem Büblein mit der Rotzglocke unter der Nase hinab, und einen Sonnensprung lang setzt ihr Leben aus.
Auf einmal ist es kirchenstill in der Stube, ein dünner Strahl greift noch an den Tischrand, es ist ein blinder Strahl, er findet nicht mehr zu Brotlaib und Milchkrug hin. Der andere Bergrand oben ist noch Kupfer, bald wird er Silber sein und zuletzt nur noch ein eisgrauer Fels.
Und nun wird Blut wieder Blut und Ungemach wieder Ungemach, ein finsterer Mann geht aus der Stube, als müßte er anderswo im Haus suchen, was ihm hier nicht unter die Augen gekommen ist. Der Großvater sinkt in sich zusammen, die Brust hat wieder Luft, und Stephan möchte von dem Brotlaib mit den Fingern ein Stück schwarzbraune Rinde abbrechen.
„Es ist steinhart“, sagt die Ainetterin ruhig, als höre sie das Zetern und Winseln der jüngeren Knaben nicht, „seit Heiligen-dreikönig aufgespart.“
Sie trägt den Brotlaib wie eine riesige dunkle Hostie vor sich zum Herd und legt ihn in das Feuer; er beginnt bläulich zu brennen und bald schlagen an manchen Stellen winzige gelbe Flämmchen aus ihm.
„Wir müssen es der Sonne nachschicken“, sagt sie geheimnisvoll, und alle drei Knaben schweigen plötzlich am Herde, bis der Brotlaib dunkelrot glüht wie ein Holzscheit.
Aber sie fangen wieder an zu jammern, zu schreien, zu winseln, als die Ainetterin den Krug holt. Sie sieht wohl, wie sich der alte Ainetter die blauen Lippen leckt und der Milch nachstarrt.
„Die Sonne ist durstig“, sagt sie draußen im Flur zu den drei wieder verstummenden Knaben, die sie begleiten, „wir dürfen sie nicht verkürzen.“
Und sie vergessen Hunger, Schmerz und Unbehagen, während die Mutter die Milch dahin gießt, wo sie am Zaun in sieben Wochen die Sonnenblumen pflanzen wird. Der Ainetter schaut ihr vom Stall aus zu und wendet sich finster ab.
Die Ainetterin lächelt ein wenig, soweit ihr ernstes Gesicht überhaupt lächeln kann. Fünf merkwürdige Mächte haben ihr in diesem Jahr etwas verwehren wollen, was nicht aufhören darf. Und die Sonne hat doch ihren Laib Brot, hat doch ihren Krug Milch!